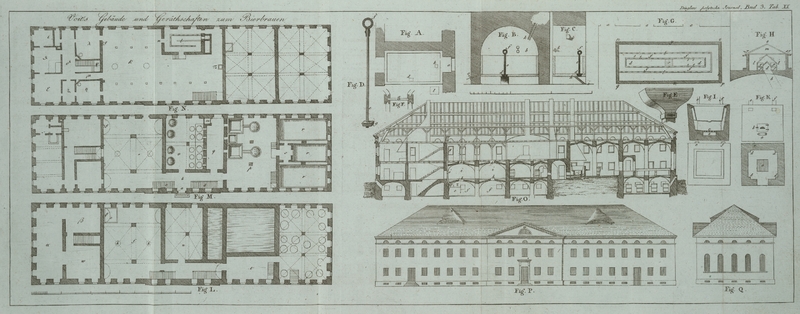| Titel: | Ueber das Bräuwesen in Augsburg, in Beziehung auf die vortheilhafteste Einrichtung eines Bräuhauses, und besonders über die Umwandlung eines schon bestehenden Gebäudes zu einer Bräuerei, Brandweinbrennerei und Essigsiederei. |
| Autor: | Richard Jakob August Voit [GND] |
| Fundstelle: | Band 3, Jahrgang 1820, Nr. XVIII., S. 129 |
| Download: | XML |
XVIII.
Ueber das Bräuwesen in Augsburg, in Beziehung auf die vortheilhafteste Einrichtung eines Bräuhauses, und besonders über die
Umwandlung eines schon bestehenden Gebäudes zu einer Bräuerei, Brandweinbrennerei und Essigsiederei.
Mit Abbildungen auf Tab. XX.
(Von dem Kreisbau-Inspector Voit in Augsburg.)
Voits Anweisung zur vortheilhaften Einrichtung eines Bräuhauses.
Bier ist das allgemeine Getraͤnk in Baiern, und das Braͤuwesen macht
einen bedeutenden Nahrungszweig in Staͤdten, und auf dem Lande aus.
Bierbraͤuereien und Brandweinbrennereien koͤnnen bei einer
zweckmaͤßigen Betreibung ein maͤchtiger Hebel zur Emporbringung der
Agrikultur durch Viehzucht und Viehmastung werden; denn nur durch jene ist es
moͤglich eine groͤßere Anzahl Vieh, als sonst der Umfang eines
Oekonomie-Gutes erlaubt, zu halten, und dadurch nicht nur vielen, sondern
auch vorzuͤglich guten Duͤnger zu gewinnen. Wenn demnach das
Braͤuwesen einen wesentlichen Einfluß in die Feldwirtschaft hat, verdient
dieses Gewerbe um so mehr die Aufmerksamkeit des Technikers, dem alles
Gemeinnuͤzige wichtig ist.
In Augsburg bluͤht die Bierbraͤuerei schon lange; das hier fabrizirte
Bier war immer in gutem Ruf, und es wurde als ein angenehmes, reines und geistiges
Getraͤnke geschaͤzt. Ich glaube daher den Lesern dieses Journals einen
Dienst zu erweisen, wenn ich von der Fabrikation des Augsburger Biers hier so viel
mittheile, als der Baumeister, welcher ein Braͤuhaus, ein in vielen
Ruͤcksichten wichtiges Gebaͤude, auffuͤhren soll, zu wissen
noͤthig hat.
Zur Erzeugung des Biers wird Gerste und Hopfen genommen; denn nur selten und an wenig
Orten wird Weizenbier gebraut.
Aus Gersten kann braunes und weises Bier gemacht werden, und das erste unterscheidet
sich in Winter- oder Schenkbier, und in Lager- Sommer- oder
Maͤrzen-Bier.
Das aus der Gerste bereitete Malz ist entweder Darr- oder Luft-Malz.
Das erste wird in einer im Braͤuhause dazu erbauten Darre, das zweite, was
jedoch selten in Anwendung kommt, an der Luft gedoͤrrt. In Augsburg wird zum
weißen und braunen Bier Darrmalz verwendet.
Den eigentlichen Karakter erhaͤlt das Bier durch die Gaͤhrung, deren es
zweierlei Arten giebt, naͤmlich die untere-
oder Bottichgaͤhrung, und die obere- oder Spundgaͤhrung. Alles Lager- oder Sommerbier, auch das meiste
Schenk- oder Winterbier, wird auf die untere Gaͤhr gebraͤut.
Doch wird manchmal und unter gewissen Umstaͤnden, das erste Winterbier auf
der obern Gaͤhr erzeugt. Das weiße Bier aber erhaͤlt
durchgaͤngig die obere Gaͤhr.
Die untere Gaͤhr geht in großen Bottichen vor sich, welche in den dazu
besonders erbauten Gaͤhrkellern stehen. Von der Kuͤhl kommt die
Wuͤrze in die Bottiche, und hier wird ihr das Ferment, naͤmlich der
Untergaͤhrzeug, gegeben. Die Bottiche duͤrfen nicht ganz, sondern nur
bis auf eine gewisse Hoͤhe, mit Wuͤrze angefuͤllt werden, damit
nichts, was waͤhrend der Gaͤhrung in die Hoͤhe steigt,
uͤberlaufe. Was die Gaͤhrung aufwirft, muß wieder durch das Bier
fallen und sich zu Boden sezen. Wenn das Bier sich gehoͤrig gesezt hat und so
klar erscheint, daß es abgezogen werden kann, dann findet sich unten die Bodenhefe,
und diese ist eigentlich das Ferment, wodurch die Untergaͤhr hervorgebracht
wird. An einem guten Ferment ist dem sorgfaͤltigen Bierbraͤuer sehr
viel gelegen.
Sind die Gaͤhrkeller gut eingerichtet und ist sonst alles in Ordnung, so geht
der ganze Untergaͤhrungs-Prozeß in vier, hoͤchstens in
fuͤnf Tagen voruͤber. Er erfordert eine Temperatur von 10–11
Grad Reaumur. Schon daraus ist zu ersehen, daß die Jage des Gaͤhrkellers in
einem Braͤuhause nichts gleichguͤltiges ist; denn nur unter gewissen
Umstaͤnden kann demselben die gehoͤrige Temperatur gegeben werden. Ist
das Bier in den Bottichen abgeklaͤrt, so kommt es in die Faͤsser, und
hier entsteht abermals eine, wiewohl unmerkliche Gaͤhrung. Das Lagerbier
kommt sogleich in die Sommerkeller, wo es bis zur Zeit des Ausschenkens oder des
Abgebens an die Wirthe aufbewahrt wird. Kann man im Gaͤhrkeller die
gehoͤrige Temperatur nicht mehr haben, und wird die Witterung zu warm, so
laͤßt sich kein Lagerbier mehr bereitenNur auf der obern Gaͤhr ist es moͤglich das ganze Jahr hindurch
Bier zu braͤuen. Es ist aber erwiesen, daß auf der obern Gaͤhr
kein so nahrhaftes, reines Bier erhalten werde, wie auf der untern, und
daher wird die leztere Braͤumethode immer den Vorzug behalten. Herr
Serviere sagt in seinem Werke uͤber Bierbraͤuerei, daß seine
Methode den Vortheil gewaͤhre, das ganze Jahr hindurch im Sommer und
Winter, ein Bier zu braͤuen, welches spaͤtestens in 8 Tagen
trinkbar ist, und ohne Faß und Keller mit einer Ersparniß von mehr als 30
proCent erhalten, und dem Abnehmer in brauchbaren Zustand geliefert werden
koͤnne. Zur Ersparung der Faͤsser schlaͤgt er kupferne
Erhaltungs-Zylinder vor, welche in Eißgruben stehen und um mit Eiß
umgeben seyn sollen. Wird sich aber im Sommer dieses Bier mehrere Stunden
weit zu den Zapfenwirthen verfahren lassen? Wird es nicht, sobald es aus dem
Eiskeller kommt und wieder der atmosphaͤrischen Luft ausgesezt ist,
schlechter und sauer werden? Das Augsburger Bier wird 10 bis 15 Stunden weit
gefahren, und doch bleibt es glaͤnzend hell und vollkommen gut. Dies
ist wohl ein Beweiß von der eigenthuͤmlichen Guͤte des
Biers.. Die Bierbrauer berechnen bei jedem Sud Lagerbier die Zeit, wann das Bier ausgeschenkt werden
soll, und richten die Qualitaͤt desselben darnach ein. Das Bier, welches in
den lezten Monaten des Jahrs ausgeschenkt werden soll, muß natuͤrlich
staͤrker eingebraͤut werden, als dasjenige, welches fruͤher
getrunken wird.
Die obere- oder Spundgaͤhr gehet in den Faͤssern, in welchen das
Bier bleiben soll, vor. Dieser Gaͤhrungs-Prozeß vertraͤgt eine
groͤßere Waͤrme, und daher kann auch im Sommer auf diese Art
gebraͤut werden. Wenn das weiße Bier von der Kuͤhl in die
Faͤsser gefuͤllt ist, wird der Gaͤhrzeug gegeben. Alles, was
die Gaͤhrung aufwirft, treibt oben zum Spundloch des Fasses heraus, und diese
Hefe giebt wieder den Obergaͤhrzeug. Die obere Gaͤhrung ist in 24
Stunden vollendet, und das Bier kann in einigen Tagen nach dem Sieden verbraucht
werden. Braͤut man auch braunes Bier auf die obere Gaͤhr, (was jedoch
sehr selten geschieht), so wird es nicht so stark gemalzt und gehopft, als
Lagerbier, welches erst spaͤter ausgeschenkt wird. Aber man hat aus
Erfahrung, daß wenn man gleiche Quantitaͤt und Qualitaͤt Malz und
Hopfen nimmt, dennoch das Bier auf der untern Gaͤhr staͤrker und
nahrhafter werde, als das auf der obern. Dies kommt daher, weil die obere
Gaͤhr, als nicht vollendet angesehen werden kann. Bei der untern Gaͤhr
muß, wie gesagt, alles was der Gaͤhrzeug aufgeworfen hat, wieder durch das
Bier fallen und sich zu Boden sezen, wodurch die Gaͤhrung erst vollendet
wird, und dann steht das Bier hell und klar auf dem Bodensaz.
Den Gaͤhrungs-Prozeß hat man genau und sorgfaͤltig zu
beobachten; denn davon haͤngt das meiste ab, was zur Fabrikation eines
gesunden und nahrhaften Biers beitraͤgt.
Man hat schon oft und nicht ohne Grund behauptet, daß die Guͤte des Augsburger
Biers, von der Beschaffenheit des Wassers, welches zum Braͤuen genommen wird,
herruͤhre. Die
Untersuchung des Wassers nach seinen Bestandtheilen, gehoͤrt in das Gebiet
der Chemie, und ich bemerke hier nur, daß die Quellen des hiesigen
Roͤhrenwassers in einer Ebene des Lechthals entspringen, daß dieses Wasser in
einem offenen Kanal 3 bis 4 Stunden weit zur Stadt geleitet, dann durch hydraulische
Werke gehoben und so in die Brunnen der Stadt vertheilt wird. Es hat aber die
Erfahrung gelehrt, daß Wasser, welches lange in Roͤhren laͤuft, den
Braͤuereien zutraͤglich ist. Man kann mit Recht behaupten, daß die
Augsburger Braͤuereien vorzuͤglich gutes Wasser zu ihren
Geschaͤften haben, und daß sie auch in hinreichender Menge damit versehen
werden koͤnnen.
In den Staͤdten ist mehrentheils der Raum der Braͤuhaͤuser
beschraͤnkt, oder doch wenigstens nicht so ausgedehnt als zu wuͤnschen
waͤre. Nicht selten stehen auch andere Gebaͤude in der Naͤhe,
welche den Braͤugeschaͤften eben nicht sehr vortheilhaft sind. Dies
ist auch in Augsburg der Fall; man konnte hier selbst die groͤßten
Braͤuhaͤuser nicht immer nach Willkuͤhr und nach strengen
Regeln anlegen. Daher weichen die innern Einrichtungen der hiesigen
Braͤuhaͤuser sehr von einander ab; und findet sich kein ganz
vollkommnes unter ihnen; so ist bald der innere Raum, bald die zu nahe Umgebung
daran Schuld. Indessen wird man auch wahrnehmen, daß das eins in dieser, das andere
in jener Ruͤcksicht etwas vortheilhaftes und nachahmungswuͤrdiges hat.
Vereiniget der Baumeister diese einzelnen Vorzuͤge bei ganz freiem Bauplaze
und unter sonst guͤnstigen Umstaͤnden mit einander, so wird er ein
vollkommenes Werk dieser Art herstellen.
Da ich dem Leser, in einer kurzen Beschreibung, einen Begriff des Augsburger
Bierwesens geben will, so ist es nothwendig, daß ich ihn mit den besten
Braͤuhaͤusern, und mit allem, was zur Braͤuerei gehoͤrt,
bekannt mache.
Das erste, worauf man bei einer Braͤuerei zu sehen hat, ist der Weichkasten (Quellbottich) und was sonst noch damit in Verbindung
steht.
Ich werde demnach einen der vorzuͤglichsten Weichkaͤsten, die ich in
den hiesigen Braͤuereien gesehen habe, naͤher beschreiben; es
gehoͤrt dazu die Zeichnung Fig. A
B und C Tab. XX. mit Grund-Aufriß und Durchschnitt.
Dieser Weichkasten hat, wie Fig. A im Grundriß zeigt, ein ablanges Viereck; er ist 13' im Licht
lang, 7 dergl. breit, und 4' 11'' hoch. Der Boden besteht aus einem einzigen
Stuͤck, und eben so jede Seitenwandung. Die Seitenwaͤnde sind in den
Ecken mit sich selbst, und mit dem Boden uͤberfalzt. Wenn man diese
Stuͤcke mit gutem Kitt zusammenfuͤgt, so wird der Boden vollkommen
wasserdicht. Der Boden hat eine Dicke von 6 Zoll; die Seitenwaͤnde halten 4
1/2 Zoll. Solche Steinplatten erhaͤlt man von vorzuͤglicher
Guͤte und hinlaͤnglicher Groͤße aus Eichstaͤtt. Auch die
Steinbruͤche bei Fuͤssen liefern dergleichen Weichkaͤsten nach
Augsburg. Ich muß hiebei bemerken, daß die Steinplatten, wenn man sie nicht so groß
bekommen kann, zusammengesezt, und mit eisernen Klammern verbunden werden
koͤnnen. Wird die Bodenplatte aus zwei oder drei Stuͤcken gemacht, so
darf der Kasten nicht auf einer blosen Unterlage stehen, sondern der ganze Boden muß
untermauert werden. Warum aber ein solcher Kasten hoͤher gestellt werden
soll, wird sich in der Folge zeigen.
Der Weichkasten, von dem hier die Rede ist, hat das Eigenthuͤmliche, daß er in
einer gemauerten und gewoͤlbten Nische steht. Dadurch wird er mehr gegen das
Eindringen der Kaͤlte geschuͤzt, als wenn er ganz frei stuͤnde,
ein Umstand, der in jeder gut eingerichteten Braͤuerei beabsichtiget werden
sollte. Die Fensteroͤffnung Lit. a wird mit einem
doppelten Fenster versehen, welches hinlaͤnglich gegen Kaͤlte
schuͤzt und dem Weichkasten das benoͤthigte Licht zulaͤßt.
Jeder Weichkasten sollte
wie dieser, unmittelbar auf dem Malzboden oder der Keimtenne stehen, und mittelst
einer Roͤhrenleitung nach Aufdrehung eines Hahnen Lit. b mit Wasser gefuͤllt werden koͤnnen; denn es ist
noͤthig, der einzuquellenden Gerste oͤfters frisches Wasser zu geben.
Auch muß die Weiche so hoch stehen, damit das Wasser wieder abgeleitet werden kann.
Im vorliegenden Fall ist die Ableitungs-Roͤhre bei Lit. c angebracht. Dieser Weichkasten hat noch eine
Vorrichtung, durch welche die gequollne Gerste leicht auf den Keimplaz gebracht
wird. Bei Lit. d im Grundriß, so wie im Aufriß und
Durchschnitt, ist in dem Boden des Kastens eine 6 Zoll im Quadrat haltende Oeffnung
zu sehen. Diese Oeffnung kann man nach Willkuͤhr schließen und oͤffnen
mittelst des Zapfens Lit. e
Fig. B
und C, welcher bei Fig. D etwas groͤßer abgebildet ist.
Der Zapfen oder die Stange selbst ist von hartem Holz und hat oben bei f
Fig. D
einen eisernen Ring. Unten ist der viereckige, abwaͤrts etwas
zugespizte hoͤlzerne Pfropf Lit. g befestigt,
welcher mit einer eisernen, scharf gearbeiteten Umfassung versehen ist. Auch die
Oeffnung durch die steinerne Bodenplatte hat ein eisernes Futter, in welches der
Pfropf genau paßt. Der Stiel e geht durch den Pfropf g und hat unten eine eiserne Schraube, wodurch beide
fest zusammengehalten werden. Wenn der Weichkasten leer ist, wird der Pfropf mit dem
Stiel fest in die Oeffnung gedruͤckt, so daß der Pfropf kein Wasser
durchlaͤßt. Nun kann der Kasten mit Gerste und Wasser gefuͤllt werden.
Ist die Gerste genug geweicht, so wird das Wasser durch die Roͤhre c abgeleitet. Soll der Zapfen gezogen werden, so steckt
man durch den Ring f einen Hebel, der mit dem einen Ende
eine Auflage auf der hintern Kastenwand hat, und mit diesem zieht man den Pfropf aus
der Oeffnung der Bodenplatte. Hierauf rinnt die gequollne Gerste aus dem Kasten,
dann auf der schiefen Flaͤche hi auf den
Keimplaz, und von hier
kann sie verbreitet werden. Man wird nun leicht einsehen, warum der Kasten 2 Fuß vom
Boden des Malzplazes erhoͤht seyn muß.
Durch die bisher beschriebene Verrichtung wird bei einer großen Braͤuerei viel
Zeit und Arbeit erspart, was bei einem solchen Geschaͤfte keine Kleinigkeit
ist. Es muß aber auch die einzuweichende Gerste ohne große Muͤhe und
Zeitverlust in den Weichkasten gebracht werden koͤnnen. Gewoͤhnlich
wird die Gerste auf dem Boden unter dem Dache aufbewahrt. Von diesem Gerstenboden
geht in unserm Braͤuhause eine Rinne in den Weichkasten, wie bei Lit. k
Fig. A
B und C zu sehen ist. In den Weichkasten muß eine gewisse Quantitaͤt Gerste
eingemessen werden. Um dieses Einmessen zu erleichtern, ist auf dem Gerstenboden
eine Gosse angebracht, welche so viel Gerste faßt, als eingeweicht werden soll.
Diese Gosse zeigt Lit. E. Bei Lit. a befindet sich ein Schieber; dieser wird geschlossen
und dann die Gerste eingebracht. Ist das Maas mit Gerste erfuͤllt, so wird
der Schieber heraus genommen und die Frucht rinnt nach und nach in den Weichkasten.
Bei Fig. F ist der Schieber a etwas groͤßer vorgestellt und man kann hier sehen, daß er sich in
einer Nuth bewegt. Wenn die Gosse abgelaufen ist, kann der Schieber wieder
geschlossen werden.
Ich komme nun zum Keimplaz, auf dem die gequollne Gerste zum Keimen gebracht wird,
und will die Beschaffenheit desselben naͤher beschreiben.
Es ist sehr gut, wenn der Keimplaz etwa 5 Fuß tief in den Boden kommen kann, weil er
dann diejenige Temperatur erhaͤlt, welche den Wurzelkeim hervorlockt. Es
gehen hier von zwei Seiten Oeffnungen nach außen, und diese koͤnnen mit
Fenstern und Laͤden verwahrt werden. Der Boden wird entweder gepflastert oder
erhaͤlt einen Aestrich. Im gegenwaͤrtigen Fall ist es mit gebrannten
rothen Steinen, welche 1 1/2 Fuß im Quadrat groß sind, belegt.
Die ausgebreitete Gerste soll ein gleiches Wachsthum erhalten, und daher thut man
wohl, wenn man unter dem Pflaster eine Schichte von gleicher, aber trockner Erde
anbringt; am besten aber nimmt man dazu klein gestoßenen Mauerschutt. Da der
Keim-Plaz in der Erde seyn muß, so koͤnnen nur kleine Fenster, wie in
einem Keller, angebracht werden, und diese entsprechen dem Zweck besser als große,
welche zu viel Kaͤlte durchlassen wuͤrden. Es ist gut, wenn der
Keimplaz gewoͤlbt wird, aber es ist nicht durchaus nothwendig. Uebrigens soll
man darauf sehen, daß weder von unten auf, noch von der Seite Wasser eindringen
koͤnne, und daß die Waͤnde nicht feucht seyen. Daß ein solcher Plaz
groß genug und dem Umfange der ganzen Braͤuerei angemessen seyn
muͤsse, versteht sich von selbst. Die Hoͤhe desselben kann 8 bis 9 Fuß
betragen, und dann kann man noch, wenn sich der Welkboden gerade uͤber dem
Keimplaz befindet, die gekeimte Gerste mit Schaufeln dahin werfen. Ist aber die
Hoͤhe zu groß, so wird die Gerste in Koͤrben auf denselben gezogen,
was hier der Fall ist. Bei Fig. A ist Lit. l die Oeffnung dazu in
der Decke.
Zum Aufziehen der gekeimten Gerste auf den Welkboden, ist leicht eine Vorkehrung zu
treffen. Man kann entweder nur einen, oder zwei Koͤrbe dazu anwenden, wovon
der eine aufsteigt, der andere niedersinkt. Auch kann man leicht eine solche
Einrichtung machen, daß zu dem ganzen Geschaͤft eine einzige Person, welche
den Korb fuͤllt, aufzieht und oben ausleert, hinlaͤnglich ist.
Es wuͤrde mich zu weit fuͤhren alle die Maschinerien zu beschreiben,
welche in den hiesigen Braͤuhaͤusern vorkommen; und ich
uͤbergehe sie um so eher mit Stillschweigen, da es nicht Sache des
Baumeisters ist, sie anzuordnen.
Auf der Schwelk oder dem Welkboden trocknet die gekeimte Gerste wieder ab. Dieser Plaz muß
vorzuͤglich trocken seyn, und daher liegt er in allen den hiesigen
Braͤuhaͤusern, die ich bisher gesehen habe, in der Hoͤhe. Wo es
seyn kann, giebt man dem Welkboden von zwei Seiten Oeffnung, damit die Luft
uͤber das ausgebreitete Malz streiche. Um die aufsteigenden
waͤsserigen Theile abzufuͤhren, haben hier manche Welkboͤden
Oeffnungen unmittelbar unter der Decke. Der Fußboden eines solchen Plazes wird
entweder mit Steinen gepflastert, oder bekommt einen Aestrich. Solenhofer Steine
sind nicht so gut, weil diese bei feuchter Witterung Naͤsse an sich ziehen
und dadurch das Trocknen des Malzes erschweren.
Die Darre ist eines der wichtigsten Stuͤcke bei
einer Braͤuerei, und sie verdient um so mehr die Aufmerksamkeit des
Technikers, weil man in Ansehung der Konstruction derselben noch nicht allgemein
einverstanden ist.
Viele behaupten, der durch die Darre gehende Rauch sey dem Malz nachtheilig; andere
erfahrne Bierbraͤuer aber glauben, daß der Rauch Theile mit sich
fuͤhre, die auf die Koͤrner wirken und eine Gaͤhrung abhalten,
wie etwa der Rauch das Fleisch gegen Faͤulniß schuͤze. Daher werden
die Malzdarren auf verschiedene Art construirt. Es giebt solche, welche den Rauch
abhalten, und wieder andere, welche ihn durch das aufgeschuͤttete Malz
lassen. Die Bauart der leztern ist ebenfalls verschieden; denn es hat entweder die
Waͤrme und der Rauch eine gewisse Zirkulation in Kanaͤlen, um den
Boden der Darre gleichheitlich, das heißt auf allen Punkten gleich warm zu machen;
oder es steigt die Waͤrme in der Mitte herauf und vertheilt sich links und
rechts in gemauerte Kanaͤle. Manche Darren stehen blos in Kammern, und in
diesen verbreitet sich der Dampf und Rauch. Fuͤr den Abzug ist ein
Dampf- und Rauchschloth in der Decke angebracht; auch koͤnnen die
Fenster geoͤffnet werden. Noch eine andere Art von Darre hat keine
Gaͤnge auf den Seiten, sondern ist mit Mauern eingeschlossen und gewoͤlbt.
Den Dampf und Rauch abzuleiten, dient ein großer Schloth im Gewoͤlbe mit
einem Schieber. Um Zugluft zu erregen, muß eine solche Darre gegen die Aussenseite
Fenster haben, welche willkuͤhrlich geoͤffnet werden
koͤnnen.
Bei Fig. G
und H ist eine Darre abgebildet, welche sich hier in einem der groͤßten
Braͤuhaͤuser befindet und sehr gute Dienste leistet. Sie steht in
einer Kammer, hat bei Lit. a Fenster nach aussen, und
gerade ober dem Darrofen einen Schloth zur Abziehung des Rauches und der
Daͤmpfe. Die Laͤnge des Darrofens betraͤgt 26 Fuß und die
Breite 10. Vom Boden des Welkplazes ist sie 4 1/2 Fuß erhoͤht. Sie wird von
unten durch den Feuerschlund Lit. b
Fig. H geheizt, welcher die Hize bei Lit. c Lit. G in den Kanal, die
Sau genannt, ausstroͤmt, wodurch sie sich unter dem Boden der Darre
verbreitet. In dem Durchschnitt Fig. H ist die Gestalt der sogenannten Sau zu sehen. Sie besteht aus
dem Kanal Lit. d, welcher 1 Fuß hoch und 1' 10'' breit
ist, und dessen Seitenwaͤnde entweder von aufgestellten Steinen gemauert,
oder aus besondern vom Toͤpfer dazu geformten Kacheln zusammengesezt sind.
Bei den Buchstaben ee etc. gehen 4 Zoll weite 1
Fuß hohe Oeffnungen, welche einen Fuß weit aus einander sind, durch die aus
Backsteinen oder aus Kacheln bestehende Kanal-Wand. Den Kanal Lit. dd deckt, wie der Durchschnitt zeigt, ein spiziges
Dach, welches aus Dachziegeln, oder auch aus Toͤpfer-Kacheln gebildet
ist. Dieses Dach hat auf beiden Seiten, so wie die Seitenwaͤnde 4 Zoll
breite, einen Fuß aus einander stehende Schlizen. Von dem Kanal c gehet die Hize in die Kanaͤle ff, deren Waͤnde eben so
durchloͤchert, gemauert, oder aus Kacheln zusammengesezt sind. Die Oeffnungen
der Kanalwaͤnde duͤrfen nicht einander gegenuͤber stehen,
sondern muͤssen gegen einander abwechseln. Auf die Kanaͤle ff etc. wird wieder eine durchbrochene, einen Fuß hohe Wand,
drei Zoll dick, von Baksteinen aufgemauert, oder von Kacheln zusammengefuͤgt,
wodurch gleichsam zwei Stokwerke, naͤmlich f und
g, entstehen. Von den aͤußersten
Kanalwaͤnden Lit. l wird uͤber die drei
Kanaͤle ein spiziges Dach lml gesezt,
welches immer zwei Fuß von einander, 6 Zoll weite Oeffnungen in der Form
gewoͤhnlicher Dachlucken hat. Dieses Dach besteht entweder aus Dachziegeln
oder Kacheln, zu deren Befestigung eiserne Schienen wie Dachsparn aufgestellt
werden. Damit aber der ganze Darrofen geschlossen werde, so fuͤhrt man die
halbschuhigen Mauern n. o. p. q., so hoch, als es
noͤthig ist, auf.
Um die aͤussern langen Umfassungs-Mauern des Darrofens Lit. xy zu verbinden und zu befestigen, und um den
Ruͤcken der Darre aufsezen zu koͤnnen, werden die starken eisernen
Schienen rs aufgelegt. Die ganze Laͤnge des
Darrofens betraͤgt 26 Fuß, und auf diese Laͤnge sind 5 dergleichen
Schienen noͤthig. Auf die vier Umfassungs-Mauern nopq wird ein hoͤlzernes, auf den Ecken
uͤbereinander geplattetes Geschaͤl gelegt, und an dieses werden auf
beiden Seiten bei Lit. u, die 5 eisernen Schienen mit
Schrauben und Naͤgeln befestigt. Nun richtet man die eisernen Schienen rt und st auf,
und befestiget auf sie das durchloͤcherte Eisenblech, welches die Darre
bildet. Um zu verhindern, daß Malz auf den Boden oder uͤber die Darre falle,
biegt man das Eisenblech an den vier Seiten auf, und macht es an der Wange des
hoͤlzernen Geschaͤls fest, die Loͤcher, welche durch das Blech
der Darre geschlagen werden, duͤrfen nicht so groß seyn, daß Koͤrner
durchfallen koͤnnen. Auf diese Art ist die ganze Darre hergestellt.
Manche Darre hat keinen Ruͤcken rts wie die
vorliegende, sondern das Blech geht horizontal nach der Linie rs. Man hat aber bemerkt, daß dann die Hize in der
Mitte uͤbermaͤßig wird, und daß das Malz ungleich doͤrrt, weil die
Mitte zu nahe an der Spize der sogenannten Sau liegt. Daher macht man die obere
Dachung rt beinahe mit der Dachung der Sau
parallel, und so kann man ein gleich gedoͤrrtes Malz erhalten.
Ich habe in Augsburg auch Malzdarren gesehen, welche auf das bloße Gebaͤlk
gesezt waren, und nur ein doppeltes Pflaster hatten. Dieß ist
Feuergefaͤhrlich und sollte von der Polizei nicht geduldet werden.
Manche wollen die Sache dadurch verbessern, daß sie auf das Gebaͤlk eine Lage
grobes Kies schuͤtten und dann erst ein Pflaster legen. Auch dieses
schuͤzt nicht genug vor Gefahr, und es ist immer besser, wenn das
Gebaͤlk ganz ausgewechselt, und die Darre auf ein festes, feuersicheres
Gewoͤlbe gesezt wird.
Jede Darre bedarf einer besondern Thuͤr zur sogenannten Sau, damit man sie,
weil sich viel Ruß ansezt, von Zeit zu Zeit reinigen kann. Alles Mauerwerk einer
Darre sollte, wie alle Feuerwerke uͤberhaupt, nicht mit Kalk, sondern mit
Lehmmoͤrtel hergestellt werden.
Man findet hie und da Darren von Kupferblech. Dieses ist zwar theurer, aber auch viel
dauerhafter als Eisenblech. Es fragt sich jedoch, ob es nicht der Gesundheit
nachtheilig ist, weil hier viel Wasser von der Hize zersezt wird. –
Stehet ein Darrofen in einer Kammer, so kann sich darin der Dampf und Rauch
ausdehnen; und zieht der Schloth, der durch die Deke geht, gut, so sezen sich keine
Tropfen an derselben an. Wird die Darre in ein Gewoͤlb eingeschlossen, so
wird die Waͤrme sehr zusammen gehalten, was an sich gut ist; wenn dann aber
nicht genug Oeffnungen nach aussen vorhanden sind, von denen man zur rechten Zeit
Gebrauch machen kann, und wenn der Dampfschloth nicht gehoͤrig zieht, so
sezen sich Tropfen am Gewoͤlbe an, welche wieder in die Darre fallen und das Malz
verunreinigen. Will man also den Raum uͤber dem Darrofen
uͤberwoͤlben, so muß man fuͤr hinreichende Hoͤhe
uͤber dem Darrofen sorgen, und so viele Zugloͤcher anbringen, als
erforderlich sind.
Wenn eine Darre einen Kanal erhalten soll, in welchem die Waͤrme zirkulirt, so
geht der von unten aufsteigende Feuerschlund in eine Ecke des Darrofens. Der Kanal
wird so gerichtet, daß er zuerst aussen herum an den Waͤnden und dann nach
der Mitte sich zieht. Auch dieser Kanal bekommt ein spiziges, aus Dachziegeln oder
Kacheln bestehendes Dach, und den Waͤnden des Kanals giebt man, so wie dem
Dache, Schlizoͤffnungen. Man muß aber in den Feuerlaͤufen die
Oeffnungen anfangs sparsam und zulezt haͤufiger und von groͤßerer
Weite anbringen; dadurch wird eine Zirkulation der Luft erregt, und die Hize
vertheilt sich gleich unter der Darrflaͤche. Bei einer solchen Einrichtung
ist es moͤglich dem Darrofen eine horizontale Flaͤche zu geben.
Auf dem Lande trift man viele Darren an, welche nicht aus Blech, sondern aus
thoͤnernen Kacheln bestehen.
Es ist noch nicht ausgemacht, welche Art der bekannten Darroͤfen die beste
ist, welche am sichersten und zugleich am schnellsten abtrocknet und abdarrt. Ueber
diesen wichtigen Gegenstand sollten noch vergleichende Versuche angestellt
werden.
In den Augsburger Braͤuhaͤusern findet man zum Theil Braͤukessel; in den groͤßern aber meistens
Pfannen. Die lezten verdienen wohl den Vorzug. Die
erste Eigenschaft einer Braͤupfanne ist, daß sie moͤglichst bald zum
Sieden gebracht werden kann; denn in einer Braͤuerei ist Zeitverlust der
groͤßte Verlust. Die zweite Eigenschaft kann die seyn, daß man eine Pfanne
mit dem wenigsten Brennmateriale zu erhizen im Stande ist.
Ueber die Ersparung des Holzes bei Braukesseln und Pfannen wurden schon sehr viele
Versuche angestellt, wovon auch mehrere zur Anwendung kamen. Wenn das Einmauern der
Braͤupfannen zwar Holz erspart, aber eine laͤngere Zeit noͤthig
hat, um zum Sieden zu kommen; oder wenn dadurch das Kupfer zu sehr leidet, und die
Pfanne vor der Zeit zu Grunde geht, so ist jenes Einmauern unlaͤugbar zu
verwerfen. –
Bei Fig. I und K ist eine eingemauerte Pfanne eines großen Augsburger Braͤuhauses
vorgestellt. Lit. a ist das Aschenloch und Lit. b das Schierloch. Bei cc sieht man den Rost auf den das Holz gelegt wird. In den Ecken sind
Pfeiler worauf die Pfanne ruht. Durch die Zuͤge ef wird die Spielung des Feuers um die Pfanne hervorgebracht. Die ganze
Pfanne steht im Feuer und erhizt sich bald. Sie wird von aussen in der Schiergrube,
welche drei Fuß tief im Boden liegt, gefeuert.
Ueber der Pfanne ist ein Dampfschloth mit einem Mantel angebracht, welcher die
Duͤnste abfuͤhrt. Der Deckel zur Pfanne haͤngt an einer
Flasche, und kann leicht weggenommen und wieder auf den Kessel gesezt werden.
Die Kuͤhl soll vom Sudhaus entfernt seyn;In den großen Londner Braͤuereien befinden sich die ungeheuern
Kuͤhlschiffe im obern Theil der Braͤuhaͤuser, und auf
diese wird das Bier aus den Gaͤhrkellern durch eigene Maschinen
gehoben. Daß ein so erhoͤhter Plaz zum Abkuͤhlen des Biers
sehr vortheilhaft sey, ist außer allem Zweifel, und diese Art verdient
nachgeahmt zu werden, wiewohl Deutschland nie eine so große Braͤuerei
haben wird, wie England. da aber, wie ich schon fruͤher bemerkte, die
Braͤuhaͤuser in den Staͤdten ruͤcksichtlich des Raumes
sehr beschraͤnkt sind, so trift man auch in Augsburg die Kuͤhle
mehrentheils im Sudhause selbst an. Der beschraͤnkte Raum ist zugleich
Ursache, daß man der
Kuͤhl keine solche Ausdehnung geben kann, als erforderlich ist zum
Abkuͤhlen des Biers, ohne dasselbe zu ruͤhren. Man trift sogar zwei
Kuͤhlen uͤbereinander an. Großentheils wird von Hand, das heißt, ohne
Maschine abgekuͤhlt. In vielen Braͤuhaͤusern aber braucht man
Maschinen zum Abkuͤhlen, die sich entweder im Kreise umherbewegen, oder die
Ruͤhrkruken hin und her schieben. Mehrentheils steht dabei das Bier 8 Zoll
hoch im Kuͤhlschiff.
Viele Baumeister behaupten, daß es besser sey, wenn das Bier geruͤhrt werde,
als wenn es still stehend abkuͤhlen muͤsse.
Die Gaͤhrkammer ist in einer Braͤuerei von
der groͤßten Wichtigkeit; denn von einer vollkommenen Gaͤhrung des
Biers haͤngt sehr viel ab. Einer der besten Gaͤhrkeller, welche ich in
Augsburg gesehen habe, liegt 5 Fuß tief in der Erde und ist gewoͤlbt. Dabei
hat er eine solche Hoͤhe, naͤmlich 9 Fuß, daß noch 3 Fuß Raum
uͤber den Gaͤhrgeschirren bleibt. Auf einer Seite befinden sich
Fenster von 4 Fuß Breite und 3' Hoͤhe. Mit der einen Seite stoͤßt er
an das Sudhaus und unmittelbar an die Kuͤhl. Der Fußboden ist mit großen
gehauenen Schalen belegt, und um das Pflaster abschwemmen zu koͤnnen, hat der
Keller ein Abzugsdohl.
Dieses hier Gesagte wird das Wesentlichste uͤber die wichtigsten Theile eines
Braͤuhauses seyn. Die Construction und Eigenschaften dieser einzelnen Theile
muß ein Baumeister nothwendig kennen; will er aber etwas Vollkommenes herstellen, so
muß er sich mit den Geschaͤften, welche in einem Braͤuhause betrieben
werden, mit dem ganzen Haushalt einer Braͤuerei genau bekannt und vertraut
machen; denn bloße Mittheilungen der Ansichten, welche die Bierbraͤuer haben,
bloße Geschaͤftserzaͤhlungen derselben geben dem Architekten noch
keinen reinen Begrif zur Anlegung und Ausfuͤhrung eines so wichtigen
Bauwerkes. Der Baumeister soll auch hier mit eigenen Augen sehen, und nach eigenen richtigen
Grundsaͤzen handeln.
Die groͤßten Vortheile bei einer Braͤuerei entstehen dadurch, wenn
jedes Stuͤck an seiner gehoͤrigen Stelle ist; wenn eines in das andere
eingreift, so daß man Arbeiter und Zeit erspart; wenn der Keim- und
Welkboden, Kuͤhl- und Gaͤhrkeller so eingerichtet, und die
aͤußern und innern Verhaͤltnisse dazu so ausgemittelt sind, daß der
Bereitung des Malzes, dem Sudwerk, dem Abkuͤhlen, dem chemischen Prozeß der
Gaͤhrung u.s.w. keine aͤußere Einwirkung schadet, und im Innern keine
Zeit unnoͤthig verschwendet wird; und wenn endlich Darre und Pfanne mit dem
geringsten Aufwand von Brennmateriale, und ohne Nachtheil fuͤr die
Gefaͤße und das Fabrikat, gefeuert werden koͤnnen. Dieß alles
zweckmaͤßig anzuordnen ist die schwierige Aufgabe fuͤr den
Architekten. Da der Baumeister, welchem die Aufgabe gemacht wird, ein
Braͤuhaus zu bauen, von allen Geschaͤften, welche bei einer
Braͤuerei vorkommen, gruͤndlich unterrichtet seyn muß, so sehe ich
mich veranlaßt hier eine kurze Uebersicht dieser Geschaͤfte zu geben. Ich
entlehne diese Beschreibung auszugsweise aus meinem Handbuche landwirthschaftlicher
Baukunst, in welchem ich das noͤthigste abgehandelt habe, was ein Architekt
vom Braͤuwesen zu wissen bedarf.Handbuch der landwirthschaftlichen Baukunst in zwei Theilen mit 22 lith.
Zeichnungen, 1817 im Verlag der lithographischen Kunstanstalt bei der
Feiertags-Schule in Muͤnchen. Ladenp. 5 fl.
Kurze Uebersicht der Geschaͤfte, welche beim Bierbraͤuen vorkommen.
Man erwarte hier keine vollstaͤndige Anweisung zur Bierbraͤuerei,
sondern nur eine kurze Uebersicht der Geschaͤfte wie sie nach einander
betrieben werden. Dadurch schon wird, wie ich glaube, der Baumeister in den Stand gesezt, bei
Anlegung eines solchen Gebaͤudes, seine Anordnungen so zu treffen, daß die
Geschaͤfte des Braͤuwesens mit dem wenigsten Zeitverlust und ohne
Stoͤrung und Unterbrechung verrichtet werden koͤnnen. Ein guter
Bierbraͤuer hat freilich weit mehr zu wissen noͤthig; ja er sollte
hoͤhere Hilfswissenschaften und chemische Kenntnisse besizen, um fuͤr
die vorkommenden Operationen den erforderlichen Grad der Waͤrme, der
Gaͤhrung u.s.w. mit Bestimmtheit angeben zu koͤnnen.
Gewoͤhnlich wird das Geschaͤft des Bierbraͤuers blos
abgerichteten Leuten anvertraut. Ist einmal das Braͤuwerk gut eingerichtet,
so wird, wenn nicht neue Hindernisse eintreten, selten ein Sud mißlingen, oder
umschlagen. Aber man hat Beispiele, daß in einem Braͤuhause vollkommen gutes
Bier gesotten werden konnte; als man aber einige Veraͤnderungen mit demselben
vornahm, war man nicht mehr im Stande, dem Getraͤnke die gehoͤrige
Feinheit und den vorigen guten Geschmack zu geben. Solche Fehler zu verbessern oder
zu vermeiden ist Sache des wissenschaftlichen Bierbraͤuers, oder vielmehr des
Chemikers, so wie uͤberhaupt das ganze Braͤuwesen auf
Grundsaͤzen dieser Wissenschaft beruht.
Hat ein Baumeister sein Gebaͤude so angelegt, daß alle Gefaͤße am
rechten Plaze stehen; daß jeder Raum, der zu gewissen Verrichtungen bestimmt ist,
die schikliche Lage hat, daß der Bierbraͤuer durch das Gebaͤude selbst
nicht gehindert wird vollkommen gutes Bier zu brauen, so hat er seinen Zweck
erreicht. Durch folgende Auseinandersezung der Geschaͤfte wird er hoffentlich
dazu vorbereitet werden.
Alle bei einer Braͤuerei vorkommende Geschaͤfte koͤnnen in die
Bereitung des Malzes, und in die des Sudwerks eingetheilt werden. Die erste
vorkommende Arbeit ist das Malzmachen (Mulzen). Dabei muß das Korn zum Keimen
gebracht werden, damit
sich der Zuckerstoff und ein naͤhrender Schleim in demselben entwikle und
auflokere, welcher sich dann in der Maischkufe und im Sieden dem Wasser mittheilt.
Jedem Gerstenkorn muß daher so viel Feuchtigkeit gegeben werden, als zur
Hervorbringung des Wurzelkeims erforderlich ist. Dieses Keimen muß aber zur rechten
Zeit unterbrochen werden koͤnnen, welches geschieht, indem die Feuchtigkeit
schnell entzogen wird.
Um die Koͤrner zum Keimen oder Wachsen vorzubereiten, ist es noͤthig,
daß sie im Wasser eingeweicht werden, wozu ein Quellbottich, oder ein Weichkasten
gehoͤrt. Dieses Weichen dauert 3 bis 4 Tage, und damit in dem Weichkasten
keine schaͤdliche Gaͤhrung entstehe, muß das Wasser oͤfters
abgelassen und frisches aufgegossen werden. Der Weichkasten soll daher nothwendig
zur ebenen Erde stehen; das Wasser muß durch Roͤhren oder Rinnen in denselben
geleitet, und das gebrauchte Wasser aus dem Gebaͤude ohne Schaden
abgefuͤhrt werden koͤnnen.
Es ist aber auch ungleich besser, wenn man den Weichkasten ins Souterrain bringen
kann. Nur muß man auch dann das gebrauchte Wasser abzuleiten im Stande seyn.
Hat die Gerste (welche Getreidart gewoͤhnlich zum Bier genommen wird) den zum
Keimen gehoͤrigen Grad Feuchtigkeit; so kommt sie auf die Keim- oder
Malz-Tenne, welche mit Steinen gepflastert seyn soll. Hier wird die Gerste
entweder in Haufen 2 Fuß hoch aufgeschuͤttet, oder man verbreitet sie
uͤber die ganze Flaͤche der Tenne, ohngefaͤhr 1 Fuß in der
Hoͤhe, welche leztere Art die gebraͤuchlichste ist.
Zum Keimen wird ein gewisser Grad Waͤrme erfordert, welcher genau beobachtet
werden muß. Die Oeffnungen auf der Malzdarre hat man daher mit Fenstern,
Laͤden und Thuͤren zu versehen, die man beliebig oͤffnen und
schließen kann. Vorzuͤglich gut aber ist es, wenn die Malztenne 4 bis 5 Fuß in den Boden
kommt, weil sie dadurch waͤrmer wird. Aus eben dieser Ursache soll sie auch
ein Gewoͤlbe haben. Der Weichkasten stehet auf der Keimtenne selbst, damit
die gequollne Gerste sogleich ohne Umstaͤnde auf denselben gebracht werden
kann. Hat sich der Wurzelkeim entwikelt, so ist dem weitern Wachsen Einhalt zu thun;
denn der Graskeim darf nicht hervorbrechen.
Die Gerste kommt daher auf den Welkboden, wo sie zum
Abtrocknen duͤnne ausgebreitet wird. Hier ist oͤfteres Umwenden
noͤthig. Von den nassen Koͤrnern steigen nun waͤsserige
Duͤnste in die Hoͤhe, welche durch angebrachte Zugoͤffnungen
vom Welkboden vertrieben werden muͤssen, wodurch das Geschaͤft sehr
erleichtert wird. Man muß daher dem Welkboden viele Zugoͤffnungen geben.
Wenn alle bei einer Braͤuerei vorkommende Geschaͤfte im untern
Stockwerk verrichtet werden koͤnnten, so waͤre das freilich sehr
bequem; aber das Gebaͤude wuͤrde dadurch sehr ausgedehnt, und die
Erbauungs- und Unterhaltungskosten vermehrt werden; auch verlangen manche
Braͤu-Geschaͤfte eine hoͤhere Lage. Dem Welkboden z.B.
muß in mancher Ruͤcksicht das zweite Stockwerk eingeraͤumt werden, und
dann laͤßt sich auch die Darre, welche ebenfalls hoch liegen kann, damit
verbinden. Hat das Malz etliche Tage auf dem Welkboden gelegen, so muß es
voͤllig getrocknet werden. Geschieht dieses Trocknen an der Luft, so
erhaͤlt man Luftmalz, wird es aber uͤber dem Feuer auf der sogenannten
Darre vorgenommen, so bekommt man Darrmalz, welches in unsern Gegenden am
gebraͤuchlichsten ist.
Die Darre gehoͤrt daher in die Naͤhe des
Welkbodens, damit das Malz ohne Umwege auf jene gebracht werden kann. Der Darrofen
muß so eingerichtet seyn, daß man im Stande ist, demselben einen beliebigen Grad
Waͤrme zu geben. Anfangs entwikeln sich bei diesem Geschaͤfte viele
Daͤmpfe, welche mittelst eines Dampfschlothes abgeleitet werden, damit sie
sich nicht an der Decke in Tropfen anhaͤngen, herabfallen, und das Malz
verunreinigen. Sowohl diese Dampfroͤhre, als auch die uͤbrigen
Zugoͤffnungen der Darre muͤssen beliebig geschlossen werden
koͤnnen, wodurch der Bierbraͤuer im Stande ist, nach dem ersten
Abdampfen des Malzes, die Waͤrme in einem gleichen Grade zusammen zu
halten.
Unter dem Boden der Darre, welche gewoͤhnlich und am zweckmaͤßigsten
aus Eisenblech besteht, wird die Hize dergestalt herum geleitet, daß sie den Boden
gleichmaͤßig erwaͤrmt. Zur Ersparung an Holz kann man auch eine solche
Einrichtung treffen, daß die Darre zum Theil durch das Kesselfeuer, welches sonst
ungenuͤzt in den Rauchfang steigt, erwaͤrmt wird. In den meisten
Braͤuhaͤusern ist die Darre so eingerichtet, daß der Rauch durch das
Malz geht, was zu einer schnellen Abtrocknung viel beitraͤgt. Ich habe
Braͤuhaͤuser kennen gelernt, welche aus dergleichen Malz das
schmackhafteste, reinste und klarste Bier bereiteten, und ich bin daher noch nicht
uͤberzeugt, daß es unbedingt nothwendig sey, den Rauch von dem Malz
abzuhalten. Inzwischen ist es ein Leichtes, dem Rauche den Durchgang durch das
aufgeschuͤttete Malz zu verwehren.
Ist das Malz gehoͤrig gedoͤrrt, so kommt es auf die Schuͤttboͤden, und somit ist die Bereitung
des Malzes vollendet.
Beim Sudwesen ist das Erste, daß man das Malz, ehe es auf
die Muͤhle zum Schroten kommt, einsprengt oder mit Wasser benezt. Zu diesem
Geschaͤfte sollte, wo moͤglich zur ebenen Erde, ein eigener mit
gebrannten oder auch mit Solenhofer Steinen gepflasterter Plaz vorhanden seyn. Von
dem Schuͤttboden muß die Gerste in Roͤhren auf den Einsprengplaz (Einspreng)
herunter gelassen werden koͤnnen, weil dadurch viel Zeit und Muͤhe
erspart wird.
Nach dem Schroten des Malzes kommt das Einmaischen, wozu ein angemessen großer
Maischbottich erforderlich ist.
Haben sich nun in der Maisch die Theilchen des Malzes mit dem Wasser verbunden; so
muͤssen sie, um nicht roh und unverdaulich zu bleiben, gekocht werden. Daher
muß die Maischkufe in der Naͤhe des Kessels oder der Pfanne sich befinden.
Der Grand liegt unter der Maischkufe, weil das Bier von dieser in jenem gelassen,
und von hier in den Kessel gepumpt, oder mittelst Schapfen dahin gebracht wird. Hat
das Bier gehoͤrig gekocht und seinen Zusaz an Hopfen erhalten, so wird es auf
die Kuͤhl geschlagen, welche ebenfalls in der Naͤhe der Pfanne seyn
soll.
Ober der Kuͤhl hat man fuͤr hinlaͤnglichen Luftzug zu sorgen,
doch so, daß man denselben nach Erforderniß maͤßigen oder ganz abhalten kann.
Auf der Kuͤhl muß das Bier geruͤhrt werden, wenn sie anders nicht so
groß ist, daß sich das Bier weit genug ausdehnen kann, um nur 3–4 Zoll hoch
zu stehen. Beim Abkuͤhlen des Biers hat der Bierbrauer, oder derjenige,
welcher zur Erleichterung des Geschaͤfts eine Maschine angiebt, dahin zu
sehen, daß durch die Wirkung der Maschine kein Schaum hervorgebracht wird. Der
Schaum schwimmt auf der Oberflaͤche des Biers, und haͤlt das
Aufsteigen der Daͤmpfe ab, wodurch das Abkuͤhlen sich leicht so
verzoͤgert, daß das Bier schadhaft wird. Die Daͤmpfe, welche sich im
Braͤuhause entwikeln, sind dem Abkuͤhlen des Biers hinderlich; es muß
deswegen die Kuͤhl vom Sudwerke geschieden, oder ganz aus dem
Braͤuhause verlegt werden.
Ist das Bier abgekuͤhlt, so viel es seyn muß, so kommt es auf die Gaͤhrkufen, wo es durch einen Zusaz von Hefe den
ersten Grad der Gaͤhrung, nehmlich die Weingaͤhrung, erhaͤlt. Um alles bequem
zu haben, so darf der Gaͤhrkeller nicht weit von der Kuͤhl entfernt
seyn. Laͤßt es die Beschaffenheit des Baugrundes zu, so kann dasselbe im
Souterrain unmittelbar unter der Kuͤhle seinen Plaz finden, wodurch man
manche die Gaͤhrung foͤrdernde Vortheile gewinnt. Nach erfolgter
Gaͤhrung wird das Bier in die Faͤsser gefuͤllt, und das ganze
Geschaͤft ist vollendet.
Aus dieser Beschreibung siehet man, wie der Gang der Sache beschaffen ist. Ich will
nun noch kurz angeben, wie die einzelnen Theile eines Braͤuhauses,
ruͤcksichtlich des Raumes, den sie einnehmen sollen, gegen einander zu
bestimmen sind.
Je groͤßer der Betrieb eines Braͤuwerkes ist, desto groͤßer
muͤssen natuͤrlich auch die Raͤume seyn, in welchen man die
Geschaͤfte verrichtet, und es muß darnach der ganze Umfang des
Gebaͤudes ausgemittelt werden. Mit dem Umfange desselben aber waͤchst
dessen Wichtigkeit, und die Schwierigkeiten, welche dabei ein Baumeister zu heben
hat, vermehren sich.
Bei der Bestimmung der Groͤße eines Braͤuhauses hat man
Ruͤcksicht zu nehmen:
1) auf die Quantitaͤt des Biers, welche consumirt wird,
sowohl bei dem Schenk- als bei dem Lagerbier. Hieraus laͤßt sich
bestimmen, wie oft waͤhrend der Sudzeit gesotten werden muß und wie stark
ein Sud seyn kann, und hiernach richtet sich die Groͤße der Pfanne,
welche den Maasstab zu dem uͤbrigen gibt.
2) Auf den Umstand, ob braunes und weißes Bier gesotten werden
darf und kann; damit man Pfanne, Maischkufe, Kuͤhl u.s.w. darnach anordne
und den Raum dafuͤr bestimme. Wenn von der Bestimmung der
Groͤße des ganzen Hauses die Rede ist, muß der Baumeister auch
beruͤcksichtigen:
3) ob mit der Braͤuerei eine Brandweinbrennerei und
Essigsiederei verbunden werden, und ob
4) das Gebaͤude Wohnungen und wohl auch eine Schenke haben
soll.
Sind alle diese Ruͤcksichten gehoͤrig beachtet, so werden die
Groͤßen der einzelnen Theile berechnet. Dazu koͤnnen folgende auf
Erfahrung und Versuche gegruͤndete Ausmessungen und Verhaͤltnisse als
Norm angenommen werden. Um aber alle Groͤßen in Zahlen ausdruͤcken zu
koͤnnen, will ich hier eine wirkliche Aufgabe zum Grunde legen, nach welcher
ich ein Braͤuhaus fuͤr braunes und weißes Sudwerk berechnet habe.
Das Sudhaus darf blos die Pfanne, den Maischbottich, den Grand und noch kleinere
Gefaͤße fassen. Im vorliegenden Fall sind zur braunen und weißen
Braͤuerei 2 Pfannen und 2 Maischkufen mit den Graͤnden angenommen. Die
große Pfanne soll 80, die andere 60 Eimer fassen. Außer diesen ist eine kleine
Pfanne noͤthig, um bestaͤndig warmes Wasser haben zu koͤnnen.
Durch die Ausmessung mehrerer Braͤuhaͤuser habe ich gefunden, daß man
den Raum, welchen die Pfanne, Maischbottich und Grand erfordern, zu einem Drittel
der ganzen Flaͤche des Sudhauses annehmen duͤrfe. Es haben aber jene
Stuͤck folgende Maaße:
2 Pfannen à 144
=
288
Die kleine Pfanne
64
Zwei Maischbottiche und Grande
200
–––––
552 □ Fuß
Das ganze Sudhaus muß demnach 1656 □ Fuß halten.
Die Groͤße einer Pfanne wird nach gegebener Eimerzahl auf folgende Art berechnet. Auf
einen Cubikfuß gehen 23 Maas; und ein baierscher Eimer haͤlt 64 Maas. Eine
Pfanne von 80 Eimern hat also 5120 Maas. Gehen nun 23 Maas auf einen Kubikfuß, so
muß die Pfanne 222 14/23 Cubikfuß fassen. Die groͤßte Tiefe einer Pfanne soll
3 1/2 Fuß betragen; wird mit dieser in obige Zahl dividirt, so erhaͤlt man
63; naͤmlich: 222/3 1/2 = 63. Die Grundflaͤche der Pfanne muß demnach
63 □ Fuß halten; ziehet man aus dieser Zahl die Quadratwurzel, so ergiebt
sich 8. √63 = 8. Folglich ist eine Pfanne, welche 80 Eimer haͤlt, 8
Fuß lang und breit und 3 1/2 Fuß tief.
Die Pfanne soll sich zum Maischbottich verhalten = 1 : 2 also muß die Maischkufe 160
Eimer halten.
Die Pfanne verhaͤlt sich gewoͤhnlich zum Grand = 16 : 7. Folglich soll
der Grand 35 Eimer fassen.
Die Kuͤhl soll so viel Eimer fassen als die Pfanne: hier 80 Eimer oder 5120
Maas. 23 Maas gehen auf einen Cubikfuß. Folglich 5120/23 = 222 14/23 oder 223. Nun
soll das Bier nur 4 Zoll oder 1/3 Fuß hoch in der Kuͤhl stehen, und die
Flaͤche dehnt sich dreimal so weit aus 223 × 3 = 669 □ Fuß
Flaͤche, welche die Kuͤhl einnehmen soll.
Der Gaͤhrkeller soll zu 6 Sud Gaͤhrgeschirre fassen. Zu einem Sud sind
4 Kufen, jede zu 20–22 Eimer, erforderlich.
Zu einem Gaͤhrgeschirr kann man 60 □ Fuß annehmen; es laͤßt sich
also die obige Anzahl Kufen in einem Raum von 1440 □ Fuß bringen. Man darf
aber nicht außer Acht lassen dem Gaͤhrkeller die noͤthige Hoͤhe
zu geben, damit auch hohe Kufen untergebracht werden koͤnnen.
Zum Malz machen gehoͤrt folgendes:
Eine steinerne Weich, welche im vorliegenden Fall 30 Schaff Gerste fassen soll. In
der Weich nimmt ein Schaff Gerste 18 Cubikfuß ein, folglich muß die ganze Weich 540
Cubikfuß fassen. Sie wird 11 Fuß lang und breit und 4 1/2 Fuß hoch gemacht. Nach dem
Weichen wird die Gerste auf den Keimboden gebracht. Ein Schaff Gerste nimmt mit den
noͤthigen Gaͤngen, und mit dem Plaz zum Umschlagen 54 □ Fuß
ein. Mithin sind zu 30 Schaff 1620 □ Fuß erforderlich. Der Welkboden soll um
1/3 groͤßer gemacht werden als der Keimboden, und daher muß der Welkboden
2160 □ Fuß halten.
Wenn es moͤglich zu machen ist, so soll die Darre den 4ten Theil so viel Raum
einnehmen als der Keimplaz. Dieser haͤlt hier 1620 und mithin kann die Darre
einen Flaͤcheninhalt haben von 400 □ Fuß.
Inzwischen ist diese Groͤße nicht unbedingt vorgeschrieben, und man kann auch
mit einer kleinern Darre auskommen.
Die Augsburger Braͤuhaͤuser haben oft nur den 5 und 6ten Theil des
Keimplazes zur Darre.
Zur Aufbewahrung des Malzes und zur Gerste sind die Bodenraͤume unter dem
Dache bestimmt, und es ist gut, wenn man viel Plaz dazu haben kann.
Dieses wird das Vorzuͤglichste seyn, was zur Berechnung der Groͤße
eines Braͤuhauses gehoͤrt.
Mit einer Bierbraͤuerei wird gewoͤhnlich eine Brandweinbrennerei
verbunden, weil man bei der lezten manches aus dem Braͤuhause benuzen kann.
Wenn Absaz vorhanden ist, und wenn es sonst die Umstaͤnde gestatten, so kann
man eine solche Brennerei weit ausdehnen, vorzuͤglich dann, wenn bei der dazu
gehoͤrigen Oekonomie viele Kartoffeln gebaut werden. Bei der Anlegung eines
solchen Gebaͤudes muß denn auch der Baumeister den Umfang und den Raum der
Brandweinbrennerei berechnen.
Zu einer Brandweinbrennerei gehoͤrt der Hafen, das Kuͤhlgeschirr, der
Maischbottich. Ueberhaupt aber ein Wassergrand, eine Kartoffelmuͤhle etc. Es
kommt aber darauf an, wie viele Haͤfen angebracht und wie groß diese werden
sollen. Um einen allgemeinen Maasstab zu haben, kann man den Quadratinhalt
berechnen, den ein Hafen mit dem Kuͤhlfaß etc. einnimmt. Diese Flaͤche
zu 1/3 des erforderlichen Raumes annehmen, und noch 2/3 fuͤr das
uͤbrige zugeben. Dabei aber ist die Schuͤrgrube nicht mit berechnet,
sondern sie muß besonders zugegeben werden.
Ein Hafen mit dem Kuͤhlgeschirr soll 66 □ Fuß einnehmen. Sind 5
dergleichen Brennzeuge vorhanden, so erhaͤlt man einen Raum von 330 □
Fuß, und mithin muͤßte das ganze Brennhaus 990 □ Fuß fassen.
–
Wenn es moͤglich ist, so sollen im Gebaͤude selbst die Brandweinkeller
befindlich seyn; außerdem kann aber auch der Brandwein in andern Kellern
untergebracht werden.
Bei einem großen Oekonomiegut gewaͤhrt eine Essigsiederei viele Vortheile.
Wenn auch diese, mit der Braͤuerei in Verbindung gebracht werden soll, so muß
die Groͤße derselben berechnet werden. Dabei kommt es natuͤrlich auch
auf den Betrieb des Geschaͤftes an. Ist nur ein Kessel nothwendig, so kann
man mit einem Sudhaus, welches 600 □ Fuß faßt, auskommen. Ueberdies soll noch
eine heizbare Essigstube und allenfalls noch ein Behaͤlter fuͤr
allerlei Geraͤthschaften vorhanden seyn; auch soll man einen besondern
Essigkeller anzubringen suchen.
Durch die bisherige Beschreibung wird man sich in den Stand gesezt sehen, jene drei
Zweige oͤkonomischer Industrie in ein Gebaͤude zu vereinigen. Man hat
die Construction der einzelnen Theile einer Braͤuerei kennen gelernet; man
weiß, wie die Geschaͤfte in einandergreifend und auf einander folgend
betrieben werden muͤssen, und man hat einen Maasstab zur Berechnung der
Groͤße eines solchen Gebaͤudes. Aus dieser Beschreibung wird man
aber auch wahrnehmen, daß bei der Ausfuͤhrung einer Braͤuerei viele
Hindernisse zu bekaͤmpfen, und viele Umstaͤnde zu
beruͤcksichtigen sind.
Unstreitig gehoͤrt die Erbauung eines Braͤuhauses, und noch viel mehr,
die Einrichtung eines Braͤuwerks in einem schon bestehenden Gebaͤude
zu den schwersten Aufgaben, die ein kameralistischer Baumeister zu loͤsen
hat. Eine solche Aufgabe wurde mir vor einigen Jahren gemacht. Es sollte
naͤmlich eine Bierbraͤuerei, eine Brandweinbrennerei und eine
Essigsiederei in ein schon vorhandenes Gebaͤude eingerichtet werden. Ueber
diese Einrichtung liefere ich im anliegenden Blatt, Tab. XX. drei Grundrisse, einen
Laͤngendurchschnitt und einen Aufriß von der langen und von der schmalen
Seite.
Das Gebaͤude hatte seiner ersten Bestimmung gemaͤß, nur die
Hoͤhe von einem Stockwerk, die Umfassungsmauern aber waren so stark, daß sie
noch ein zweites Stockwerk und den Bodenraum mit der Beschwerung, welche dieser
durch Malz erhaͤlt, zu tragen vermochten. Diese Umfassungsmauern und drei der
mittlern Scheidemauern sollten stehen bleiben; nur Fenster und Thuͤren wurden
versezt. Das ganze Gebaͤude bis an die Hauptmittelmauer, welche nun das
Sudhaus von der Schuͤrgrube scheidet, war mit gut gewoͤlbten Kellern
versehen, und auch diese sollten so viel moͤglich erhalten und benuzt werden.
Der gegenwaͤrtige Gaͤhr- und Vorkeller war noch nicht
vorhanden; diese mußten also neu hergestellt werden.
Bei der Construction dieses Gebaͤudes war das erste Augenmerk, der
Kuͤhle einen Plaz zu geben, welcher von der Luft bestrichen werden
koͤnnte. Dieser Plaz fand sich am Ende des Gebaͤudes, und damit wurde
auch der Raum fuͤr den Gaͤhrkeller bestimmt, denn das Souterrain ist
von der Beschaffenheit, daß auf keine Weise Wasser dahin kommen kann. Daher konnte auch die
Malztenne in das Souterrain gelegt werden.
Die Zeichnung Fig.
L enthaͤlt den Grundriß vom
Souterrain. Fig. M das erste Stockwerk. (den Stock zur ebenen
Erde) Fig. N das zweite Stockwerk. (erste Stockwerk).
Fig. O ist das Laͤngenprofil. Fig. P der Aufriß von der langen und Fig. Q der Aufriß von der schmalen Seite.
Der Haupteingang in das Gebaͤude ist Fig. M Lit. a, und durch diesen kommt man
auf den Vorplaz Lit. b. Auf diesem Vorplaz befindet sich
eine Treppe in den Gaͤhrkeller Lit. c; dann bei
Lit. d eine Treppe in das zweite Stockwerk,
naͤmlich auf den Welkboden und unter dieser eine abwaͤrts in den
Keller. Bei der weitern Erklaͤrung der Nisse will ich mich nach der
Folgeordnung der hier vorkommenden Geschaͤfte richten, es kommt also zuerst
der Weichkasten, welcher aus steinern Platten zusammengesezt ist. Dieser stehet auf
der Malztenne im Souterrain Fig. L bei e, und ist nun nach obiger
Beschreibung so eingerichtet, daß die Gerste vom Boden auf den Keimplaz mittelst
einer Gosse und Rinne herunter gelassen werden kann. Bei Lit. ggg ist die Rinne zu sehen. In den Weichkasten
kann Wasser gelassen werden, wenn man den in der Ecke befindlichen Hahn umdreht.
Oben auf dem Gerstenboden befindet sich eine Gosse, um die Gerste einmessen zu
koͤnnen. An diese Gosse ist die Rinne ggg
welche in den drey Grundrissen zu sehen ist, befestiget. Lit. f ist die Malztenne, oder der Keimplaz von oben berechneter Groͤße.
Der Fußboden dieses Plazes ist mit großen gehauenen Schaalen, oder steinernen
Platten belegt. Die Decke ist, wie der Durchschnitt Fig. O bei f zeigt, gewoͤlbt.
In dem Gewoͤlbe sind die Oeffnungen Lit. h, (man
sehe die Grundrisse und den Durchschnitt), angebracht, um die gekeimte Gerste auf
den Welkboden Lit. i aufziehen zu koͤnnen. Da
aber der Welkboden Lit. i in manchen Faͤllen zu
klein seyn
wuͤrde, so kann auch der Raum k
Fig. N dazu benuzt werden. Der Keimplaz f ist hier 8 Fuß tief in der Erde, und hat daher so viel
Waͤrme als noͤthig ist. Die an zwei Seiten angebrachte Fenster
koͤnnen geschlossen und noͤthigen Falls geoͤffnet werden. Die
Welkboͤden liegen hoch, und haben ebenfalls von zwei Seiten Fenster, so daß
die Luft uͤber die ausgebreitete Gerste streichen und sie bald abtrocknen
kann. Auf der obern Welk Lit. k steht die Darre, und die
Gerste kann gleich vom Welkboden dahin gebracht werden.
Die Darre Lit. l wird unten in der Schuͤrgrube bei
Lit. m geheizt; die Hize zieht sich herauf und zirkulirt
in den Kanaͤlen. Der Boden ist von Eisenblech und durchloͤchert, so
daß der Rauch durch das Malz geht. Oben ist diese Darre mit einem Gewoͤlb
versehen und die Balken sind ausgewechselt. Da die Feuerkanaͤle, oder die
Sau, auch auf einem feuerfesten Gewoͤlb ruht, so hat man hier nicht die
geringste Feuersgefahr zu befuͤrchten. Bei Lit. n
ist eine Oeffnung um die Kanaͤle von Ruß reinigen zu koͤnnen. Durch
das obere Gewoͤlb geht, wie im Durchschnitt zu bemerken ist, ein
Rauch- und Dampfschloth durch das Dach hinaus, und die Darre selbst hat drei
Fenster gegen die Aussenseite, die geoͤffnet werden koͤnnen, um den
Dampf abzuleiten. Das aus der Darre kommende fertige Malz kann in Koͤrben auf
den Boden zur Aufbewahrung gezogen werden.
Wenn das Malz geschrothen werden soll, muß es mit Wasser befeuchtet werden, und dazu
ist ein besonderer Plaz noͤthig, den man die Einspreng nennt. Dieser Plaz ist
wo moͤglich zur ebenen Erde zu waͤhlen, damit man das eingesprengte
Malz sogleich in Saͤcke fuͤllen und zur Muͤhle bringen
koͤnne. Die Einspreng ist hier Fig. M bei o. Von dem Boden, worauf das
Malz liegt, geht eine Rinne herunter, durch welche das Malz auf die Einspreng
gelassen wird.
Das Sudhaus befindet sich Fig. M bei p. Es soll braunes und weißes Bier gebraut werden,
weshalb zwei große Pfannen angebracht sind. Die kleine dritte, dient, um
bestaͤndig warmes Wasser haben zu koͤnnen. Zu jeder Pfanne
gehoͤrt ein Maischbottich und ein Grand. Die Kessel werden in der
Schuͤrgrube q gefeuert, und diese ist deswegen so
geraͤumig, weil auch die Brandweinhaͤfen, welche auf der andern Seite
liegen, von hier geheizt werden. An der Ruͤckseite des Gebaͤudes liegt
der Oekonomie-Hof, auf dem sich die Holzremisen befinden. Daher hat die
Schuͤrgrube eine große Thuͤr in diesen Hof, und das Holz zum Heizen
kann mit Schubkarren herbei gefahren werden. Auch das Sudhaus hat eine Thuͤr
auf diesen Hof so wie auf den Vorplaz b. Das Sudhaus
besteht ganz fuͤr sich, es geht durch zwei Stockwerk und ist gewoͤlbt.
Die einander gegenuͤber liegenden Fenster fuͤhren die Daͤmpfe
ab, und dann ist auch noch, wie aus dem Durchschnitt erhellet, uͤber den
Pfannen ein besonderer DampfschlothDergleichen Dampfschloͤthe werden von Brettern oder Dielen
zusammengesezt; aber man muß sie wohl verwahren, daß kein Dampf auf die
Malz- und Gerstenboͤden dringen kann. angebracht. In den Gaͤhrkeller fuͤhrt eine Treppe vom
Sudhause. In die Kessel und Maischbottiche kann laufendes Wasser gebracht werden. In
den Winterbier-Keller gelangt man mittelst der auf dem Vorplaz liegenden
Treppe, und von diesem in einen andern Keller, welcher zum Schenkbier dient.
Das Pflaster des Sudhauses besteht aus harten steinernen Platten, und man soll
demselben ein Gefaͤll nach aussen geben, um das Sudhaus ausschwemmen zu
koͤnnen.
Die Kuͤhlen sind hier ganz vom Sudwesen abgesondert, damit dem
Abkuͤhlen keine Daͤmpfe nachtheilig werden koͤnnen. Das
Kuͤhlhaus hat von drei Seiten Oeffnungen, welche mit Vorsezlaͤden
geschlossen werden koͤnnen; es geht durch zwei Stockwerke und ist
gewoͤlbt. Die Kuͤhlen stehen etwas erhoͤht und sind im Plan
Fig. M bei rrr
angebracht.
Eine große Kuͤhl und die kleine gehoͤren zum braunen Sudwerk, die
andere große zum weißen. Nach der Berechnung der großen Pfanne wurde dem
Kuͤhlschiffe so viel Ausdehnung gegeben, daß sich das Bier, ohne
geruͤhrt zu werden, abkuͤhlt. Bei Lit. s
ist ein Vorplaz zur Kuͤhl, welcher gleiche Hoͤhe mit ihr hat. Die
Thuͤr gegen das Sudhaus ist so eingerichtet, daß sie von selbst
zufaͤllt, damit keine Daͤmpfe eindringen koͤnnen. Von diesem
Vorplaz geht zu jeder Kuͤhl eine Thuͤr. Will man aber hier eine
Ruͤhrmaschine anbringen, so kann es ohne große Weitlaͤufigkeit
geschehen. Den Raum unter der Kuͤhl kann man benuzen, kleinere Faͤsser
und andere Geraͤthschaften dahin zu stellen. Vom Kessel wird das Bier in
Rinnen auf das Kuͤhlschiff geleitet.
Unmittelbar unter der Kuͤhl befindet sich der Gaͤhrkeller, und dieser
liegt 7 Fuß tief in der Erde, weil er wie der Keimboden einen gewissen Grad
Waͤrme bedarf. Die Decke desselben ist gewoͤlbt und der Fußboden mit
Schaalen belegt. Die Hoͤhe dieses Kellers betraͤgt in der Mitte 11
Fuß, und dabei haben die Gaͤhrkufen noch hinlaͤnglichen Raum ober
sich. Die auf den drei Seiten befindlichen Oeffnungen, welche 4' breit und 2' hoch
sind, koͤnnen mit Fenstern und Laͤden verschlossen werden. Die
Gaͤhrkammer ist so geraͤumig, daß 17 bis 18 Gaͤhrgeschirre Plaz
darin haben. Von der Aussenseite ist eine Thuͤr angebracht um das vergohrne
Getraͤnke in die Sommerkeller schaffen zu koͤnnen. Die
geraͤumige Boͤden, sowohl im Halbgeschoß, als auch unter dem Dache
sind zur Aufbewahrung der Gerste, des Malzes und des Hopfens eingerichtet. Zur
Aufbewahrung des Hopfens eignen sich besonders die sogenannten Hopfenpressen. Eine
solche Presse ist ein hoher, aus Dielen zusammengefuͤgter, Kasten. Er kann durch zwei
Geschosse gehen und eine Hoͤhe von 20–25 Fuß haben. Die Breite und
Dicke kann 4–5 Fuß betragen. Unten wird eine gut eingepaßte Thuͤr
angebracht; dieser Kasten, welcher luftdicht seyn muß, wird mit Hopfen
gefuͤllt. Oben ist eine Schraube angebracht, mittelst welcher der Hopfen
zusammen gepreßt wird. Aus der untern Thuͤr nimmt man so viel Hopfen heraus,
als man auf einmal braucht, und dann wird die Schraube wieder angezogen und der
Hopfen nachgepreßt. Da die Spindel der obern Schraube nicht so lang als der Kasten
seyn kann, so bringt man Untersaͤze von 7–8 Zoll starken
Hoͤlzern an, wenn der Kasten leerer wird. Eine solche Presse findet bei Lit.
π einen schicklichen Plaz.
Im Souterrain, welches eigentlich zur Braͤuerei gehoͤrt, sind nur zwei
Keller, naͤmlich Lit. u bei Fig. L, welcher fuͤr das Winterbier, und Lit. t, der fuͤr Schenkbier bestimmt ist. Ein großer
Sommerkeller, so wie ein geraͤumiger Keller zum Winterbier, befindet sich
ausser dem Gebaͤude.
Die Brandweinbrennerei liegt zur ebenen Erde unmittelbar an der, mit dem
Braͤuhause gemeinschaftlichen Schiergrube. Sie ist im Plan Fig. M mit v bezeichnet. Die
Groͤße derselben betreffend, so ist sie auf 4 Haͤfen berechnet, und es
sind daher im Plane vier Maischkufen zu sehen. Das Brandweinhaus ist durchaus
gewoͤlbt und hat eine Thuͤr gegen den Hof. Den gewoͤhnlichen
Eingang aber hat es vom Vorplaz Lit. b. Im Souterrain
befindet sich ein Brandweinkeller Lit. w bei Fig. L. In diesen Keller kann man auf der daran
liegenden Treppe gelangen.
Zur Essigsiederei y kommt man durch die erste
Thuͤr des Gebaͤudes, von dem Vorplaz Lit. x. Hier steht eine kleine Pfanne nebst andern zur Essigbereitung
noͤthigen Gefaͤßen. Bei Lit. z ist eine
geraͤumige Essigstube, und im Souterrain befinden sich zwei Essigkeller Lit.
α und β.
Die Wohnung des Braͤumeisters liegt im zweiten Stockwerk. Durch den Vorplaz
x kommt man mittelst der Treppe γ zu dem obern Vorplaz δ. Von diesem geht man in die Wohnstube ε, dann in ein daran stoßendes Cabinet ξ, und in die Schlafstube η. Von
hier aus geht ein Fenster auf den Welkboden. Bei Lit. D
ist die Kuͤche, und daran stoͤßt die Speiskammer ι. Bei λ ist
eine Stube fuͤr die Braͤuknechte. Durch den Gang μ kann man auf den Welkboden kommen.
Die Treppe φ fuͤhrt auf den Malz-
und Gerstenboden. Auf der Treppe γ geht man
herunter und durch die Einspreng Lit. o in den untern
Welkboden. Auf diese Art ist der Braͤumeister in Verbindung mit der ganzen
Braͤuerei, und kann eine schnelle Uebersicht vom ganzen Geschaͤfte
haben.
Das ganze Gebaͤude ist, wie man an der Aussenseite Fig. P und im Durchschnitt O sehen kann, mit einem Halbgeschoß versehen; uͤber jedem Fenster wurde
eine halb runde Oeffnung in den Dachraum angebracht. Dieses geschah, um die vielen
Dachlucken entbehren zu koͤnnen, welche uͤberhaupt dem Dachwerk
nachtheilig sind. Ein solches Halbgeschoß gewaͤhrt einen groͤßern
Bodenraum; durch die halbrunden Oeffnungen oder Fenster bekommt man
hinlaͤnglichen Luftzug, und die Aussenseite gewinnt in aͤsthetischer
Hinsicht.
Außer dem bisher beschriebenen Gebaͤude, gehoͤren zur vorliegenden
Braͤuerei noch andere Bauwerke, naͤmlich: eine große Faßremise mit der
Faßbinderei, und eine Materialien-Kammer; geraͤumige gedeckte
Holzlagen, ein besonderer Maststall fuͤr Rindvieh und Schweine. Alle diese
Gebaͤude und einen Schenkkeller faßt der hinter dem Hauptbau angelegte große
Hof. Von diesem geschlossenen Ganzen entfernt liegt der Sommer- oder
Lagerbier-Keller.
In dem vorliegenden Braͤuhause werden, wie ich glaube, alle Geschaͤfte
leicht und in einander greifend verrichtet werden koͤnnen, und den
Maͤngeln, welchen das Braͤuwesen uͤberhaupt noch unterworfen ist, kann bei
einer solchen Einrichtung des Gebaͤudes, vielleicht um so eher abgeholfen
werden, wenn ein wissenschaftlicher Mann Verbesserungen vornehmen will.
Chemiker und Mechaniker werden fuͤr den Betrieb einer Braͤuerei noch
manches Gute zur Ersparung an Kosten, Zeit und Arbeit beitragen koͤnnen. So
wurden z.B. in neuern Zeiten viele gelungene Versuche mit der Benuzung der
Wasserdaͤmpfe zum Kochen und Heizen angestellt. Nach Herrn Dr. Dinglers Angabe hat man hier verschiedene
Dampfapparate in oͤffentlichen Anstalten und Fabriken, welche die
Nuͤzlichkeit eines solchen Unternehmens aussprechen.
Tafeln