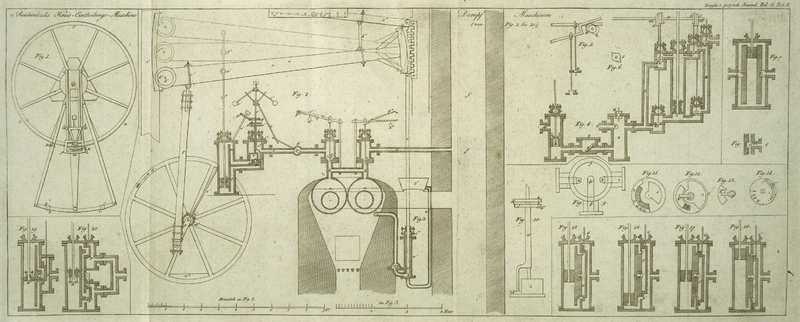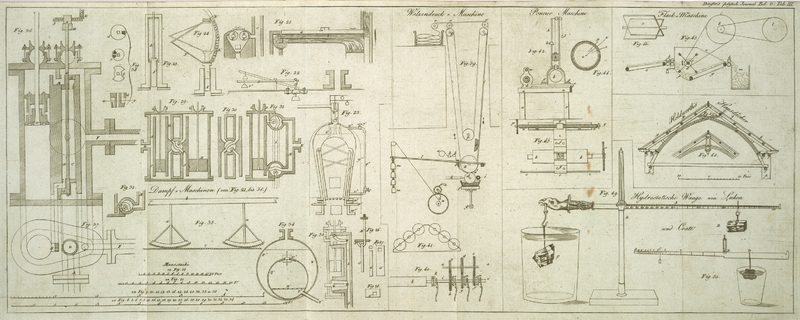| Titel: | Bericht des Herrn Baillet, im Namen des Comites der mechanischen Künste, in Bezug auf Herrn de Valcourt's Denkschrift, über Dampfmaschinen, und besonders über Dampfmaschinen mit hoher Pressung. |
| Fundstelle: | Band 6, Jahrgang 1821, Nr. XX., S. 137 |
| Download: | XML |
XX.
Bericht des Herrn Baillet, im Namen des Comites der mechanischen Künste, in Bezug auf Herrn de Valcourt's Denkschrift, über Dampfmaschinen, und besonders über Dampfmaschinen mit hoher PressungMan vergleiche hiemit die Beschreibungen von Dampfmaschinen Bd. 1. S. 129. Bd. 2. S. 129. Bd. 3. S. 37 u. 260. Bd. 4. S. 255. Bd. 5. S. 1.
255. 381. u. 382. D..
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement. Maͤrz 1821. Frei uͤbersezt, vom Prof. Maréchaux in Muͤnchen.
Maréchaux's über Dampfmaschinen.
Herr von Valcourt, korrespondirendes Mitglied des Akerbauraths
(conseil d'agriculture) bei Seiner Excellenz, dem
Minister Staatssekretaͤrs des Innern, in Toul, Meurthe Departement, hat Ihnen
eine Denkschrift uͤber die Dampfmaschinen zugesendet, und Sie haben Ihrem
Comite der mechanischen Kuͤnste den Auftrag gegeben, einen Bericht
daruͤber abzustatten. In Seinem Namen erfuͤlle ich hier diese
Pflicht.
Herr von Valcourt faͤngt seinen Aufsaz mit dem Wunsche an, daß die
Aufmunterungs-Gesellschaft eine Beschreibung der verschiedenen in England und
in den vereinigten Staaten angewendeten Dampfmaschinen sich zu verschaffen suche,
und sie, mit allem was in Frankreich darin geschehe, in einem Bande, bekannt mache.
Er versichert, daß in den nordamerikanischen Staaten, wo man, auf dem Mississipi
allein, uͤber 60 Dampfschiffe zaͤhlt, sie von einander, sowohl durch
ihre Gestalt, als durch ihren inneren Bau, sehr abweichen, und daß eine große Menge,
nach Oliver Evans Methode, mit hoher Pressung, und ohne Condensirung sind.
Da eine Reise, von 72 Stunden, auf dem Mississipi, im Jahre 1798, und ein Auffenthalt
von mehreren Jahren an den Ufern dieses Flusses, ihn von dem Nuzen der Dampfschiffe
uͤberzeugt hatte, begab er sich nach Philadelphia, im Jahr 1803, um daselbst
ein Dampfschiff bauen zu lassen; hier wurde er von der kleinen
Oliver-Evaus'schen Maschine entzuͤkt, die mit einem 6 zoͤlligen
Kolben, und einem 8 zoͤlligen Hub, (engl. Maaß), eine Gypsmuͤhle, und
12 Saͤgen, den Marmor zu scheiden, in Bewegung sezte, und von diesem
Augenblike an, faßte er den Entschluß, Maschinen mit hoher Pressung zu benuzen, und
die Wirkungen der Condensation noch zu erhoͤhen.
Vom Kessel der Dampfmaschinen.
Damals waren gewoͤhnlich die englischen Kessel aus Gußeisen: sie konnten aber
nicht ohne Gefahr zu Maschinen verwendet werden, die einen Druk von mehreren
Atmosphaͤren aushalten muͤssen.
Oliver Evaus bediente sich cylindrischer Kessel, 12 Fuß lang, 2 Fuß im Durchmesser,
(engl. Maaß) aus zwei Linien dikem Eisenbleche. Herr Valcourt, der mehr Kraft
noͤthig hatte, ließ parallellaufende Kessel, Tab. II. Fig. 19. verfertigen; er
gab ihnen die Laͤnge und den Durchmesser der Evaus'schen, er nahm aber dazu 2
1/2 Linien dikes Blech; in jedem Kessel aber brachte er einen gleich langen Cylinder
von einem halben Schuh im Durchmesser, durch welchen die Flamme und der Rauch
durchziehen mußten; – eine Vorkehrung die oft nachgeahmet wurde, und die, wie
man weiß, die Maße des zu erwaͤrmenden wassers vermindert, und die mit der
Flamme in Beruͤhrung kommende Oberflaͤche vergroͤßert.
Mit Recht bemerkt er, daß ein Cylindrischer Kessel leichter zu machen ist, als ein
andrer von gleicher Gestalt; daß man weniger Eisenblech daran verliert, und daß, bei
gleichem Inhalte, bei gleicher Dike der Seitenwaͤnde, ein Kessel, mit
kleinerem Durchmesser, mehr Widerstand als ein groͤßerer leistet. Er sezt
hinzu, daß er das Sicherheits-Ventil der Kessel, welche er verfertigen ließ,
mit 120 Pfund, fuͤr den QuadratQradrat Zoll, beschweren konnte; daß heißt, daß die elastische Kraft der
Daͤmpfe sich darin bis zur Wirkung von acht Atmosphaͤren, steigen
ließ.
Dampfstiefel, und Nasenventile. (Soupapes à cames).
Der Stiefel seiner Dampfmaschine, hielt anderthalb Fuß im Durchmesser, und der Hub
war von zwei Fuß, alle Ventile waren Muschel-Ventile
, (Soupapes à
coquilles) aber die beiden Einlaß-Ventile
und die beiden Auslaß-Ventile, nach dem Condensator hin, waren durch vier
Nasen oder durch vier mit Nasen versehene Scheiben in Bewegung gesezt. An derselben
Achse befestigt, drehten diese Nasen nach derselben Richtung. Die Nasen, fuͤr
die Einlaß-Ventile, waren so eingerichtet, daß sie diese Ventile schlossen,
wenn der Kolben zur Haͤlfte seines Laufes gelangt war, so daß, von diesem
Augenblike an, der Kolben seine Bewegung fortsezte, bloß von dem elastischen
Wasserdampfe getrieben, der sich nach und nach so ausdehnte, daß er einen doppelt so
großen Raum fuͤllte. Dagegen hielten die Nasen fuͤr die Ausgangs-Ventile, diese,
waͤhrend, der ganzen Zeit des Hudes, offen.
Druk-Pumpe, zum Einsprizen des Wassers.
Das Einsprizen des kalten Wassers in den Condensator, geschahe, wie in andren
Maschinen, durch zahllose Loͤcher, aus einem Sprizenkopfe und die Menge des
Wassers wurde durch einen Hahn regulirt. Herr von Valcourt bemerkt, daß man diesen
Hahn schließen muß, wenn die Maschine zu arbeiten aufhoͤrt, ohne dieses
wuͤrde das Wasser in den Condensator und in einen Theil des Stiefels steigen.
Um solches zu verhuͤten glaubt er, daß man zum Einsprizen, eine
Druk-Pumpe, wie diejenige, die dem Kessel das Wasser zufuͤhrt,
anwenden koͤnnte: aber wuͤrde diese Pumpe nicht unnuͤzer Weise,
einen Theil der Kraft der Maschine beschaͤftigen?
Wirkungen der Valcourt'schen Maschine.
Die so eben beschriebene Maschine wurde in Jahre 1806, zu Neu-Orleans, in
Kentucky, auf einem 100 Fuß langen Schiffe, errichtet; da indeß das Wasser des
Mississipi sich zu der Zeit, wo es gewoͤhnlich am hoͤchsten zu seyn
pflegt, ploͤzlich zuruͤkgezogen hatte, so wurde sie wieder auseinander
genommen; um sie aber zu benuzen, wurde sie zu einer Saͤgemuͤhle, mit
doppeltem Gatter, und zwei Saͤgen an jedem angebracht. Hier schnitt sie
innerhalb drei Minuten zwei, 10 Fuß lange und 1 Fuß breite Bretter, oder 400 Quadrat
Fuß in einer Stunde. Ich bemerke, daß, zu eben dieser Arbeit, ungefaͤhr 100
Menschen noͤthig seyn wuͤrden; denn 3 Arbeiter koͤnnen nur
ungefaͤhr 10 Quadr. Schuh, von gruͤnem Eichenholze, in einer Stunde
foͤrdern, (Archit.
hydr. d. Belidor, 1ster Band, und Art du
charpentier, von Hassenfratz).
Haͤhne, nach Herrn West.
Herr von Valcourt beschreibt hierauf zwei Haͤhne, die er zu Lexington, bei
Hrn. West, gesehen hat; der eine gegen den Condensator hin, machte eine viertel Umdrehung, so oft
der Kolben am Ende seines Laufes war, wogegen der andre, beim Eintritt der Dampfe in
den Cylinder, nur am Ende jedes Hubes eine achtel Bewegung zuruͤklegte, um
die Daͤmpfe, gegen die Haͤlfte des folgenden Hubes, durchzulassen, und
wiederum eine achtel Bewegung, wenn der Kolben die Mitte des Stiefels erreicht
hatte. Sieh Fig.
5 und 6 Tab. II.
Drehendes Ventil, mit seinem Regulator.
Oliver Evaus Ventil, ist ohne Zweifel, unter allen, das sinnreichste. Herr von
Valcourt hat Ihnen ein Model desselben von Pappendekel geschikt. Es hat einige
Aehnlichkeit mit dem Martin- und Albert'schen Schieb-Ventil, (Soupape à
tiroir), ist aber von diesem dadurch
verschieden, das Oliver Evaus Ventil sich fortdauernd in derselben Richtung dreht,
und den Daͤmpfen den Eintritt, waͤhrend dem Laufe des Kolbens, so
lange man will, gestattet, ohne daß es noͤthig sey, die Dampfkammer (boite à vapeurs) zu oͤffnen.
Gradlinigte Bewegung der Kolbenstange.
Herr von Valcourt hat ein neues Mittel angewendet, um die Bewegung der Kolbenstange
immer gleich senkrecht zu erhalten. Sieh Fig. 2. Tab. II. Er
befestigt, zu diesem Ende, das aͤußerste Ende der Kolbenstange, an den
Balancier, in dem Centrum eines Theiles eines gezahnten Rades, welches in eine
senkrecht laufende gezahnte Stange eingreift. Es ist offenbar, daß man, durch diese
Vorkehrung eine genau gradlinigte Bewegung, in der Verlaͤngerung der Achse
des Stiefels hervorbringt, so bald nur die gezehnte Stange selbst vollkommen grade
und mit dieser Achse parallel ist. Zur Bildung dieser Bewegung ist aber an dem einen
Ende des Balancier ein Zahnwerk, an dem andren eine Stuͤzrolle
noͤthig, und die Unterlagen, rechts und links, außerhalb der Maschine
muͤssen unerschuͤtterlich seyn. Die Schwierigkeiten wuͤrden
dabei geringer ausfallen, wenn die Bewegung horizontal vor sich gienge. Eine solche
habe ich seit geraumer Zeit in den Salzwerken zu Moutier in Savoyen angebracht
gesehen; um den Leitstangen an den Kurbeln, welche den fern liegenden Pumpenkolben,
die das Salzwasser auf die Gradir-Werke heben, die Bewegung mittheilen, in
einer streng horizontalen Linie zu erhalten. In der hydraulischen Maschine zu
Moutiers, ist an der Stelle des Valcourt'schen Zahnwerks eine doppelte Kette, und
einen Sector. Siehe Fig. 33. Tab. III.
Befestigung der Leitstange an den Balancier.
Alle diejenigen, welche sich mit dem Maschinenbau beschaͤftigten, oder mit
Maschinen viel umgehen, wissen, wie sehr ihre Erhaltung, ihre Dauer, und die
Regelmaͤßigkeit ihrer Bewegung, von der leichten Bewegung aller beweglicher
Theile derselben abhaͤngen. Sie werden Herrn von Valcourt Dank wissen, daß er
sie mit einem Mittel bekannt macht, welches in der neuen Welt fast durchgehends
uͤblich ist, um die Leitstange mit dem Balancier, oder einen Hebet mit dem
andern zu verbinden, und um jedes Schwanken, wenn solches etwa statt finden sollte,
abzuhelfen.
Dieses Mittel, Fig.
24, 25, 26, erfordert bloß einen gebogenen Bolzen, ein Zwischen-Blech, und
eine einzige Schrauben-Mutter.
Mittel, um sehr heißes Wasser, fuͤr den Dampfkessel, zu bereiten.
Herr von Valcourt hatte, gleich im Eingange, angezeigt, daß er, so wie Oliver Evaus,
vorteilhaft faͤnde, den Dampf mit hoher Pressung anzuwenden, und diesen
alsdann in dem Stiefel expandiren zu lassen; daß man aber auch die Wirkung der
Maschine dadurch erhoͤhen muͤsse, daß man unter dem Kolben, durch
Einsprizung kalten Wassers, den Dampf condensire. Ueber diesen Punkt kommt er
zuruͤk, und meint, daß zu kleinen Maschinen, von 15 Pferde-Kraft, und
darunter, es besser ist, die Condensirung zu unterlassen, besonders wenn man wenig
Wasser hat, und warmes Wasser braucht, oder es zur Erwaͤrmung großer
Saͤle, und großer Werkstellen verwenden will. In diesem Falle schlaͤgt
er einen kleinen Kessel vor, den man an die Stelle sezen wuͤrde, wo die
Flamme und der Rauch des Heerdes, sich in den Rauchfang begeben. Die Pumpe
fuͤr kaltes Wasser treibt dieses in den kleinen Kessel; hier wird es lauwarm,
und wird dann zur zweiten Pumpe gefuͤhrt, welche es dem Dampfkessel, durch
aneinander gereite Flintenlaͤufe zufuͤhrt, die ins Innere des Heerdes
gehn, und mit dem aͤußersten Ende der Kessel in Verbindung stehen. Fig. 3. Tab.
II.
Um die Menge des Wassers zu bestimmen, die der Dampfkessel braucht, veraͤndert
Hr. von Valcourt die Laͤnge des Hubes, indem er die Stellung des Bolzens, um
welchen sich der Pumpenhebel bewegt, veraͤndert. Fig. 2. Tab. II.
Ventil, um die Luft in den luftleeren Dampfkessel einzulassen. (Soupape à air, on Soupape du vides).
Er empfielt dringend ein Luftventil, Fig. 20. Tab. II. um die
aͤußere Luft in den Dampfkessel einzulassen, wenn das Spiel der Maschine
aufhoͤrt, und die Kessel kalt werden. Dieses Ventil ist seit langer Zeit an
unseren Newcomen'schen, und Watt'schen Maschinen angebracht, und wurde mit dem Namen
des Ventils fuͤr den luftleeren Raum bezeichnet.
Mittel, die Hoͤhe des Wassers im Dampfkessel zu erkennen.
Er glaubt, daß die beste Vorkehrung, um zu jeder Zeit, die Hoͤhe des Wassers
im Dampfkessel zu kennen, eine glaͤserne Roͤhre ist. Sie wird in zwei
kniefoͤrmig gebogene kupferne Roͤhren eingelassen. Die eine steht mit
dem Wasser am Boden des Kessels, die andere uͤber dem Wasser mit dem Dampfe
in Verbindung. Die Erfahrung hat gelehrt, daß es gut ist, die beiden kupfernen
Roͤhren, mit Haͤhnen zu versehen, um beide, im Falle die
glaͤserne Roͤhre braͤche, schließen zu koͤnnen. Fig. 21. Tab.
III.
Nuzen eines regulirenden Ventils.
Herr von Valcourt theilt hierauf seine Meinung uͤber den Nuzen eines Ventils,
den er das Regulirende nennt, und verschieden ist, sowohl von dem Sicherheitsventil, als von dem Einlaßventil. Das Sicherheitsventil, dient, wie Jedermann weiß, dem Dampfe
einen Ausgang zu gestatten, wenn er eine zu große Spannung bekommt. Die Oeffnung des
Zulaßventils, oder des Zulaßhahnes wird regulirt, entweder mit der Hand, oder durch den Moderator, oder durch das conische
Pendel; aber das regulirende Ventil, welches Herr von Valcourt
vorschlaͤgt, ist oben am Dampfkessel angebracht, innerhalb des Dampfrohres,
das mit dem Stiefel in Verbindung ist, und an der Wurzel desselben. Es wird minder
belastet als das Sicherheitsventil, und mißt genau die Kraft mit welcher man aus den
Kolben wirken will. Siehe Fig. 2. Tab. II.
Benuzung der Daͤmpfe.
Herr von Valcourt glaubt, daß es vorteilhaft sey, wenn die Maschine mit einer
bestimmten Kraft arbeitet. Es ist, nach ihm, besser, daß ihre Bewegung
aufhoͤre, oder einige Augenblike unterbrochen werde, als wenn sie durch einen
zu schwachen Dampf erzeugt wird. Die Benuzung des Dampfes, bei hoher Temperatur,
scheint ihm sehr vorteilhaft in Bezug auf das Brennmaterial. Die Kostenersparung
scheint ihm hier ohne Zweifel, man moͤge mit mehreren Physikern annehmen oder
nicht, daß ein gleich großer Gewichtdampf der den ganzen Raum anfuͤllt bei
jeder Temperatur und unter jedem beliebigen Druke, eine gleich große Menge
Waͤrme enthaͤlt.
Mittel dem Verlust des Dampfes zuvorzukommen.
Herr von Valcourt kommt zu den Ventilen und den Haͤhnen zuruͤk, welche
den Eintritt und den Ausgang des Dampfes in den Stiefel reguliren. Er spricht
wiederum hier von den
Vortheilen des drehenden Ventils, von welchem oben die Rede war, und welches allein
die Stelle von vier Muschelventile, oder von zwei Haͤhnen vertritt. Es macht
dabei kein Geraͤusch, und schließt immer vollkommener je laͤnger es
arbeitet. Aber dieses Ventil, so wie das Martin'sche Schiebventil oder ein einziger
zwischen dem oberen und dem unteren Theile des Stiefels, angebrachter Hahn, hat
offenbar den Nachtheil, daß es bei jedem Hub, unnuͤzerweise allen Dampf
heraus laͤßt, der sich zwischen dem Stiefel und dem Ventil vorfindet. In den
großen Maschinen bildet der, in diesem Raume enthaltene Dampf, den hundertsten Theil
derjenigen, den der Stiefel faßt; in den kleinen aber betraͤgt er den zehnten
Theil, und dieser ist nicht zu vernachlaͤßigen. Herr von Valcourt zeigt Fig. 13 bis
18. Tab.
II. mehrere Modificationen des Martin'schen Ventils an, durch welche diesem Uebel
vorgebeugt werden kann, und die zugleich den Vortheil gewaͤhren, den Dampf
nur waͤhrend einem beistimmten Theile des Laufes des Kolbens in den Stiefel
einzulassen.
Einrichtung des Kolbens.
Er beschreibt, Fig.
17 und 18, einen Kolben von Guß-eisen, der aus zwei Stuͤken
zusammengesezt ist, die sich naͤher an einander andruͤken lassen. Sie
werden durch drei Schrauben-Bolzen an einander befestigt. Der Raum zwischen
beiden wird mit Hanf gefuͤllt, so gesponnen, wie zur Seiler Arbeit, und mit
Oel und Bleyweiß durchdrungen. Auch kann man, anstatt des Hanfes zwischen den
hervorstehenden Raͤndern der Cylinder einen bleyernen, 4 oder 5 Linien diken,
Ring legen, den die Gewalt der Schrauben bald platt, und bis auf den vierten Theil
seiner anfaͤnglichen Dike, zusammendruͤkt.
Kitt fuͤr den Kessel.
Er findet den Kitt, aus Ochsenblut, Roggenmehl und Kleie sehr gut, um alles
Durchfließen des Wassers durch die Fugen des Kessels zu verhindern, aber er verbreitet einen
sehr widrigen Geruch.
Maas, fuͤr die Intensitaͤt des Dampfes. (Eprouvette à vapeur).
Er schlaͤgt, Fig. 22 und 23. eine Federwaage vor,
anstatt der Vorkehrungen mit Queksilber und comprimirter Luft, die sonst zu diesem
Zweke angewendet werden.
Besonderer Vorzug der Maschinen mit hoher Pressung.
Man braucht naͤmlich nicht, um diese in Bewegung zu sezen, so wie es mit den
Maschinen mit einfacher Pressung noͤthig ist, alle Raͤume der Maschine
durch Daͤmpfe, die man nachher condensirt, von Luft zu befreyen, wozu immer
mehr oder weniger Zeit noͤthig ist.
Schikliche Entfernung des Rostes zum Kessel.
Er erinnert an einen Versuch, den er fruͤher schon der
Aufmunterungs-Gesellschaft mittheilte, in Bezug auf die Entfernung, die
zwischen dem Roste und dem Dampfkessel statt finden muß. Er sagt, daß die beiden
neben einander liegenden Kessel der Maschine, die er in Neuorleans errichten ließ,
mit Holz geheizt wurden, daß anfaͤnglich der Rost um vierthalb Fuß vom Kessel
abstand, daß die Maschine gut gieng, daß beide Saͤgen 100 Schnitte in der
Minute machten, und jede in 3 Minuten 10 Quadrat Schuh, einschuhiger Bretter
foͤrderte, daß er einst versuchte, den Rost um 6 Zoll hoͤher zu
bringen, und daß die Maschine nunmehr, selbst beim staͤrksten Feuer, bloß
eine Saͤge in Bewegung erhalten konnte; und daß, nachdem der Rost wieder in
seine vorige Stelle gebracht worden war, beide Sagen, ihre Dienste, wie vorher
leisteten. Bei dieser Gelegenheit wuͤnscht Herr von Valcourt, daß man durch
Versuche die Entfernungen bestimme, die zu verschiedenem Brennmateriale am
schiklichsten sind. Diese Versuche wuͤrden allerdings sehr nuͤzlich
seyn, und sie ließen sich sehr leicht mit einem beweglichen Roste anstellen.
Ich erlaube mir hier die Bemerkung, daß bei verschiedenen Gelegenheiten, wo man
sowohl zu Dampfmaschinen als zu andren Zweken, unter Kesseln, die zur
Verduͤnstung des Wassers dienten, Steinkohlen von verschiedener Gattung
gebrannt hat, man die schlechteren Gattungen bloß mit Nuzen anwenden konnte, wenn
der Rost dem Kessel naͤher war.
Brigg'sche Dampfmaschine.
Hierauf beschreibt Herr von Valcourt eine Dampfmaschine die er im Jahre 1807 sahe,
und von Brigg, dreißig Stunden von New-orleans verfertigt worden war. Diese
Maschine, durch dessen hoͤlzerner Dampfkessel, eine Moͤhre von
Eisenblech gieng, hatte so wie die Savery'schen und Papin'schen, keinen polirten
Stiefel, keinen Kolben, sie hob, vermittelst der Leere, das Wasser 20 Fuß hoch, und
schuͤttete es auf ein Wasserrad, welches zwei Saͤgeblaͤtter in
Bewegung sezte; aber diese Maschine, dessen innerer Raum sich abwechselnd mit Wasser
und mit Dampf fuͤllte, brachte ungeachtet ihrer großen Einfachheit, einen
geringen Effect hervor, und sie verzehrte so viel Brennmaterial, daß man sie am Ende
auseinander nahm.
Woolf'sche Dampfmaschine.
Eine andre Maschine, die sie, meine Herrn, sehr gut kennen, zieht hierauf Herrn von
Valcourts Aufmerksamkeit an sich; naͤmlich die Woolf'sche Maschine mit hoher
Pressung und zwei Stiefeln, eine Maschine, die Edward in Frankreich
einfuͤhrte. Herr von Valcourt sahe eine solche zu Metz. Er glaubt nicht daß
es vorteilhaft sey, zwei Stiefel anzuwenden, und er sucht zu beweisen, daß von einem
einzigen Stiefel, in welchem der Dampf sich eben so, als in dem großen Woolf'schen,
ausdehnen kann, ein weit groͤßerer Effect zu erwarten sey. Ich
begnuͤge mich, gegen diese Meinung bloß zu bemerken, daß wenn der Dampf in
gleicher Menge, und unter gleicher Temperatur, in den Maschinen mit einem und zwei
Stiefeln, eine gleich große Ausdehnung erfaͤhrt, so werden in diesen beiden
Faͤllen, die Summen der bewegenden Kraͤfte, dieselben seyn; mit dem
einzigen Unterschiede aber, der indeß ganz zum Vortheil der Woolf'schen Maschine
ist, daß, bei einem einzigen Stiefel, die Ungleichheit in der Wirkung der bewegenden
Kraft groͤßer ausfallen, und folglich die Schweere des Schwungrades
groͤßer seyn muß.
In den Fig. 27
bis 31. Tab.
III. schlaͤgt Herr von Valcourt mehrere Haͤhne vor, die fuͤr
Maschinen mit zwei Stiefeln paffend seyn duͤrften.
Er beschreibt Fig.
21. einen Kessel zu einer Maschine von zwei Pferde Kraft.
Oliver Evaus Dampfmaschinen.
Er giebt die Zeichnung dieser Maschine, und theilt Oliver Evaus Patent mit, wie man
beide im 2ten Bande des Emporium of arts findet; sie
haben schon beschlossen, daß die Beschreibung dieser Maschine in ihr Bulletin
eingeruͤkt werden sollte. Er erwaͤhnt eine Bewegungs-Maschine
(Marie-Salope),
welche durch eine Dampfmaschine in Bewegung gesezt wird, und die Oliver Evaus im
Jahre 1804 zu Philadelphia aufrichtete.
Er berichtet, daß dieser beruͤhmte Mechanicus ihm einst sagte, daß in den
Colonien, wo die Sonne immer brennend ist, es nicht unmoͤglich seyn
wuͤrde, die Kessel der Dampf-Maschinen, durch eine
hinlaͤngliche Menge Brennspiegel zu heizen, wenn sie nur gehoͤrig auf
Geruͤsten befestigt, und auf einen Punkt hin gerichtet wuͤrden; ein
sonderbarer Gedanken, der an die Archimedischen und Buffonschen Spiegel erinnert,
und an verschiedene Vorkehlungen, die in aͤlteren Schriftstellern beschrieben
sind, und deren Absicht war, Wasser zu heben, mit Huͤlfe der, durch
Sonnenstrahlen erhizten Luft.
Herr von Valcourt schließt seine Denkschrift mit der Beschreibung der Volcanic Engine desselben Verfassers, Fig. 32. Diese
Maschine besteht aus einer sehr starken Kugel, die in einer groͤßeren
eingeschlossen ist. Die innere ist mit einem Roste versehen, und dient zum Heerde;
sie ist hermetisch geschlossen, und in Verbindung mit dem Rohre eines
Geblaͤsses. Die darin stark comprimirte Luft verbrennt das Brennmaterial mit
großer Lebhaftigkeit. Diese mit Rauch vermischte Luft, hebt ein nach oben hin
angebrachtes, und von dem Wasser bedektes Ventil, welches die zwei Drittel, oder die
drei Viertel des Raumes der anderen Kugel anfuͤllt. Nach der Aeußerung des
Erfinders, macht diese Vorkehrung eine große Wirkung, und erspart vieles
Brennmaterial: allein alle die damit angestellten Versuche sind bis jezt ohne Erfolg
geblieben.
Schluß.
Das ist der Bericht, den ich uͤber die von Valcourt'sche Denkschrift
abzustatten hatte. Ich bin vielleicht in ein zu kleinliches Detail eingegangen. Ich
habe es noͤthig geglaubt, um sie besser in den Stand zu sezen, die
mitgetheilten Angaben zu wuͤrdigen, und worunter die meisten ihnen, so wie
ihrem Comite die Bekanntmachung in ihrem Bulletin zu verschieden scheinen
werden.
Angenommen in der Sizung,
am 21. Maͤrz 1821.
Baillet, Berichterstatter.
Beschreibung verschiedener der Aufmunterungs-Gesellschaft von Hrn. von Valcourt mitgetheilten, und Tab. II. und III. vorgestellten Dampfmaschinen.
Tab. II. Fig.
2. Durchschnitt der Maschine des Herrn von Valcourt.
Fig. 3.
Durchschnitt der Wasserzuleitungs-Pumpe, nach groͤßerem Maasstabe.
Der in den beiden Kesseln aa
Fig. 2.
gebildete Dampf steigt durch die Verbindungsroͤhre b und oͤffnet das regulirende Ventil c. Von dem Einlaßhahn
d aufgehalten, den man sich geschlossen denken muß,
kehrt er zuruͤk, hebt das Ventil e, um durch die
Roͤhre h in den Rauchfang f zu ziehen, eine nothwendige Vorkehrung, ohne welche das ganze
Gebaͤude sich mit Daͤmpfe anfuͤllen wuͤrde. Alsdann wird
der Einlaßhahn d geoͤffnet, und das
Sicherheitsventil schließt sich von selbst, weil der Dampf durch das Rohr i einen Ausgang findet, um in die mit einem Ventil
versehene Kammer j zu treten, die mit einem Dekel d'' geschlossen ist. In dieser Kammer ist eindrehendes
Ventil, welches man Fig. 7 bis 12. Tab. II. nach einem
groͤßeren Maaßstabe bezeichnet sieht.
Indem der Dampf durch die Oeffnung k dieses Ventils
durchgeht, ergießt er sich in den Canal 1, dringt unter den Kolben, und treibt ihn
bis zur Haͤlfte seines Hubes hinauf. Der Dampf der uͤber dem Kolben
war, geht durch den Canal m, und durch die Roͤhre
n in den inneren Raum des Ventils o, findet hier die Oeffnung p, und entweicht durch die Roͤhre q,
die entweder mit dem Condensator, oder mit dem zu waͤrmenden Wasser in
Verbindung ist. r, ist ein großer Hebel, der die
Kolbenstange s nach oben hin, vollkommen senkrecht,
bewegt. Dieser Hebel haͤngt an dem Traͤger a'' vermittelst eines buͤgelfoͤrmigen Bolzen, gleich dem in
c'', an welchem die Leitstange l' haͤngt. Diese Vorkehrung ist Fig. 24, 25, 26. Tab. III., nach einem
groͤßeren Maaßtabe gezeichnet. Der Bau dieses Hebels beruht auf dem
Grundsaze, daß alle Punkte des Umganges eines Kreises vom Mittelpunkte desselben
gleich weit abstehn. Wenn man daher einen Kreis auf einer durchaus graden Linie
waͤlzt, so wird das Centrum eine Parallele zu jener beschreiben. Nun aber
wird die Linie tu der gezahnten Stange als
vollkommen grade angenommen; der Kreisbogen vx,
der von dem Punkte a' aus, als Mittelpunkt der Bewegung,
gezogen wird, waͤlzt sich auf dieser Linie; folglich beschreibt der Punkt a' eine Parallele zu tu,
naͤmlich eine grade Linie. Die Zaͤhne an dem Kreisbogen, welche in die
Zaͤhne, an der gezahnten Stange, eingreiffen, haben bloß zu Absicht, das
Fortruͤken dieses Endes des Hebels zu verhindern; aber an jeder Seite dieser
Zaͤhne liegt ein Bakenstuk, vom Punkte a' aus,
ebenfalls kreisfoͤrmig gezogen, welches gegen gradlinigte Bakenstuͤke
anrollt, die an den beiden Seiten der gezahnten Stange anliegen.
Damit der Hebel r keinen Zahn loslasse, ist an seinem
entgegensezten Ende eine kupferne Rolle b' angebracht;
ihr aͤußerster Rand bewegt sich an einer eisernen etwas gekruͤmmten
Platte, c' d' die an einem senkrechten Traͤger
e' befestigt ist. Um diese Linie zu ziehen, muß der
Hebel r in drei verschiedenen Stellen seines Laufes
gestellt werden, naͤmlich am Anfange, am Ende, und in der Mitte desselben, in
g' f', gestellt werden, Positionen, welche durch
punktirte Linien angezeigt sind; man zieht alsdann die gedachte Curve durch diese
drei Punkte i' f' h'. Das Schwungrad k muß nach der vom Pfeile bezeichneten, Richtung sich
drehen, um die Reibungen der Rolle b' zu vermeiden, und
damit der Hebel immer nach der Seite der gezahnten Stange hin gehalten werde.
Der Verfasser hat hier die Kraft, oder die Stange des Kolbens s, zwischen der Last oder dem Widerstande, oder der Leitstange l' des Schwungrades, und dem Ruhepunkte vx gestellt, und so einen Hebel der dritten Klasse
gebildet. In diesem Falle ist der Arm der Kurbel y
groͤßer, als der halbe Hub des Kolbens. Man koͤnnte aber diese Ordnung
veraͤndern, um einen Hebel von der zweiten Klasse zu bekommen, indem man den
Kreisbogen vx links anbrachte; dann wuͤrde
der Arm der Kurbel geringer seyn, als der halbe Hub des Kolbens.
Am Baume der Kurbel und des Schwungrades ist ein Winkelrad (roue d' angle) m', welches in ein anderes
Winkelrad n' eingreift. Dieses Rad bringt, vermittelst der Stange
o', ein drittes Rad p'
in Bewegung. Dieses lezte greift in das Rad g', welches
der Achse r' des drehenden Ventils befestigt ist, von
welchem oben die Rede war. Da die Raͤder m' und
n', wie auch die Raͤder p und q eine gleich große
Anzahl Zaͤhne haben, so dreht sich die Achse r'
des Ventils eben so oft um, als das Schwungrad k', und
als der Kolben s Hube macht. Ein Hub ist der Hin-
und Hergang des Kolbens. An der Achse r' hat der
Erfinder einen Moderator mit excentrischen Kugeln ss angebracht, welcher das Oeffnen und Schließen des Zulaßhahnes d, vermittelst der gebrochenen Stange z, regulirt. Man weiß, daß dieser Moderator
uͤberall, wo man will, angebracht, und ihm die Bewegung vermittelst Strike
und Rollen mitgetheilt werden kann.
Wenn man einen Condensator anbringt, so muß er unmittelbar mit der
Entladungsroͤhre q in Verbindung gesezt werden,
so wie es in Fig.
2. Tab. II. statt findet. Ist die Maschine aber klein, das heißt,
hoͤchstens von 15 Pferdekraft, hat man keinen Ueberfluß an kaltem Wasser,
steht die Maschine an einem Orte, wo warm Wasser noͤthig ist, und wo große
Saͤle und Werkstellen geheizet werden muͤssen, so ist es besser ohne
Condensator, und mit dem bloßen elastischen Dampfe zu arbeiten, und ihn nachher zur
Erwaͤrmung des Wassers, und zur Heizung des Locals anzuwenden.
In diesem Falle stellt Hr. v. Valcourt einen Kessel t'
Fig. 3. an dem
Ort wo die Flamme den (oder die) Kessel verlaͤßt. Ein Flintenlauf u', der von dem Boden dieses Kessels ausgeht,
fuͤhrt das kalte Wasser, welches hinaufgepumpt wird, und sich hier etwas
erwaͤrmte, zu der Zuleitungspumpe v', die nach
einem doppelten Maasstabe, zur besseren Einsicht ihrer Theile, gezeichnet worden
ist. Ihr Kolben z' wird durch den großen Hebel r in Bewegung gesezt. Bei jedem Gang des Hebels, treibt
diese Pumpe, in die
Dampfkessel, eben so viel Wasser hinein, als Wasser verdampfte. Wenn man aber dieses
Wasser unmittelbar zufuͤhren wollte, so wuͤrde es kalt hinein kommen,
und einen Theil des darin enthaltenen Dampfes condensiren. Um dieses zu verhindern
bediente sich Herr von Valcourt der in einander geschraubten Flintenlaͤufe,
die von der Zuleitungspumpe ausgehen, in den Heerd x',
auf einem 12 Schuh langen Raum, unter den Kesseln, fortlaufen, dann den Heerd
verlassen, und vermittelst eines Buges, in dem Hinteren Theile der Kessel sich
oͤffnen, so daß das Wasser dahin in Dampfgestalt und sehr heiß gelangt. Der
Verfasser bemerkt, daß der Kessel t' nicht durchaus
nothwendig ist, und daß das kalte Wasser unmittelbar aus dem Brunnen
zugefuͤhrt werden kann.
Er hat sich folgenden Mittels bedient, um die Menge des kalten Wassers zu bestimmen,
welches die Zuleitungspumpe, bei jedem Stoße des Kolbens, dem Kessel
zufuͤhren muß. Dazu dienen zwei Baͤume, e''
f'', die an der Deke befestigt sind, und zwischen welchen sich der Hebel
a'' bewegt, der an dem großen Hebel, durch den
Bolzen b'' befestigt ist, von welchen wir oben (Seite
150.) gesprochen haben. Das vordere Ende des Hebels a''
haͤlt an der Stange z' des Kolbens der
Zuleitungspumpe, durch einen Bolzen g''; das
entgegengesezte Ende, haͤlt an den beiden Balken, durch einen Zapfen h''. Diese beiden Balken, und der Hebel a'', sind mit einer Reihe Loͤcher durchbohrt, wie
es die Figur zeigt. Es ist klar, daß wenn der Zapfen h''
dem Punkte f'' naͤher ist, die Stange z' einen groͤßeren Raum durchwandert. Das
Gegentheil findet statt, wenn der Zapfen h'' gegen e'' zuruͤkgestellt wird. Die Menge des Wassers,
welche die Pumpe jedesmal liefert, haͤngt von der Laͤnge des Hubes
ab.
Der Stiefel der Zuleitungspumpe v' ist nicht polirt, weil
der Kolben die Seitenwaͤnde desselben nicht beruͤhrt. Dieser Kolben
ist laͤnger als der Koͤrper der Pumpe selbst, er geht durch eine Wergbuͤchse
i''. Beim Bau dieser Pumpe, muß man darauf sehn, daß
die Ventile j'' und k'' dem
aͤußersten Ende des Kolben so nahe zu liegen kommen als moͤglich.
Die Stange des Ventils c, welches zum Regulator bei
Dampfes dient, traͤgt an seinem aͤußersten Ende eine kleine
Hebelstange l'', mit einem verschiebbaren Gewichte m'', dem man die Stelle giebt, welche der Kraft, mit
welcher die Maschine arbeiten soll, angemessen ist, der Dampf muß es heben, in dem
Augenblike, wo er aus dem Kessel tritt. Das Sicherheits-Ventil e ist auch mit einem Gewichte n'' belastet. Dieses lezte ist schwerer als das erstere, an dem
regulirenden Ventile e. Damit diese Gewichte nicht
verruͤkt werden, liegt eine kleine Stange o''
uͤber die eingekerbte Stange, an welcher das Gewicht haͤngt. Sie
haͤlt an derselben durch ein Charnier, und wird, vermittelst eines
Vorhangschlosses, angeschlossen. Den Schluͤssel behaͤlt der Vorsteher
des Instituts. In q'', uͤber dem Ventil e', sieht man diese Stange gehoben.
Sobald der Dampf nicht mehr die noͤthige Kraft aͤußert, schließt sich
das regulirende Ventil von selbst. Dann legt man auf die Felge des Schwungrades eine
Platte r von Gußeisen, so daß die Bewegung
aufhoͤrt, wenn die Kurbel die senkrechte Linie etwas uͤberschritten
hat. Dazu hilft das Gewicht des Hebels r, der die
Leitstange l' nach unten zu haͤlt. Durch diese
Einrichtung bekommt das drehende Ventil o eine solche
Stellung, daß der Dampf auf den untersten Theil des Kolbens druͤkt, sobald er
stark genug geworden ist, das Ventil c zu heben. Der
Nuzen dieses Ventils wird besonders fuͤhlbar, fuͤr die Kessel welche
bestimmt sind, das Wasser mit Daͤmpfen zu waͤrmen. Denn wenn man den
Dampf entweichen laͤßt, allmaͤhlich wie er erzeugt wird, so wird er
weder die Kraft, noch die Waͤrme haben, die er durch jenes Mittel, einige
Augenblike spaͤter, erhalten haͤtte.
Tab. II. Fig. 2, 3 und 4. Herrn Valcourt's zweite Maschine.
Der Stiefel dieser Maschine haͤlt im Durchmesser 7 1/2 Zoll, und ihr Hub ist 2
Schuh lang. Alle Ventile sind Muschel-Ventile. Ihr Spiel ist folgendes. Das
Einlaß-Ventil A bleibt mehr oder weniger offen,
je nachdem die Staͤrke des Dampfes ist. Die Ventile BC lassen den Dampf herein, und die Ventile DE lassen ihn heraus. Alle vier werden durch die
an der Welle F befestigten Nasen JJKL geoͤffnet. Die Nasen JJ fuͤr die Einlaßventile sind so gemacht,
daß diese Ventile sich schließen, so bald der Kolben die Mitte seines Hubes erreicht
hat; deshalb haben sie die in Fig. 4. gezeichnete
Gestalt. Da die Nasen KL der Ventile, die den
Dampf heraus lassen, diese Ventile, durch die ganze Dauer des Hubes offen halten
muͤssen, so sind sie, wie Fig. 3. zeigt,
eingerichtet. Ist der Kolben G auf dem Boden seines
Stiefels, so sind die Ventile CD offen, und die
beiden anderen geschlossen. Oeffnet man nun das Einlaßventil A, so folgt der Dampf,
der den Weg B verschlossen findet, die Roͤhre M, und tritt durch C unter
den Kolben G, und da er nicht in E, welches geschlossen ist, herein kann, so uͤbt er seine Gewalt
gegen den Kolben aus, und treibt ihn in die Hoͤhe. Der Dampf, der
uͤber dem Kolben befindlich ist, kann durch B,
welches immer geschlossen bleibt nicht durch, findet aber das Ventil D offen, und geht durch die Roͤhre N in den Condensator O;
sobald der Kolben G an der Mitte seines Laufes ist, so
laͤßt die Nase J,
Fig. 4. das
Ventil C los, dieses schließt sich, und der Dampf, der
sich nunmehr in dem Stiefel ausdehnt, vollendet durch seinen fortgesezten Druk, den
Hub.
Sobald der Kolben den obersten Theil seines Stiefels erreicht hat, so wird die
ununterbrochene Bewegung des Schwungrades der Welle F
mitgetheilt, und die Nase L, laͤßt nun das Ventil D los, und es schließt sich. In demselben Augenblike
oͤffnen die Nasen J und K die Ventile B und E; der Dampf, der nun C geschlossen und B geoͤffnet findet, dringt durch dieses lezte
Ventil, und da auch D geschlossen ist, so druͤkt
er auf den Kolben A, und treibt ihn herunter. Der Dampf,
der unter dem Kolben ist, und C geschlossen, aber E offen findet, geht durch dieses lezte Ventil heraus;
da er aber nicht durch N hinaufsteigen kann, weil D geschlossen ist, so nimmt er seinen Weg durch die
Roͤhre U nach dem Condensator O hin. Hat der Kolben die Mitte seines Laufes erreicht,
so laͤßt die Nase J das Ventil B fallen, und die elastische Kraft des Dampfs treibt ihn
bis zum Ende desselben.
Der Dampf der bei jedem Hube zum Condensator O gelangt,
trift dort einen Strahl kalten Wassers an, den eine daruͤber stehende Rinne
dahin fuͤhrt, und der sich in den Condensator durch die, mit einem
Sprizenkopfe d versehene Roͤhre V, ergießt. Dieses Wasser, welches herunter regnet,
condensirt den Dampf, der in dieser Gestalt, und in warmes Wasser verwandelt, nur
noch einen sehr kleinen Raum des Condensators einnimmt. Eine Saugpumpe x schafft nun das eingespruͤzte, und das aus dem
Dampfe gebildete Wasser weg; ohne welche Vorsicht der Condensator bald voll seyn
wuͤrde. Der Kolben R dieser Pumpe ist hohl, und
fuͤhrt zwei Klappen 1, 2; geht er hinauf, so bildet sich unter ihm ein leerer
Raum, der sich mit dem Wasser des Condensators O
fuͤllt, welches die Klappe Q oͤffnet. Wenn
der Kolben herunter geht, so schließt sich diese Klappe, und verhindert die
Ruͤkkehr des Wassers in den Condensator. Das Wasser geht nun durch den Kolben
R durch, und wird vermittelst der doppelten Klappe,
die sich mit jedem Hub schließt, hinauf, und durch die Klappe S heraus geschaft.
Die Saugpumpe x liegt gewoͤhnlich dicht mn
Condensator O und die Klappe Q zwischen beiden; hier aber sind sie getrennt, damit man zu der Klappe,
wenn es noͤthig ist, leichter kommen kann, was hier geschieht, indem man die
Platte T weg hebt.
Fig. 5 und 6. Dampfmaschine des Herrn West.
In der Maschine des Herrn West, zu Lexington, waren zwei rechtwinklich durchbohrte
Haͤhne y, z. Fig. 5. an der Stelle der
vier Ventile B, C, D, E. Mit jedem Hube macht der
Auslaßhahn, eine Viertel Umdrehung, um den Dampf herauszulassen, waͤhrend der
Einlaßhahn zwei Achtel Bewegungen macht. Wenn der Kolben am Ende seines Laufes ist,
wie man es Fig.
5. sieht, so geht der Dampf, durch den Hahn y
uͤber den Kolben, den er herunter treibt. Sobald aber der Kolben in die Mitte
des Stiefels gekommen ist, so giebt eine Achtel-Bewegung dem Hahn y, die Stelle, welche in Fig. 6. zu sehen ist,
wodurch der Dampf weder uͤber noch unter dem Kolben dringen kann. Ist dieser
bis unten im Stiefel gelangt, so laͤßt eine neue Achtel-Bewegung des
Hahnes y den Dampf unter den Stempel, und so
umschichtsweise.
Fig. 7. 8. 9. 10. 11 und 12. Scheiben-Ventile oder drehende Ventile, von Oliver Evaus, nach einem doppelten Maaßstabe.
Das Scheibenventil oder das drehende Ventil von Oliver Evaus, von welchem wir oben
Seite 150. gesprochen haben, verrichtet die Dienste der vier Ventile B, C, D, E. Fig. 2. und der beiden
Haͤhne Fig.
5. Fig.
7. ist der Grundriß der Buͤchse in welcher das Ventil sich dreht:
wir haben diese Buͤchse durch den Buchstaben J,
Fig. 1. Tab.
II. bezeichnet, und der Deutlichkeit wegen, werden wir hier zu denselben
Gegenstaͤnden dieselben Buchstaben beibehalten. Fig. 8. ist der
Durchschnitt des Ventils; Fig. 9. ist dieses Ventil
von unten gesehen; Fig. 10.
dasselbe von oben gesehen; Fig. 11. ist der
Regulator von dem Ventil getrennt; Fig. 12. das Zifferblatt,
welches anzeigt, ob der Durchzug des Dampfes bei dem Achtel-, dem
Viertel-, dem Drittel-, oder dem halben Hube gehemmt ist.
Da der gaͤnzliche Umlauf des Ventils Fig. 3. die Bewegung des
Kolbens auf und abwaͤrts hervorbringt, so wird die Oeffnung k, Fig. 10. mit der Oeffnung
k, Fig. 7. bloß
waͤhrend einer Viertel-Umdrehung zusammentreffen, damit der Dampf
aufgehalten werde, sobald der Kolben seinen halben Lauf vollendet haben wird. Bey
der zweiten Viertel-Umdrehung wird der Regulator Fig. 11. die Oeffnung k deken. Diese halbe Revolution wird dem Dampfe, der in
dem hohlen Theile o des Ventil eingeschlossen ist,
gestatten, durch die Oeffnung p
Fig. 7. zu
entweichen.
Wenn der Kolben den obersten Theil des Stiefels erreicht, vollendet das Ventil die
Haͤlfte seines Umlaufes die Oeffnung k, Fig. 10,
welche alsdann mit der Oeffnung n
Fig. 7.
zusammentrift, laͤßt den Dampf durch die Roͤhre n, und den Canal m durchziehen, und der Kolben
wird heruntergedruͤkt werden. Der Dampf der unter dem Kolben war, ergießt
sich in den Canall; an der Oeffnung k, findet er den
hohlen Theil des Ventils o, von welchem er durch die
Oeffnung p sich in die Roͤhre q begeben kann.
Man schließt mehr oder weniger die Oeffnung k, Fig. 9 und 10.
vermittelst des Regulators b'', je nachdem man mehr oder
weniger Dampf verlangt, wenn der Kolben, den achten, den dritten, oder den vierten
Theil seines Laufs erreicht hat. Die Welle r,
Fig. 2. Tab.
II., welche gebogen, und vermittelst dieser Beugung mit dem Ventil vereinigt ist,
theilt demselben ihre Bewegung mit. Die hohle Achse, a'',
Fig. 8, die an
dem Regulator b'' befestigt ist, stekt lose auf der
Welle r'. Oben, an dieser hohlen Achse, ist eine runde
Platte c'' die einen Zeiger e'',
und einen kleinen Zapfen d'' traͤgt, der durch
eine andere, an der Welle r'' befestigte Platte, Fig. 12. geht,
und in welcher ein kreisfoͤrmiger Einschnitt gemacht ist, in welchem jener
Zapfen d'' sich bewegt, wenn man die Stange a'' und den Regulator b''
umdreht. Vermittelst der an diesem Zapfen befindlichen Schraubenmutter, werden die
beiden Platten naͤher an einander gebracht. Alsdann zeigt der Zeiger e'', an den Einteilungen des Zifferblattes, Fig. 12, in
welcher Stelle des Laufes des Kolbens das Eintreten des Dampfes verhindert wird.
Ohne die hohle Achse a'', muͤßte man den Dekel
h''
Fig. 2. Tab.
II. des Ventils wegheben, wenn man mehr oder weniger, nach Beduͤrfniß, den
Regulator schließen wollte, so aber, braucht man nur die Mutter am Zapfen a'' zu loͤsen, und die untere Platte c'' zu drehen, damit der Zeiger e'' den verlangten Theil des Hubes anzeige, und dann die Schraube wieder
anzuziehen.
Das Scheibenventil ist von Gußeisen; seine untere Flaͤche muß sehr glatt seyn,
und damit man der Muͤhe uͤberhoben werde, die Buͤchse Fig. 7, zu
drehen, bringt Herr von Valcourt auf dem Boden derselben eine andere kleine
kupferne, 1/4 Zoll hohe Buͤchse an, welche 3, mit den Oeffnungen n, p, k zusammentreffende Oeffnungen hat. In dieser
lezten Buͤchse dreht sich das Ventil, Fig. 8.
Der Vortheil dieses Ventils besteht darin, daß es aͤußerst einfach ist, daß es
kein Geraͤusch, und seine Verrichtungen sehr genau macht, aber es veranlaßt,
bei jedem Hube, einen unnuͤzen Verlust an Daͤmpfen. Um diesem Uebel
vorzubeugen hat Herr von Valcourt das Schiebventil (Soupape
à tiroir) folgendermaßen geordnet, Fig. 13, 14, 15 und 16.
Fig. 13, 14, 15 und 16. Schieb-Ventil.
Wenn der Kolben an den lezten Punkt seines Laufes gekommen ist, Fig. 16, so steht das
Schiebventil, so wie diese Fig. es anzeigt. Der Dampf geht durch die Oeffnung A, und treibt den Kolben herunter. Zu gleicher Zeit geht
der Dampf, der sich oberhalb befindet, durch die Oeffnung B' in das Innere C' des Ventils, und durch den Canal D' der sich in dem Condensator, oder in dem Wasser
oͤffnet, welches man erwaͤrmen will. Hat der Kolben die Mitte des
Stiefels erreicht, Fig. 15, so hebt man das Ventil C' alsdann
bedekt dessen flacher Theil den Canal A'; aber der
Dampf, uͤber dem Kolben, faͤhrt fort sich durch den Canal B' in das Ventil C' und den
Canal D' zu ergießen, bis daß der Kolben ganz herunter
gedruͤkt ist. Diese Bewegung wird durch die Expansion des Dampfes
uͤber dem Kolben, beguͤnstigt. Man kann also das Ventil, an jedem
beliebigen Theil des Laufes des Stempels schließen, je nachdem die Kraft ist, die
man verlangt. So bald der Kolben wieder herunter ist, so gestattet das Ventil, indem
es die Stellung, Fig. 14, wieder einnimmt, dem Dampfe, sich durch die Oeffnung B' zu unter den Kolben zu begeben, den er hinauftreibt.
Der unter dem Kolben befindliche Dampf muß durch die Oeffnung A', in das Innere der Ventils C' und von dort
durch D' herausgehen. Endlich wenn der Kolben die Mitte
seines Laufes erreicht hat, so laͤßt die Nase das Ventil fallen, und schließt
so die Oeffnung B'. Diese Stellung sieht man Fig. 13. Dann
vollendet der Dampf, durch seine Expansivkraft den Hub des Kolbens, und so
umgekehrt.
Man koͤnnte das Schiebventil, welches fast die ganze Laͤnge des Kolbens
einnimmt, durch ein kleineres ersezen, wie z.B. in E'
Fig. 17, oder
durch zwei Ventile F'F', Fig. 18. Diese
Vorrichtung scheint Anfangs zusammengesezter aber die beiden Nasen, welche die
Ventile F'F' in Bewegung sezen, sind einfacher als
die Scheibenventile, die, in einer einzigen Revolution, der Achse G' des
großen Ventils Fig.
12, vier Bewegungen mittheilt.
Fig. 17 und
18.
Kolben aus zwei Stuͤken.
Der Kolben H' besteht aus zwei Stuͤken, die man
vermittelst drei kleinen Schrauben-Bolzen (boulons
à écrous) nach Belieben naͤhern kann. Die Fig. 17. zeigt
das eine Stuͤk, und die Fig. 18. das andere. Der
Raum, zwischen beiden Theilen, wird mit gesponnenem, von einer aus Oel und Bleiweiß
bereiteten Mischung, durchdrungenem Hanfe, gefuͤllt. Zwischen beiden
Raͤndern der verschiedenen Theile der Dampfmaschine legt unser Verfasser
bleierne Ringe, welche die Gewalt der Schrauben bis zum vierten Theile ihrer
urspruͤnglichen Dike zusammendruͤkt.
Fig. 19.
nebeneinander liegende Kessel.
Herr von Valcourt bedient sich zwei cylindrischer neben einander liegender Kessel,
von einem drittehalb Linien diken Eisenbleche. Jeder Kessel haͤlt 12 Fuß in
der Laͤnge, und 2 Fuß im Durchmesser. Um die Hize, so viel wie
moͤglich, zu benuzen, wird in den inneren Raum ein Cylinder bb, ebenfalls aus Eisenblech, von einem Fuß im
Durchmesser angebracht, durch welchen die Flamme zu ziehen, gezwungen ist.
Auf diese Weise bekommt man 1) eine Maße Wasser, 3 bis 6 Zoll dik, welche von zwei
Seiten von der Flamme beruͤhrt ist, und diese durchzieht einen 24 Fuß langen
Raum, ehe sie in den Rauchfang e entweicht. 2) Eine
Oberflaͤche von 144 Quadratfuß, die dem Feuer ausgesezt ist; wodurch man eine
sehr hohe Temperatur erhalten kann, ohne betraͤchtliche Vermehrung des
Brennstoffes. Das Sicherheitsventil, an diesen Kesseln, traͤgt auf jeden
Quadratfuß ein 120 Pfd. schweres Gewicht.
Fig. 20.
Luftventil.
Am aͤußersten Ende dieser Kessel befindet sich ein kleines Ventil s'',
Fig. 20,
welches sich, nach Innen zu, oͤffnet, um Luft hereinzulassen. Ein kleines, am Ende des Hebels 3
haͤngendes Gewicht r'' schließt dieses Ventil,
und der Druk der Daͤmpfe traͤgt mit dazu bei, so bald aber im Inneren
die Luftleere entsteht, oͤffnet es die aͤußere Luft, wie es die
punktirten Linien zeigen; so bald die Luft den leeren Raum gefuͤllt hat,
schließt sich das Ventil von selbst.
Fig. 21.
kleinere Kessel.
Der Verfasser schlaͤgt zu Kesseln zu einer Dampfmaschine, von der Kraft eines
oder zwei Pferde, einen Fig. 20. vorgestellten
Kessel, in der Gestalt zwei abgestumpfter Kegel x'' y'',
die in einander stehen, und deren inneren Waͤnde 4 Zoll von einander entfernt
sind. Beide tragen einen gewoͤlbten Dekel, und diese Dekel stehen 7 Zoll von
einander ab. Zwischen beiden Kegeln bringt man 4 Roͤhren z'' an, durch welche der Rauch durchzieht, und unten am
Kegel im einen Rauchfang entweicht. Der Ofen verzehrt seinen Rauch und wird mit
Steinkohlen geheizt; w'' ist ein gußeiserner Cylinder;
er ist auf dem Boden befestigt, und dient zum Aschenbehaͤlter. Auf diesem
Cylinder schraubt man den Kessel an, der mit einem metallenen Mantel umgeben ist, um
die Hize besser zusammen zu halten. Man sieht die Art, wie das Sicherheitsventil 4
gestellt werden muß; es sich uͤber das Ventil 5, welches die Kraft des
Dampfes regulirt. Die Stange dieses lezten bewegt sich sanft in dem
Sicherheitsventil, durch dessen Mitte sie durchgeht. Man koͤnnte den Raum
zwischen den beiden halbsphaͤrischen Dekeln erweitern, und den Cylinder 6
darin anbringen. Die Grundflaͤche desselben wuͤrde an der inneren
Halbsphaͤre befestiget werden, wie es die punktirte Linie zeigt, und er
wuͤrde sich solchergestalt in dem Dampfe selbst befinden, aber Herr von
Valcourt, der groͤßeren Festigkeit wegen, stellt lieber diesen Cylinder neben
den Kessel.
Das beste Mittel nach ihm, den Stand des Wassers im Kessel zu erkennen, ist das
von Prony angegebene. Es besteht in einer glaͤsernen Roͤhre t''
Fig. 24,
welche zwischen zwei in Winkelhaken gebogenen metallenen Roͤhren stekt, von
welchen die eine u'' mit dem oberen Theile, und die
andere v'', mit dem unteren Theile des Kessels in
Verbindung steht. Da der Dampf durch u'' und das Wasser
durch w'' in diese Roͤhre dringt, so sieht das
Wasser darin eben so hoch als im Kessel. Herr von Valcourt hat dicht an dem Bug
derselben zwei kleine Haͤhne 7, 7 angebracht, die man verschließt, wenn die
Roͤhre brechen sollte.
Fig. 22 und
23.
Dampfmesser mit Federn.
Um die Drukkraft des in dem Kessel enthaltenen Dampfes zu messen, bedient man sich
gewoͤhnlich einer, in Form eines Barometers, gebogenen Glasroͤhre,
worin man Queksilber gießt. Der Dampf, indem er auf das Queksilber druͤkt,
treibt es in die Hoͤhe. Aus den Barometern vertreibt man sorgfaͤltig
alle uͤber dem Queksilber vorhandene Luft, in diesem Instrument aber ist die
Gegenwart der Luft nothwendig. Diese Luft ist die federnde Kraft; sie wird um so
mehr zusammengedruͤkt, um so wirksamer der Dampf ist. Eine, laͤngs der
Glasroͤhre angebrachte, Scale zeigt die Groͤße des Drukes. Herr von
Valcourt glaubt, daß er mit einer Federwage, dasselbe leisten koͤnnte. Man
sieht diese Vorkehrung Fig. 22 und 23, hier von
vorne, dort von der Seite betrachtet. Desto mehr der Dampf auf den Kolben J' druͤkt, desto staͤrker druͤkt
dieser gegen die Feder J' K' ist der Zeiger, der die
Groͤße des Drukes an dem Kreisbogen L anzeigt.
Die Eintheilung wird vorher durch wuͤrkliche Gewichte bestimmt. Die Fig. 24, 25 und 26. stellen
das Detail des Mechanismus vor, durch welchen die Leitstange l' des Schwungrades k',
Fig. 2. Tab.
II. an den großen Hebel r befestigt wird: man sieht, daß
drei Stuͤke dazu noͤthig sind. Der obere Theil der Fig. 24. der durch den
Hebel r geht, ist ein vierekiger Bolzen, M', mit
einem Schraubengewinde, an dem einen Ende versehen; das andere Ende das ebenfalls
vierekig ist, ist in Gestalt eines Hakens gebogen. Dieser Bolzen geht durch das
Eisenblech N',
Fig. 26. und
das um gebogene Ende stoͤßt hart an diese Platte an. Der untere Theil O',
Fig. 25. hat
ein vierekiges Loch, durch welches der gebogene Theil des Bolzens, Fig. 24. durchgeht. Die
Eken desselben sind nach oben zu gebrochen, und die Oeffnung gerundet. Wenn durch
vieles arbeiten die Stuͤke abgenuzet sind, so daß etwas Schwanken statt
findet, so feilet man bloß das gebogene Ende dieses Bolzens ab, damit es wieder hart
an die eiserne Platte Fig. 26. stossen
kann.
Fig. 27, 28, 29, 30 und 31.
Haͤhne zu einer Maschine mit zwei Stiefeln.
Herr von Valcourt ist bemuͤht gewesen, den Hahn mit sieben Oeffnungen der
Edward'schen Maschine, zu vereinfachen, welche den Dampf von dem Raume uͤber
dem Kolben des kleinen Stiefels in den Raum unter dem Kolben des großen Stiefels
leitet, und vice versa. (Man siehe polytechn. Journal.
Bd. 1. S. 129. u. f.).
Er glaubt, man koͤnne ihn durch den Hahn, Fig. 27, 28, 29, 30 und 31. ersezen, der bloß
vier Oeffnungen oder zwei Loͤcher hat, und der dasselbe leistet. Er
laͤßt in den kleinen Stiefel A den Dampf ein, der
vom Kessel durch den Hahn B kommt. Die Zeichnung dieses
Hahnes ist, der Einfachheit wegen, wie die des Hahnes Z,
Fig. 5.
entworfen. In der Edward'schen Maschine sind hier zwei Ventile. Der Hahn B laͤßt den Dampf durch die Roͤhre C in den Raum unter dem Kolben des kleinen Stiefels. Der
Dampf, in dem Raum uͤber diesem Kolben, wird durch die Roͤhre D, und die Oeffnung EF, die durch den neuen Hahn geht, herausgelassen. Herr von Valcourt rundet
diese Oeffnung ab, um fuͤr die Oeffnung GH,
Fig. 31.,
welche in dem Hahne, der Laͤnge nach, fortlaͤuft, und durch ihr aͤußerstes Ende H, den Dampf, vermittelst der Roͤhre J, in den Condensator leitet, mehr Raum zu erhalten.
Nachdem der Dampf durch EF, Fig. 27. durchzog, zieht
er weiter, durch die Roͤhre J, die ihn in den
Raum uͤber den großen Kolben N fuͤhrt,
welcher zugleich mit dem kleinen Kolben steigt. In demselben Augenblike,
laͤßt die Oeffnung G, welche die Oeffnung GH, Fig. 31. ist, den Dampf,
der in dem Raume uͤber dem großen Kolben war, durch die Roͤhre J in den Condensator. Beim Ruͤkgang der Kolben
stellt sie eine Viertel-Bewegung des Hahnes, wie Fig. 28. es zeigt, an
welcher man sieht, daß der Dampf, der sich in dem Raume unter dem kleinen Kolben
befand, durch den Hahn durchzieht, um zu dem Raume, uͤber dem großen Kolben
zu gelangen, und der Dampf, der unter dem großen Stempel war, begiebt sich, durch
die Oeffnung G in den Condensator.
Die Fig. 32.
stellt eine Dampfmaschine vor, welcher die Englaͤnder den Namen Volcanie
Engine gegeben haben. Oliver Evaus hat sie erfunden. Eine starke Kugel P' oder ein starker Cylinder, enthaͤlt eine
zweite Kugel oder einen zweiten Cylinder Q' in welchem,
auf einem Roste, das Brennmaterial liegt. Man bringt es, durch eine Thuͤre
herein, die hermetisch verschlossen wird. An der Roͤhre T ist ein Geblaͤse angebracht, welches von unten
her Luft durch das Brennmaterial treibt. Da die Kugel sich solcher Gestalt bald mit
Luft fuͤllt, so verdichtet sich diese nach und nach darin, bis sie Kraft
genug bekommt, das Ventil U' zu heben, welches, bis zur
punktirten Linie, mit Wasser bedekt ist.
Da die Elasticitaͤt der Luft die Schwere des Wassers uͤberwiegt, so
kann kein Wasser durch dieses Ventil in die Kugel; und im entgegengesezten Falle,
wuͤrde der Druk des Wassers das Ventil von selbst schließen. Diese durch den
Heerd durchgezogene, sehr warme, mit Rauch vermischte, Luft, wollte Evaus durchs Wasser
ziehen lassen, um solcher Gestalt alle entwikelte Waͤrme zu benuzen.
Die Fig. 33.
stellt das Mittel vor, welches in Savoyen, in den Salzwerken zu Moutiers, angewendet
worden ist, um die Bewegung nach einer streng horizontalen Linie fortzupflanzen. aa, hoͤlzerne Sectoren, auf Bolzen beweglich, die an dem Querbalken b befestigt sind; c doppelte
an den Sectoren befestigte Kette.
Fig. 34, 35, 36, drehende
Haͤhne.
Seitdem Hr. Baillet seinen Bericht abstattete, hat uns Hr. Valcourt das Modell und
die Zeichnung eines drehenden Hahnes, von seiner Erfindung, vorgelegt. Er zieht ihn
den gewoͤhnlichen Haͤhnen vor, die sich bloß hin und her, in einem
halben Kreise, bewegen.
Die Fig. 34.
ist der Durchschnitt, und die Fig. 35. der Grundriß des
Stiefels. Die Roͤhren BC sind aus einem
Stuͤke gegossen. Die Oeffnungen der Haͤhne an den beiden Enden der
Roͤhre B sind aus Gußeisen, und werden gut
geschliffen; die Wirbel dieser Haͤhne sind von Kupfer. Herr von Valcourt
nimmt zwei Haͤhne, um so wenig Dampf zu verlieren als moͤglich. Der
obere Wirbel D stekt auf einer vierekigen Stange E, die demselben eine ununterbrochene
kreisfoͤrmige Bewegung mittheilt, und auf welcher er der Laͤnge nach
leicht beweglich ist. Sein eigenes Gewicht, und der Druk des Dampfes halten ihn in
seinem Lager.
G, Wirbel, der unten auf derselben Stange E stekt. Der Dampf treibt ihn nach oben hin, und der
Ansaz J, der auf H ruht,
verhindert seine Bewegung nach unten. J und K sind Winkelraͤder, welche die Stange E kreisfoͤrmig bewegen.
Die Roͤhre A fuͤhrt den Dampf zum
Condensator, und die Roͤhre F leitet ihn in den
Stiefel; L ist der Kolben; M
fuͤhrt den Dampf uͤber den Kolben, N,
unter den Kolben.
Fig. 36. a Durchschnitt des Hahnes durch sein Centrum; b, Grundriß nach der Linie xy des senkrechten Durchschnitts; c der Hahn
gesehen von unten, d derselbe gesehen von oben.