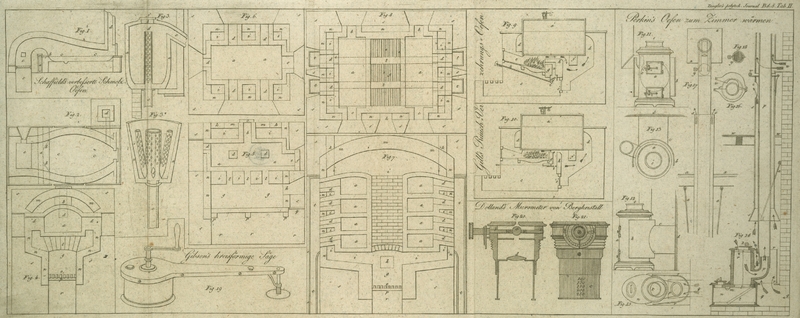| Titel: | Beschreibung der verbesserten Apparate und Oefen, um Metalle oder andere Substanzen aus ihren Erzen zu scheiden, und von allen damit verbundenen, vereinigten oder gemengten Stoffen zu trennen, worauf Wilh. Evetts Sheffield, Gentleman in Somers Town, Parish St. Pancras, Middlesex, dd. 31. Oktober 1812 ein Patent erhielt. |
| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. III., S. 23 |
| Download: | XML |
III.
Beschreibung der verbesserten Apparate und Oefen, um Metalle oder andere Substanzen aus ihren Erzen zu scheiden, und von allen
damit verbundenen, vereinigten oder gemengten Stoffen zu trennen, worauf Wilh. Evetts Sheffield, Gentleman in Somers Town, Parish St. Pancras, Middlesex, dd. 31. Oktober 1812 ein Patent erhielt.
Aus Th. Gill's technical Repository. N. I. Jaͤner 1822. S. 16. N. II. Februar. S. 81.
Mit Abbildungen auf Tab. II.
Sheffield's verbesserte Apparate, Metalle etc. zu scheiden.
Mein verbesserter Apparat besteht aus zwei Theilen: 1) aus
einem Luftleiter, welcher in oder laͤngs dem Ofen angebracht ist, um
atmosphaͤrische Luft oder irgend eine andere zwekdienliche
Fluͤssigkeit in unmittelbare Beruͤhrung mit den in dem Ofen dem Feuer
ausgesezten Erzen zu bringen; 2) in einem verbesserten Napfe oder Gefaͤße zur
Ausscheidung des Zinkes aus seinen Erzen in metallischer Form, in welcher Hinsicht
auch meine Oefen gebaut sindFig. 3. ist ein
anderer verbesserter Napf zu demselben Zweke dargestellt, der als weitere
Erklaͤrung der Grundsaͤze des Hrn. Sheffield dienen kann. Die Form ist etwas abgeaͤndert, aber
der Hauptunterschied besteht in den Seitenroͤhren, die mit der
Hauptroͤhre zusammenmuͤnden. A. d. O..
Fig. 1. Tab.
II. stellt einen senkrechten Durchschnitt, und Fig. 2. den Grundriß eines
Reverberir-Ofens dar, an welchem obiger Luftleiter angebracht ist. Dieser
Luftleiter hat eine Oeffnung, welche, außer jener Luft, die durch den Ofen geht, und
ihres Sauerstoffes durch das Feuer beraubt wird, noch andere aͤußere
atmosphaͤrische Luft herbei fuͤhrt. Er kann an jedem Theile des Ofens
angebracht werden, wo die Natur der in demselben anzustellenden Operation es
erfodert; hier ist er an jenem Theile des Ofens dargestellt, den man die
Bruͤke nennt, welche Lage fuͤr einen Reverberir-Ofen die beßte
ist, weil auf diese Weise die atmosphaͤrische Luft uͤber die am Boden
des Ofens ausgebreiteten Materialien nach dem Schornsteine am anderen Ende desselben
hingeleitet wird. In Mennig-Brennereien muß der Luftleiter aber an der
Hinteren Wand angebracht seyn, oder der Thuͤre des Ofens gegenuͤber.
In den beiden Fig.
1 und 2, stellt a die Roͤhre oder den
leitenden Theil des Luftleiters dar, und b die Oeffnung
oder Muͤndung desselben: diese Oeffnung muß ihren horizontalen Dimensionen
nach weit gemacht werden, damit die Luft sich verbreiten kann. cc ist der Herd oder die Flur; d der Schornstein; e der
Aschenherd und das Schuͤrloch. Das Einstroͤmmen der Luft regulirt
sich, nach Umstaͤnden, mittelst eines Hahnes, eines Registers, Schiebers oder
auf irgend eine andere Weise.
Fig. 3. stellt
meinen verbesserten Napf zur Ausscheidung des Zinkes aus seinen Erzen vor. aa sind die Seiten desselben; b ist das Fuͤll-Loch; c die Roͤhre, welche die Metalldaͤmpfe in
den Verdichter leitet; d eine andere Roͤhre, die
von c bis zur Hoͤhe der Fuͤllung, des
Erzes naͤmlich und der Kohlen, reicht. Da diese Roͤhre aus demselben
Materiale, wie der Napf, geformt, und von allen Seiten durchloͤchert ist, so
kann der sublimirte Zink mit der groͤßten Leichtigkeit in die Roͤhre
c gelangen, statt daß er, wie sonst, gezwungen
waͤre, seinen Weg durch die ganze Fuͤllung oder durch den
groͤßten Theil derselben zu nehmen. e ist eine
Seitenverbindung an
dem oberen Theile des Napfes, wodurch derselbe mit dem außen angebrachten Verdichter
Gemeinschaft erhaͤlt. Diese Verbindung dient zur Ableitung eines großen
Theiles von Zink durch Destillation, der sonst abwaͤrts getrieben, oder in
der Flamme verzehrt und zerstreut wird, so oft man den Dekel abheben muß, um die
Fuͤllung zu erneuern, oder die ausgebrannten Materialien herauszunehmen. f ist der Dekel fuͤr das FuͤlllochDer erste Versuch im Großen, Zink in
metallischer Form aus Blende zu gewinnen, wurde in Kaͤrnthen am Ende
des vorigen Jahrhundertes gemacht, und im Anfange des gegenwaͤrtigen
Jahrhundertes stand eine Zinkhuͤtte, welche metallischen Zink aus
Blende lieferte, zu Doͤlach in
Kaͤrnthen im Umtriebe. S. Schultes Reise auf den Großglokner 2 Theil.
Wir haben die Oefen in Doͤlach gesehen, und finden Sheffields Oefen
und sein ganzes Verfahren sehr aͤhnlich. A. d. Ueb..
Fig. 4. stellt
einen Durchschnitt des Ofens dar, in welchem metallischer Zink aus seinen Erzen
geschieden werden soll; er laͤßt sich auch auf andere sublimir- oder
destillirfaͤhige Substanzen, wie Schwefel und Arsenik, anwenden. a ist die Kammer, oder das geschlossene Gefaͤß
des Ofens, welcher durch Feuer, das auf seinen Boden eben so, wie auf seine Deke und
seine Waͤnde wirkt, geheizt wird. Fig. 5. stellt denselben
Ofen in einem anderen vertikalen Durchschnitte dar, und Fig. 6. im Grundrisse. aa ist die Kammer; b
das Fuͤllloch mit seinem Dekel; d, d, d, sind
Verbindungs-Roͤhren, welche die Metall-Daͤmpfe in den
Verdichter leiten; e ist das Loch zur Ausleerung der
ausgebrannten Erze, welches waͤhrend der Operation wohl verstrichen werden
muß; f die Thuͤre; g
der Feuerherd; h das Schuͤrloch; i, i, i, i sind Oeffnungen, durch welche die Flamme aus
dem Feuerherde zur Hizung der Kammer emporsteigt; k, k
Zuͤge, durch welche die Flamme von dem Schornsteine in den Ofen gelangt; l, l, l, gewoͤlbte Bogen quer uͤber dem
Herde zur Stuͤzung der Kammer des Ofens. m, m,
ist das Gewoͤlbe des Ofens selbst; n, n, n, n, n,
n, sind Seitenwaͤnde des Ofens aus Baksteinen; oo ist der Rost; p, p,
p, sind eiserne Tragbalken, welche den Rost halten; q ist eine eiserne Platte zur Stuͤzung des Mauerwerkes uͤber
dem Aschenloche; r, r, r, das Aschenloch; s das Mauerwerk, oder das aͤußere Gemaͤuer
um den Ofen. Der Hauptvortheil dieser Art von Oefen ist, daß gepuͤlverte Erze
in denselben auf einer großen Flaͤche behandelt werden koͤnnen, was in
den Zinknaͤpfen oder den gewoͤhnlichen Oefen, wo die Erze eingestampft
werden, nicht der Fall ist. Aus eben diesem Grunde und in derselben Absicht bringe
ich, wo es noͤthig ist, entweder bewegliche Laden, oder feste Faͤcher
an, und breite die Erze gepulvert oder in Stuͤken in denselben aus.
Fig. 7. zeigt
den Enddurchschnitt und Fig. 8. den Grundriß eines
mehr zusammengesezten Ofens, welcher aus einer Menge geschlossenen Kammern, a, a. etc. besteht, welche eben so viele abgeschiedene
Raͤume oder Behaͤlter bilden, die von dem ersten und an den Seiten und
oben anschlagenden Feuer geheizt werden. Aus jeder dieser Kammern gehen End-
oder Seitenroͤhren heraus, um die aus den Erzen aufsteigenden Daͤmpfe
in den Verdichter t zu leiten. Dieselben Buchstaben
bezeichnen uͤbrigens hier dieselben Gegenstaͤnde, wie in Fig. 4, 5, 6.
Ich begnuͤge mich ferner nicht, bloß bewegliche Laden und feste Faͤcher
in diesem Ofen anzubringen, sondern mache noͤtigen Falles alle Boͤden
dieser Kammern, oder einige, (die der unteren ausgenommen) beweglich, so, daß man
sie Herausziehen, und wieder hineinsteken kann; auch bringe ich, wo es
noͤthig waͤre, Oeffnungen zwischen diesen Kammern an. Formen,
Dimensionen, Verbindungen der verschiedenen Theile muͤssen nothwendig nach
Umstaͤnden verschieden seyn, und jeder Sachkenner wird leicht die
gehoͤrigen Abaͤnderungen zu treffen wissen.
Tafeln