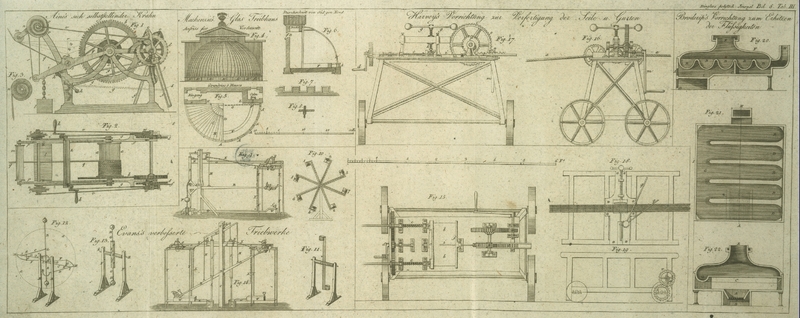| Titel: | Ueber gewisse Verbesserungen an dem Triebwerke der Mühlen oder Maschinen überhaupt, welche auch zur Gewältigung des Wassers in Bergwerken anwendbar sind, worauf Samuel Evans, Pächter zu Brynrywen in der Grafschaft Denbigh, Pfarre Dexham, am 1. Mai 1813 ein Patent erhielt. |
| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. XVIII., S. 134 |
| Download: | XML |
XVIII.
Ueber gewisse Verbesserungen an dem Triebwerke der Mühlen oder Maschinen überhaupt, welche auch zur Gewältigung des Wassers
in Bergwerken anwendbar sind, worauf Samuel Evans, Pächter zu Brynrywen in der Grafschaft Denbigh, Pfarre Dexham, am 1. Mai 1813 ein Patent erhielt.
Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXL. Mai 1822. S. 330.
Mit Abbildungen auf Tab. III.
Evans über Verbesserungen an dem Triebwerke der Mühlen.
In Fig. 9. Tab. III. ist AB ein Hebel zwischen zwei Pfosten CC, der sich um seine Achse D dreht: die Laͤnge des kuͤrzern Armes A muß nach der Staͤrke des zu fuͤhrenden
Streiches bemessen werden, und die Laͤnge des laͤngeren B nach der Groͤße des Widerstandes. Am Arme A ist ein bogenfoͤrmiger Kopf E, an dessen oberem Ende eine Kette oder mehrere Ketten
befestigt sind, woran ein Gewicht F und eine
Staͤmpel-Stange angehaͤngt ist, welche in dem Cilinder, dem
Werkgefaͤße oder der Pumpe G, durch welche das
Wasser aus Bergwerken oder großen Tiefen in den Behaͤlter H heraufgefoͤrdert wird, arbeitet. H ist ein Cilinder, Werkgefaͤß oder eine Pumpe,
durch welche das Wasser aus dem Behaͤlter H in
den Behaͤlter K hinaufgetrieben wird, L ist ein Balken, welcher durch die Stange M mit dem Balken AB in
Verbindung steht, und den Staͤmpel in dem Cilinder H treibt. N ist ein kleiner Schieber oder ein Fallbrett, welches sich in
dem Behaͤlter K befindet, und an einer Kette XX befestigt ist, welche uͤber eine
horizontale Walze laͤuft, die senkrecht bei N
aufgestellt ist, und uͤber die Walze h nach i laͤuft, wo sie befestigt werden kann: dieses
Fallbrett dient dazu, um das Wasser aus dem Behaͤlter k in den Trog OOO auslaufen zu lassen,
oder von demselben abzusperren. Das Wasser laͤuft aus diesem Troge OOO in das Gefaͤß P, in den Speiser, welcher zwischen zwei kleinen Pfosten SDiese sind im
Originale nicht deutlich. Auch kommt unter S
spaͤter die Kette vor. A. d. Ueb., die uͤber den
horizontalen Latten ZZ befestigt sind, angebracht
ist, und sich um seine Achse C dreht: an einem Ende
desselben ist sein Sporn d befestigt. S ist eine kleine, an dem Speiser P neben dem Sporen befestigte Kette, welche uͤber eine horizontale
Walze laͤuft, die bei Q senkrecht steht, und an
dem Fallbrette k befestigt ist. Dieses Fallbrett dient
zur Absperrung des Wassers in dem Troge OOO, wenn
der Speiser sein Wasser durch die Schuͤtte TT, welche zwischen den Latten ZZ und
dem Aufnehmer U befestigt ist, ausgießt: U ist zwischen zwei horizontalen Latten an dem
aͤußersten Ende des Armes B am Hebel AB, und dreht sich um seine Achse g. e ist ein Sporn am Ende des Aufnehmers. a ist ein kleiner aufrechter Zapfen, der an dem Arme B des Hebels AB nahe
an dem Aufnehmer U angebracht ist, und eine horizontale
Rolle an seinem oberen Ende traͤgt. f ist eine
Walze, welche von einem aufrechten Zapfen neben dem Aufnehmer WW getragen wird, durch welchen das Wasser in den
Behaͤlter H abfließt. Der Arm A muß so abgewogen werden, daß er den Arm B, wenn der Aufnehmer leer ist, bis zu den Latten ZZ hinaufbringt, und zwar in hinlaͤnglicher
Starke fuͤr den Schlaͤger a, damit dieser,
wenn er unter dem Sporne d hinrollt, den Speiser P umzukehren vermag, und der Speiser sein Wasser durch
die Schuͤtte in den Aufnehmer U ausleeren kann,
worauf dieser Aufnehmer U sogleich herabsteigt, und der
Sporn e, der an die Walze f
schlaͤgt, denselben umkehrt, und seine Ladung dem Aufnehmer WW mittheilt, durch welchen sie in den
Behaͤlter H fließt, und mittelst der Pumpe II wieder in den Behaͤlter K hinaufgepumpt wird. Wenn der Speiser P sein Wasser entleert, dreht er sich innerhalb des
oberen Endes der Schuͤtte TT und der untere
Theil dieser Schuͤtte ist innerhalb des Aufnehmers U. Man muß wohl bemerken, daß, wenn das Grubenwasser durch die Pumpe G in den Behaͤlter H
herausgefoͤrdet wurde, der Empfaͤnger WW nicht noͤthig ist, und daß, wenn unter solchen Umstaͤnden
ein hinlaͤnglich großer Behaͤlter hoch genug angebracht werden kann,
um den Speiser zu bedienen, man davon Gebrauch machen kann. In diesem Falle ist der
Trog OOO, der Behaͤlter K, der Balken L und die
Stange M, der Cilinder oder die Pumpe II nicht noͤthig.
Fig. 10. und
11. sind
verschiedene Ansichten derselben Maschine. Fig. 10. ist eine
transparente Ansicht von 4 Cilindern, deren jeder ungefaͤhr 20 bis 30 Fuß
lang ist. Der Mittelpunkt eines jeden dieser Cilinder ist der Mittelpunkt der
Achsen; sie sind aber nicht verbunden. An jedem Ende eines jeden Cilinders ist, an
den entgegengesezten Enden, ein kleines Werkgefaͤß angebracht, dessen
Durchmesser ungefaͤhr vier mal so groß, als jener des Cilinders ist. In jedem
dieser Werkgefaͤße befindet sich ein Taucher ABCD: diese Taucher sind durch eine Stange II verbunden, welche durch den Cilinder beinahe von einem Ende bis zu dem
andern reicht, und welche an jedem Ende mit einer kleinen Handhabe versehen ist, die
sich um einen Zapfen dreht, welcher an dem aͤußersten Ende des Cilinders
zwischen diesem und dem Werkgefaͤße befestigt ist. Das andere Ende der
Handhabe ist mit dem Mittelpunkte des Tauchers mittelst eines Stiftes verbunden, der in dem Taucher
befestigt ist; dieser Stift laͤuft durch einen langen Einschnitt, oder durch
ein Loch an dem Ende der Handhabe. Von dem Mittelpunkte des Tauchers bis an seine
Kante laͤuft ein Einschnitt gegen den Mittelpunkt des Cilinders hin, worin
die kleine Handhabe liegen kann, und wodurch der Taucher dicht an den Dekel des
Werkgefaͤßes zu liegen kommt. Ein Cilinder und ein Werkgefaͤß wird mit
Wasser gefuͤllt; das andere Werkgefaͤß hat nur seinen Taucher und
seine Handhabe; das uͤbrige ist luftleerer Raum. Die Luft muß aus GGGG in den Werkgefaͤßen 2, 3, 5, 7
herausgezogen werden, so, daß in den Cilindern HHHH ein luftleerer Raum bleibt. Da 1, 4, 6, 8 voll Wasser sind, so wird
dieß dadurch die schwerste Seite des hiernach gebildeten Rades, und wird so, wie
jeder Cilinder senkrecht wird, hinabsteigen. Der Taucher in dem oberen
Gefaͤße wird auf die Stange in dem Cilinder mittelst seiner Handhabe wirken,
und der Taucher in dem unteren Werkgefaͤße wird auf das Wasser druͤken
und dieses aus demselben durch den Cilinder in das obere Werkgefaͤß hinauf
treiben. Da nach und nach jeder Cilinder, so wie ihn die Reihe trifft, zugleich mit
seinen Werkgefaͤßen in Folge der Umdrehung um die Achse senkrecht wird, so
wird nach und nach jeder sein Wasser durch den Mittelpunkt der Achse von unten nach
oben bringenEs ist weder die
Schuld des Uebersezers noch des die Abbildung kopierenden Kuͤnstlers,
wenn dieser Absaz unverstaͤndlich ist, die Kopie ist eben so genau,
als die Uebersezung treu.a. d. Ueb. u. d. Redakt..
Fig. 11. zeigt
die Lage der Achse, die horizontal auf ihren Stuͤzen ruht; nur ein Cilinder
mit seinen Gefaͤßen ist hier im Mittelpunkte der Achse dargestellt.
In Fig. 12.
ist N eine horizontale Achse zwischen zwei Stuͤzen MM. OO sind
Zapfen, um welche die Achse sich dreht; AA sind
zwei gleich schwere Gewichte an den Enden der beweglichen Stange BB, welche in einem Loche oder Einschnitte durch
den Mittelpunkt der Achse N in senkrechter Lage
angebracht, und durch die Werkstangen CC, welche
an ihrem Ende L doppelt oder gabelfoͤrmig sind,
in dieser, Lage erhalten wird. Die bewegliche Stange BB befindet sich zwischen den Gabeln, und wird durch einen Stift, welcher
durch die Loͤcher in ihr und in den Werkstangen durchlaͤuft, gehalten.
FF sind zwei an der Achse N befestigte Arme, auf jeder Seite einer; sie springen
von der Achse N unter rechten Winkeln auf BB hervor. GG
sind zwei kurze Arme, welche an den Armen FF
befestigt, und bei KK verdoppelt oder
gabelfoͤrmig sind. Die Werkstangen CC
befinden sich zwischen diesen Gabeln, und drehen sich um einen Stift K, welcher durch die Werkstangen und die Doppelende an
den aͤußersten Enden der Arme FF
laͤuft. Bei HH sind Zapfen befestigt,
welche aus der Seite der Arme FF hervorspringen,
um welche die Hebel DD sich drehen. An der Seite
eines jeden der Hebel DD, bei II, ist ein Zapfen befestigt, welcher durch ein
langes Loch oder durch einen Einschnitt in den Werkstangen CC laͤuft; die Hebel DD mit ihren Gewichten EE laufen uͤber und unter der Achse N in jeder Entfernung innerhalb des gedachten Kreises.
Man kann jede beliebige Anzahl von diesen beweglichen Stangen mit ihren Gewichten
anwenden; jede Stange muß durch den Mittelpunkt der Achse N laufen, und sich in allen Richtungen mit jeder andern unter rechten
Winkeln kreuzen; jede muß mit ihren Werkstangen, Stuͤzen und Hebeln versehen
seyn. Wenn das Gewicht A 2 durch die Bewegung der Achse
N vertikal wird, werden die Hebel auf die
Werkstangen wirken, und die beweglichen Stangen aufsteigen machen, und A 2 wird dann in derselben Lage sich befinden, in
welcher jezt das Gewicht A 1 erscheint.
In Fig. 13.
ist DD eine horizontale Achse zwischen den
Stuͤzen FF, die sich um ihre Zapfen EE dreht. CC ist
ein in dem Mittelpunkte der Achse DD befindlicher
Cilinder. An jedem Ende des Cilinders ist ein Dekel durch die Stange GG befestigt, welche durch ein in dem Mittelpunkte
eines jeden dieser Dekel angebrachtes Loch laͤuft. In dem Mittelpunkte der
Stange GG ist ein duͤnnes hohles
Gefaͤß von Eisen, Kupfer oder irgend einem andern hiezu schiklichen Metalle
befestigt, aus weichem die Luft ausgepumpt ist, und welches die luftleere Kugel
heißt (Vacuum ball). Wenn der Cilinder CC durch die Umdrehung seiner Achse DD senkrecht wird, und sich mit Wasser
fuͤllt, so steigt die luftleere Kugel in dem Wasser bis an den obern Dekel in
die Hoͤhe, und treibt die Stange GG
uͤber ihren Mittelpunkt hinaus. Die Halsbaͤnder von Leder etc. bei HH, an der Stange GG, und bei II neben der luftleeren
Kugel, sollen auf die Loͤcher an den beiden Dekeln druͤken; das Band
bei H von Außen auf den Dekel, das Band bei I von Innen auf das entgegengesezte Loch, um das
Ausfließen des Wassers zu hindern. Man kann eine beliebige Anzahl von Cilindern in
derselben Achse anbringen, sie muͤssen sich aber zunaͤchst an einander
unter rechten Winkeln aus die Achse kreuzen.
Fig. 14. ist
beinahe einerlei mit Fig. 9., und eine Erklaͤrung aller ihrer Theile wuͤrde nur
eine Wiederholung Desjenigen seyn, was bei Fig. 1. gesagt wurde. Hier
sind keine kurzen Arme, der Balken ist ein Wagbalken, jeder Arm ist gleich stark,
und seine Achse oder sein Stuͤzpunkt ist im Mittelpunkte gelegen. Sie hat
einen Aufnehmer und einen Schlager am Ende eines jeden Armes, auch einen Speiser und
eine Schuͤtte, welche beide in gehoͤriger Lage ruͤksichtlich
auf jeden Aufnehmer gestellt sind. Jeder Arm ist mit den Stangen M verbunden, wovon jede an besondere Balken
laͤuft, welche die Staͤmpel besonderer Pumpen treiben.
Tafeln