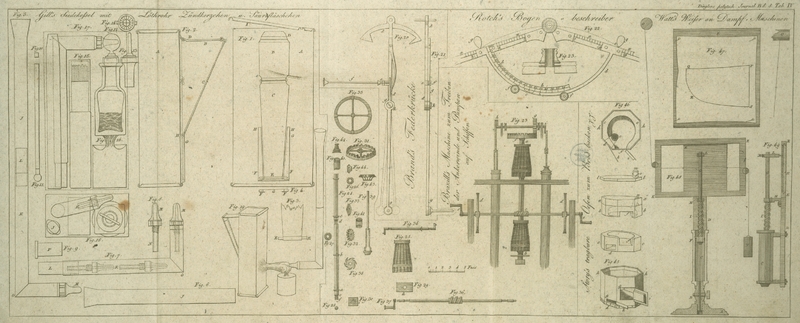| Titel: | Ueber einen tragbaren Siedekessel, der zugleich ein verbessertes Löthrohr, oxigenirte Zündkerzchen, und ein Fläschchen mit Säure etc. zur Erzeugung von Säure und Licht enthält. Von Hrn. Th. Gill. |
| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. XXI., S. 145 |
| Download: | XML |
XXI.
Ueber einen tragbaren Siedekessel, der zugleich ein verbessertes Löthrohr, oxigenirte Zündkerzchen, und ein Fläschchen mit
Säure etc. zur Erzeugung von Säure und Licht enthält. Von Hrn. Th. Gill.
Aus dessen technical Repository. April 1822. S. 247.
Mit Abbildungen auf Tab. IV.
Gill über einen tragbaren Siedekessel.
Der Kessel ist aus verzinntem Eisenbleche, welches
zusammengeloͤthet wird, verfertigt, nur vier Zoll ungefaͤhr hoch, zwei
Zoll breit, und ein Zoll weit. Sein Henkel hat eine neue und besondere Einrichtung,
durch welche derselbe bald dicht an der Seite des Kessels anliegen, bald aufgestellt
und folglich als feststehende Handhabe gebraucht werden kann. In Fig. 1. Tab. IV. ist A, der Kessel, von der Ruͤkseite, in Fig. 2. von der
Seite dargestellt. B und C
sind die zwei beweglichen Theile, aus welchen der Henkel besteht. Der Theil B ist mit dem an dem Kessel angeloͤtheten Theile
D beweglich verbunden, und eben so mit dem Theile
C. Durch das untere Ende des Theiles C ist ein Draht E quer durch
angeloͤthet,
dessen Enden an jeder Seite hervorstehen, wie EE
in Fig. 3.
zeigt. Diese hervorstehenden Enden lassen sich in zwei Falzen FF auf und nieder bewegen, welche Falze durch eine
Umbiegung der Kanten der Platte G, wie Fig. 4. zeigt, gebildet
werden. Diese Platte G ist an dem Kessel
angeloͤthet, und die oberen Enden der Falze HH sind durch Schlagloth geschlossen, so, daß der Theil C des Henkels nicht hoͤher hinaufsteigen kann,
als noͤthig ist, um den Theil B unter einem
rechten Winkel auf dem Kessel stehen zu lassen. In dieser Lage ist der Henkel in
Fig. 2.
dargestellt, wo die punktirten Linien denselben zugleich auch in der
niedergeschobenen und an den Kessel angedruͤkten Lage darstellen, in welchen
er auch auf Fig.
1. gezeichnet ist. I ist der Dekel des
Kessels, welcher sich um einen an dem Kessel angeloͤtheten Angel dreht, und
oͤffnen oder schließen laͤßt.
Beschreibung des verbesserten Loͤthrohres.
Dieses Loͤthrohr ist in Fig. 5. so dargestellt,
wie es vorgerichtet gerichtet seyn muß, wenn man mit demselben arbeiten will. IK sind die beiden Theile, welche den
Koͤrper des Instrumentes bilden, naͤmlich Roͤhren aus
duͤnnem Messingbleche, welche sich bei L.
mittelst einer engeren Roͤhre, welche an einem oder an dem anderen Theile I und K angeloͤthet
ist, und uͤber welche der andere Theil geschoben wird, so wie die Figur
zeigt, mit einander verbinden lassen. Fig. 6. und 7. stellt diese
Theile einzeln dar. Der Theil K ist unter einem rechten
Winkel gebogen, und an dem Ende desselben ist ein Stuͤk Messing mit einem
Schraubenloche, in welches man irgend einen der Zapfen MM mit Oeffnungen von verschiedener Weite einschrauben kann. Einer von
diesen Zapfen M ist in Fig. 8. besonders
dargestellt: er ist mit einer Roͤhre N versehen,
welche ziemlich weit in die Roͤhre K hinein
vorsteht, und hindert, daß keine Feuchtigkeit durch den Zapfen M ehe ausfließen kann, bis sie sich so sehr
angehaͤuft hat, daß sie uͤber jenen Vorsprung emporragt. Aber auch dieß
kann durch eine unten zu beschreibende Vorrichtung vermieden werden. Die punktirten
Linien in Fig.
7. und 8. zeigen, daß der Kanal in der Roͤhre des Zapfens N so weit als moͤglich gebohrt ist, und nur an
der Spize des Zapfens, wo er die Oeffnung des Loͤthrohres bildet, sich
ploͤzlich verschmaͤlert. Auf diese Weise wird der freie Durchgang der
Luft zu dieser Oeffnung hin durch nichts gehindert. Ueberdieß ist dieser Zapfen auch
nicht, wie man gewoͤhnlich zu sagen pflegt, wie Draht
gezogen (wire drawn), ein Fehler, der sich an
vielen Loͤthroͤhren, vorzuͤglich an den kegelfoͤrmigen,
findet, welche vom Mundstuͤke an bis zur Oeffnung immer allmaͤhlich
spiziger zulaufen. Ferner hat dieses Loͤthrohr noch eine besondere kleine
Oeffnung bei O (Fig. 5. u. 7.), durch welche ein
Theil der Luft hinaus fahren kann, waͤhrend nach der Haupt-Oeffnung
hin noch immer Luft genug gelangt, um alle von einem Loͤthrohre verlangte
Wirkung hervorbringen zu koͤnnen. Durch diese beiden Oeffnungen erspart man
sich die muͤhevolle Nothwendigkeit, den Athem zwischen jeder Einathmung so
lang ans zuhalten, und die Lungen gewinnen dadurch freies Spiel; ein großer
Vortheil, den man durch diese Verbesserung erhaͤlt, welche der Herausgeber
dem gelehrten und geistreichen Hrn. Samuel Varley
verdankt. Diese besondere Oeffnung verschafft ferner eine bequeme Gelegenheit, das
Instrument von aller angehaͤuften Feuchtigkeit zu reinigen, die, wie wir oben
bemerkten, sich allenfalls in derselben sammeln koͤnnte: denn man darf nur
das Loͤthrohr mir dieser Oeffnung abwaͤrts halten und durchblasen, so
wird die Feuchtigkeit auf der Stelle aus demselben hinausgetrieben. Das obere Ende
der Roͤhre I ist oval, um sich desto bequemer an
die Lippen des Blasenden anschließen zu koͤnnen, und sollte entweder recht
gut verzinnt, oder, was noch besser ist, von Silber gemacht seyn. Die
uͤbrigen Zapfen koͤnnen sehr bequem innerhalb der Roͤhre K
aufbewahrt, und so
mitgetragen werden; um dem Herausfallen derselben vorzubeugen, bedarf es nur eines
Kaͤppchens P, Fig. 9, welches die obere
Oeffnung von L schließt.
Ueber die Bereitung der verbesserten oxigenirten Zuͤndkerzchen.
Diese Zuͤndkerzchen werden aus duͤnnen Ruͤthchen von
Foͤhren- oder Linden-Holz ungefaͤhr 1/10–1/12
Quadrat-Zoll stark verfertigt: wenn sie aus Lindenholz gemacht werden,
verfertigt man sie mittelst der Rundsaͤge, aus Foͤhren-Holz
koͤnnen sie gesaͤgt oder gesplissen werden. Sie koͤnnen
ungefaͤhr 3 Zoll lang seyn. Diese Zuͤndkerzchen muͤssen zuerst
leicht mit Schwefel uͤbertuͤncht werden, damit man ihrer
Entzuͤndung desto sicherer ist, und das Holz mit einer Art von Firniß
uͤberzogen wird, wodurch es gegen Benezung mit Schwefelsaͤure, mit
welcher diese Zuͤndkerzchen in Beruͤhrung kommen, und welche
bekanntlich der vollkommenste Flammentilger ist, geschuͤzt wird. Die
Nichtanwendung des Schwefels aus uͤberspannter und unnoͤthiger
Verfeinerungssucht hat bei uns den Kredit, in welchem diese Zuͤndkerzchen
ehevor standen, bedeutend vermindert; auf dem festen Lande werden sie allzeit mit
Schwefel uͤbertuͤncht, und ihr Gebrauch ist dort eben so allgemein,
als er es zu seyn verdient. Ein anderer Nachtheil der englischen
Zuͤndkerzchen ist wohl auch der, daß sie bei uns aus bloßen
Holzspaͤhnchen (mere shavings of wood) verfertigt
werden, welche so duͤnn sind, daß sie den gehoͤrigen Druk nicht
ertragen koͤnnen, wenn man sie ploͤzlich in die Flaͤschchen
stoͤßt, und dort mit dem mit Schwefelsaͤure befeuchteten Asbert in
Beruͤhrung bringt, um durch die chemische Mischung, mit welcher sie
bestrichen sind, dieselben zu entzuͤnden. Diesem Nachtheile laͤßt sich
dadurch abhelfen, daß man sie vierekig, und folglich steifer und zum Gebrauche
tauglicher, macht.
Oxigenirende Komposition fuͤr diese Zuͤndkerzchen.
Ueber oxidirt salzsaures Kali (oder Chlorsaure oder oxigenirt salzsaure Pottasche),
18 Theile;
Staͤrke, 3 Theile;
Schwefelblumen, 3 Theile;
Arabisches Gummi 1 Theil, und, wo man will, etwas Zinnober, um diese Mischung roth zu
faͤrben.
Die chlorsaure Pottasche muß, einzeln, in einem Wedgewood Moͤrser mit einem
Pistille aus derselben Masse fein zerrieben werden; hierauf muͤssen auch die
uͤbrigen Ingredienzen alle gehoͤrig unter einander gerieben, und,
nachdem sie den hinlaͤnglichen Grad von Feinheit erhalten haben, muß
denselben die chlorsaure Pottasche beigemischt, und alles durch sachtes und sanftes
und anhaltendes Umruͤhren mit dem Pistille gehoͤrig unter einander
gemengt werden. Man muß bei diesem Umruͤhren sorgfaͤltigst alles
Stoßen oder etwas starke Druͤken vermeiden, indem sonst das durch diese
Mischung gebildete Knallpulver eine furchtbare Explosion verursachen
koͤnnteDer Uebersezer findet
sich durch die traurigen Unfaͤlle, die er bei Verfertigung dieser
Zuͤndkerzchen erlebte, verpflichtet, die Warnung des Hrn. Verfassers
jedem, der sich mit dieser Fabrikation beschaͤftigt, auf das
Dringendste einzuschaͤrfen. Man huͤthe sich zu reiben, und
begnuͤge sich zu ruͤhren. A. d. Ueb.. Hierauf wird,
unter stetem Umruͤhren, nach und nach so viel Wasser zugegossen, als
noͤthig ist, um diesem Gemenge die Dike eines Rahmes zu geben, dasselbe in
ein Gefaͤß mit flachem Boden gegossen, so, daß dieser nur seicht damit bedekt
wird, das mit Schwefel uͤbertuͤnchte Ende der Zuͤndkerzchen
wird in dasselbe so eingetaucht, daß nur etwas weniges davon daran haͤngen
bleibt, und die eingetauchten Zuͤndkerzchen werden sodann sorgfaͤltig
an dem Rande eines Tisches so neben einander gelegt, daß keines das andere
beruͤhrt, und das eingetauchte Ende etwas uͤber den Rand des Tisches
hervorsteht, damit sie troknen koͤnnen: troken sind sie sodann zum Gebrauche
fertig. Fig.
10. u. 11. zeigen ein solches Zuͤndkerzchen in natuͤrlicher
Groͤße und im Durchschnitte.
Das Flaͤschchen mit der Saͤure etc.
Man hat neulich an diesem Flaschchen eine Verbesserung angebracht, die in einem
Knopfe von Zinn besteht, welcher an dem Korke befestigt ist, und wodurch dieser
leichter herausgezogen und fester hineingestekt werden kann. Fig. 12. zeigt ein
solches vierekiges Flaͤschchen, in welchem Asbert, der vorlaͤufig
gehoͤrig zu Fasern geklopft und etwas mit konzentrirter Schwefelsaͤure
befeuchtet wurde, fest eingestampft ist. Sein Korkpfropf oder Stoͤpsel ist
mit einem zinnernen Knopfe oder Griffe versehen. Fig. 13. stellt diesen
Knopf von der Seite, Fig. 14. von Innen dar,
mit den an demselben innenwendig angebrachten hervorstehenden Linien, wodurch er
daselbst uneben und rauh, und dem Kitte das Festhalten desselben erleichtert wird.
Der Kork oder Pfropf ist außen mit Talg bestrichen, wodurch er nicht nur gegen die
Einwirkung der Schwefelsaͤure bedeutend geschuͤzt, sondern zugleich
auch in den Stand gesezt wird, das Flaͤschchen desto genauer zu schließen,
und die Feuchtigkeit der Atmosphoͤre, welche die Saͤure
schwaͤchen wuͤrde, abzuhalten; zugleich wird dadurch auch das Oeffnen
und Schließen des Flaͤschchens erleichtert. Ein anderer Vortheil dieses
zinnernen Kopfes besteht auch noch darin, daß man bei Anwendung desselben nicht mehr
Gefahr laͤuft, sich die Finger mit Schwefelsaͤure zu beschmuzen, was
bei den gewoͤhnlichen Korkpfropfen so, haͤufig der Fall ist, und auch
nicht so viele Waͤsche verdirbt, als durch das Reinigen der Finger von der
Schwefelsaͤure gewoͤhnlich geschieht.
Den noͤthigen Vorrath von Zuͤndkerzchen bewahrt man, um dieselben vor
allem Verderben zu schuͤzen, in einem Futterale von Maroquin oder
Pappendekel, welches mit einem Dekel, wie Fig. 15. zeigt, versehen
seyn muß. Man braucht nun nur noch ein Stuͤk Wachskerze, Fig. 16, ungefaͤhr
von dem Kaliber derjenigen, die man bei Kutschen-Laternen hat, und der ganze
Apparat ist vollstaͤndig.
Die Lage aller bisher aufgezaͤhlten Theile in dem Kessel zeigen Fig. 17. u.
19,
erstere im Aufrisse, leztere im Grundrisse. Sie finden alle, so klein auch der
Kessel ist, Raum genug; man braucht nur etwas weiches Papier dazwischen zu stehen,
um sie vor aller Beschaͤdigung zu bewahren wahren, die durch
Schuͤtteln und Ruͤtteln entstehen koͤnnte.
Wie dieser Kessel geheizt wird.
Fig. 19. zeigt
dieß im Kleinen. Die Flamme der Wachskerze wird vorne an dem Kessel nahe an seinem
Boden mittelst des Loͤthrohres hingeblasen, und in wenigen Minuten wird das
in dem Kessel enthaltene Wasser diejenige Hize erhalten haben, die man an demselben
wuͤnscht.
Es duͤrfte schwer fallen, allen den verschieden Nuzen, den dieser Apparat
gewaͤhrt, hier aufzuzaͤhlen; nur Einiges wollen wir beruͤhren.
Abgesehen von der Wichtigkeit des Loͤthrohres fuͤr den Mineralogen,
Geologen und Chemikern, und der bedeutenden Verbesserung desselben in Hinsicht auf
Leichtigkeit in seiner Anwendung, muß ein tragbarer Kessel, wie man gestehen wird,
eine sehr schaͤzenswerthe Akquisition fuͤr jeden Reisenden seyn,
waͤr es auch bloß um sich sein Wasser zum Barbieren, zum Thee etc. zu hizen.
Dieser Kessel kann, bei seiner verbesserten Handhabe, in vielen Faͤllen als
Trinkgefaͤß dienen. Der Vortheile einer so leichte Methode, Feuer und Licht
zu erhalten, wollen wir hier gar nicht erwaͤhnen, da das Verdienst, diesen
ganzen Apparat in eine so bequeme und tragbare Form zusammengedraͤgt zu
haben, fuͤr sich selbst spricht.
Tafeln