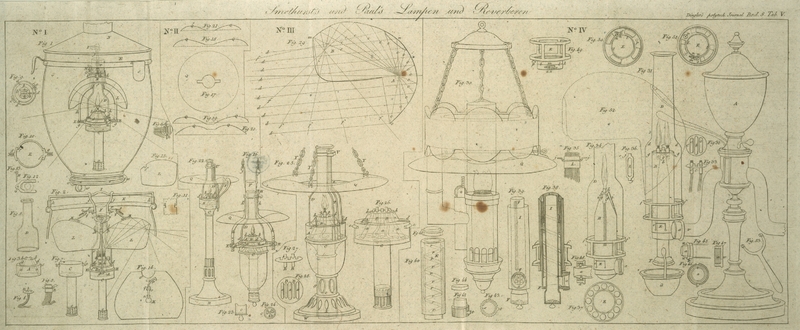| Titel: | Verbesserungen an Lampen und Reverberen, auf welche Jak. Smethurst, Lampen-Fabrikant und Contrahent an St. Margaret's Hill, Southwark, County of Surrey, und Nikol. Paul, Mechaniker in Villiers Street, Strand, County of Middlesex, am 30. Oktober 1802 ein Patent erhielten. (Der Termin ist verlaufen.) |
| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. XXXV., S. 263 |
| Download: | XML |
XXXV.
Verbesserungen an Lampen und Reverberen, auf welche Jak. Smethurst, Lampen-Fabrikant und Contrahent an St. Margaret's Hill, Southwark, County of Surrey, und Nikol. PaulDer Herausgeber
„(Hr. Gill)“ schaͤzt
sich gluͤklich, jezt eine Gelegenheit gefunden zu haben, dem Andenken
dieses hoͤchst wuͤrdigen und geistreichen Mannes Gerechtigkeit
widerfahren lassen zu koͤnnen. Er war ein Genfer und Direktor der
Wasserleitungen in dieser Stadt, und errichtete daselbst, wie zu Lyon und Paris,
und spaͤter auch zu London, kuͤnstliche Mineral-Wasser
Fabriken und Mineral-Baͤder. Sein gegenwaͤrtiges Patent
gewaͤhrt eines jener seltenen Beispiele, wo gesunde Theorie mit vieler
Geschiklichkeit auf die Praxis angewendet sich findet: dessen ungeachtet blieben
seine schoͤnen Erfindungen, wahrscheinlich weil er zu fruͤhe und
ploͤzlich (am Schlagflusse) starb, auch wohl aus anderen nicht hieher
gehoͤrigen Gruͤnden, beinahe ohne Erfolg, und sein Patent wurde,
wahrscheinlich wegen der vielen Zeichnungen und der Laͤnge seiner
Beschreibung, nicht einmal bekannt gemacht. Der Herausgeber, der sein
Patent-Agent gewesen ist, wurde mit allem, was auf seine Lampen und
Reverbere Bezug hatte, genau vertraut, und obschon er von seiner Seite hier
alles Moͤgliche that, um Hrn. Paul's Erfindung
durch Zeichnungen so viel moͤglich zu versinnlichen, wird wohl
unvermeidlich noch manches Detail den Lampenfabrikanten nur muͤndlich
erklaͤrt werden koͤnnen. Der Herausgeber hat auch durch die
Gefaͤlligkeit seines Freundes, Hrn. Bruguier,
auch eines Genfers und Mechanikers in Greek-Street, Soho, welcher die
artigen musikalischen Tabatieren, Siegelstoͤke etc. verfertigt, eine
Zeichnung und Beschreibung der Lampen und Reverberen, mit welchen im Jahr 1816
Genf beleuchtet wurde, erhalten. Da beide viel zur Erlaͤuterung von Paul's Erfindung beigetragen, so werden wir sie der
Beschreibung der Erfindung des Hrn. Paul's anhaͤngen. A. d. O.Wenn Squire Gill seine Leser wegen der Laͤnge
dieser Beschreibung um Nachsicht bittet, und sein herrliches Journal, aus
welchem wir fortan die wichtigsten und fuͤr das feste Land brauchbaren
Artikel so schnell wie moͤglich liefern werden, mit einem Aufsaze
beginnt, der
ihn zu einem fuͤr einen Journalisten gewoͤhnlicher Art (freilich
nicht fuͤr einen Gill) so wenig geeigneten
Schritte veranlassen konnte, so glauben auch wir die Nachsicht unseres Publikums
zu verdienen, das uns schon im dritten Jahre seine Aufmerksamkeit schenkt, und
dieselbe immer vermehrt. Wir glauben uͤberdieß, daß Licht gut Ding ist,
denn sonst haͤtte Gott der Allmaͤchtige dasselbe nicht schon am
ersten Tage geschaffen. Nach gewissen Kalenderzeichen fuͤr das dritte
Decennium des 19ten Jahrhundertes sollte man zwar glauben, daß eine
Lichtscheren-Fabrik mehr an der Tages-Ordnung waͤre, als
eine Lampen-Fabrik: Paul's Lampe soll indessen
nicht unter dem Scheffel verstekt bleiben. Wir glauben, daß alle
gegenwaͤrtige und kuͤnftige Lampen-Fabrikanten (die
gegenwaͤrtigen scheinen bei ihren Beleuchtungs-Theorien noch so
ziemlich im Finsteren zu tappen, oder gleiches Schiksal mit den Nachtfaltern zu
theilen, die, vom Lichte geblendet, sich die Fluͤgel an der Flamme
verbrennen) in des sel. Paul Aufsaze die reinste und
gesuͤndeste Theorie einer Lampe finden werden. Scheint ihnen Paul's Lampe zu zusammengesezt, so sollen sie
dieselbe einfacher, aber eben so gut machen. A. d. Ueb., Mechaniker in Villiers Street, Strand, County of Middlesex, am 30. Oktober 1802 ein Patent erhielten. (Der Termin ist verlaufen.)
Aus Th. Gill's Technical Repository. Nr. I. Jaͤner 1822. Nr. III. Maͤrz. S. 161. und Nr. V. Mai.
Mit Abbildungen auf Tab. V.
Smethurst und Paul's Verbesserungen an Lampen und Reverberen.
Unsere Verbesserungen bestehen, in Hinsicht auf die Lampen selbst, darin, daß wir 1tens durch eine Zug- oder
Register-Roͤhre mit einem daran angebrachten gehoͤrigen
Register, in dem unteren Theile des Gehaͤuses oder Behaͤlters, worin die Lampen
enthalten sind; durch Luftroͤhren innerhalb oder außerhalb des
Koͤrpers der Lampe selbst; durch eine schief zulaufende Form, die man dem
glaͤsernen Schornsteine oder Gewoͤlbe der Lampe, wovon der Brenner
umgeben ist, gibt; oder auf eine oder die andere der so eben angefuͤhrten
Weisen der Luft einen solchen Zutritt zu dem brennenden Theile des Dochtes
verschaffen, daß dadurch die vollkommenste und leuchtendste Verbrennung des Oeles,
Fettes, Talges, Wachses, oder anderer oͤl- oder fettartiger oder
brennbarer Stoffe, mit welchen die Lampe gespeiset wird, erzeugt werden kann; daß
ferner auch rings um die Flamme stets der gehoͤrige Grad von Hize erhalten,
und die Flamme zugleich so lang gezogen wird, als zu einer vollkommenen und hellen
Verbrennung noͤthig ist, so, daß der moͤglich groͤßte Ausfluß
von Licht, den ein Docht von einer bestimmten Form und Groͤße, wenn er mit
irgend einer oͤl- oder fettartigen oder irgend einer anderen Substanz
gehoͤrig gespeist wird, geben kann, ununterbrochen Statt hat. 2tens, daß der Brenner, in welchem der Docht
enthalten ist, mittelst einer einfachen Vorrichtung, die wir weiter unten
beschreiben werden, leicht aus der Lampe genommen werden kann, entweder um denselben
zu reinigen, oder einen anderen von anderer Form und Groͤße an seine Stelle
zu sezen. 3tens, daß durch eine einfache,
gleichfalls unten zu beschreibende, Vorrichtung ein haͤufigerer und
ungehinderter Zufluß von Oel, Fett, Talg, Wachs, oder anderen oͤligen oder
fettartigen oder brennbaren Substanzen, mit welchen die Lampe gespeist wird, dem
Dochte zugefuͤhrt werden kann.
Unsere Verbesserungen in Hinsicht der Reverbere
bestehen darin, daß sie
1tens so gebildet sind, daß sie diejenigen
Strahlen, welche von der Flamme der Lampe ausstroͤmen, zuruͤkwerfen,
indem jene, ohne diese Reverbere, sich in einer Richtung verlieren muͤßten,
in welcher sie unnuͤz zu jenem Zweke werden wuͤrden, zu welchem die
Lampe bestimmt ist, da sie uͤber die ganze Flaͤche oder in jenem
Raume, welcher erleuchtet werden soll, gleichsam ausgegossen oder verbreitet werden
muͤßen, so, daß die ganze Lichtmasse, welche auf jeden Theil dieser
Flaͤche oder dieses Raumes faͤllt, sowohl von den Strahlen der Lampe
unmittelbar als zuruͤkgeworfen von der Reverbere, so viel als moͤglich
gleich und gleichfoͤrmig wird. 2tens, daß
sie so vorgerichtet sind, daß sie diejenigen Strahlen, welche auf jene Theile der
Reverbere fallen, die der Flamme am naͤchsten sind, auf die entferntesten
Theile der Flaͤche oder des Raumes, welcher erleuchtet werden soll,
zuruͤk hinaus werfen, und umgekehrt diejenigen Strahlen, welche auf die von
der Flamme am weitesten entfernten Theile der Reverbere fallen, auf die
naͤchsten Theile der zu erleuchtenden Flaͤche oder des zu
erleuchtenden Raumes; so, daß in Hinsicht auf jeden Theil der Reverbere die
zuruͤkgeworfenen Lichtstrahlen desto laͤnger sind, je kuͤrzer
die einfallenden sind, und umgekehrt.
In der beigefuͤgten Zeichnung Nr. 1. stellt Fig. 1. Tab. V. eine
gemeine Straßenlampe mit ihrer Reverbere vor, so wie diese jezt gewoͤhnlich
eingerichtet ist. I ist das Glas, in welchem die Lampe
eingesezt ist, K der Ranft, und N der Dekel. Fig. 2. ist dieselbe
Lampe; aber die Reverberen stehen hier unter rechten Winkeln hinsichtlich ihrer Lage
in Fig. 1;
Glas I und Dekel sind abgenommen. Die uͤbrigen
Fig.
3–15. stellen die verschiedenen Theile einzeln dar, und in allen Figuren
bezeichnen dieselben Buchstaben dieselben Theile. A,
Fig. 1,
2, und 3,
ist der Koͤrper der Lampe, durch dessen Boden zwei Luftroͤhren gehen, a, a, welche oben und unten offen sind, und in
gegenwaͤrtigem Falle, durch das Oel laufen, mit welchem die Lampe
gefuͤllt ist. Dieß ist jedoch nicht unumgaͤnglich nothwendig; denn sie
koͤnnen, wenn man dem Koͤrper der Lampe eine andere Form gibt, auch an
der Außenseite desselben hinlaufen. Der abgestuzte Kegel, bd, stellt den oberen Theil des Koͤrpers
der Lampe vor, welcher wesentlich zu dem Glanze der Flamme beitraͤgt, indem
er die Zugluft von Außen abhaͤlt, welche bei einer groͤßeren
Oberflaͤche bb mit gerade aufrechter
Schulter Statt haben wuͤrde. Dieser Koͤrper enthaͤlt den
Dochthaͤlter B
Fig. 4, 5, eine flache
Roͤhre, an welcher das Metall, woraus sie gebildet ist, sich an einer Seite
nach Unten zu in krummer Richtung beinahe bis an den Boden des Koͤrpers der
Lampe hin verlaͤngert, um den Docht zu stuͤzen, und dem Oele oder den
anderen brennbaren Materialien das Aufsteigen erleichtert. Diese Roͤhre ist
in einer konvexen kreisfoͤrmigen Platte befestigt, welche auf 3 oder 4
innenwendig in dem kegelfoͤrmigen Theile bb
des Koͤrpers der Lampe hervorstehenden Theilen ruht, und das Oel oder die
anderen brennbaren Koͤrper in der Lampe bedekt, und vor Schmuz und gegen die
Einwirkung der Flamme sichert: sie hat zwei Spalten oder Loͤcher, wie man in
Fig. 6 und
9 sieht,
um die Luftroͤhren aa in dem Koͤrper
der Lampe durchzulassen. Wenn Fett, Talg, Wachs, Wallrath oder irgend ein anderes
brennbares Materials angewendet wird, welches in einem Zustande von Fluß erhalten
werden muß, so ist noch eine andere Roͤhre unterhalb angebracht, um einen
Metalldraht P, Fig. 2, durchzulassen,
welcher bis auf den Boden des Koͤrpers der Lampe reicht, und dessen oberes
Ende oben aus derselben hervorragt, und so nahe an dem Ende der Flamme steht, daß er
dadurch hinlaͤnglich erhizt wird, um den Boden des Koͤrpers der Lampe
zu erwaͤrmen, und auf diese Weise den brennbaren Koͤrper fluͤßig und zum
Verbrennen tauglich zu erhalten. Wo man Oel anwendet, ist dieß nicht noͤthig,
weil dasselbe durch die Naͤhe der Flamme selbst stets in gehoͤriger
Temperatur erhalten wird. Der Koͤrper der Lampe A
wird von dem aͤußeren Gehaͤuße C, Fig. 2. und
7.
aufgenommen, aus dessen Boden eine Roͤhre hervortritt, durch welche ein
eigener Luftzug nach dem Boden der Lampe hin gebildet werden soll. An dem Boden
dieser Roͤhre befindet sich eine bewegliche Kappe c, deren Wand mit einer Menge von Loͤchern oder Einschnitten
durchbohrt ist, so, daß, wenn man diese Kappe auf- oder niederschiebt, sie
den Dienst eines Regulators oder Registers leistet, wodurch die Menge der frischen
Luft, welche eingelassen werden muß, um das Verbrennen der brennbaren Materialien zu
unterhalten, zugelassen und regulirt werden kann: nachdem die Luft durch die
Luftroͤhren aa in dem Koͤrper der
Lampe A durchgezogen ist, wird sie an jeder Seite der
Flamme in Stroͤmen auf dieselbe hingeleitet, so, daß sie auf dieselbe in
jenem Grade von Staͤrke wirken kann, welcher nach der Erfahrung fuͤr
den Glanz der Flamme der zutraͤglichste ist. Der obere Theil dieser
Roͤhre tritt etwas uͤber dem Boden des aͤußeren
Gehaͤuses oder Behaͤlters C hervor, um
jenes Oel oder Fett aufzufangen und aufzuhalten, das allenfalls in den Boden des
Gehaͤuses herabtroͤpfeln koͤnnte, und zu hindern, daß es nicht
in die Roͤhre selbst faͤllt. Auf dem flachen oberen Theile des
Koͤrpers der Lampe A sind drei oder mehrere
duͤnne und schmale Metall-Plaͤttchen d,
d, d angebracht, welche den glaͤsernen Rauchfang oder das
Gewoͤlbe D, Fig. 8. so stuͤzen,
daß sie einen dritten Luftzug unter demselben, und den schief oder
kegelfoͤrmig zulaufenden Seiten des oberen Theiles des Koͤrpers der
Lampe erzeugen, welcher Luftzug den Docht der Lampe weit laͤnger brennen
laͤßt, ohne daß dieser noͤthig haͤtte, gepuzt zu werden, und
zugleich auch einen gehoͤrigen Grad von Temperatur der Luft unmittelbar um die sie
umgebende Flamme unterhaͤlt, waͤhrend er jedem Theile derselben die
noͤthige Menge Luft in einem zur Verbrennung geeigneten Zustande
zufuͤhrt. E, Fig. 1, 2, 10, ist ein metallner
Ring mit zwei Einschnitten in demselben um die hervorragenden Theile ee, welche an dem Behaͤlter der Lampe C, Fig. 1, 2, 7, angebracht sind,
durchzulassen. Wenn diese hervorragenden Theile eingefuͤhrt sind, und gegen
die rechte Seite hin gedreht werden, bis sie in Beruͤhrung mit den
Haͤltern ff an dem oberen Theile des Ringes
E kommen, so findet sich das Gehaͤuse C, welches der Koͤrper der Lampe A enthaͤlt, in seiner gehoͤrigen Stellung
gegen den besagten Ring. Der Koͤrper der Lampe A
hat eine Hervorragung E, Fig. 1, 2 und 3, welche in eine
Hoͤhlung paßt, die fuͤr dieselbe an der Wand des Gehaͤuses C angebracht ist. Hiedurch wird der Koͤrper der
Lampe in seiner gehoͤrigen Stellung in dem Gehaͤuse C gehalten, und dadurch auch die Flamme in die
gehoͤrige Lage gegen die Reverberen gebracht, wie unten gezeigt werden wird.
Die Haͤlter ff, Fig. 10, hindern
zugleich, daß das Gehaͤuse C auf die unrechte
Seite gedreht werden kann, wenn man dasselbe in den Ring E bringt, und bestimmen dadurch zugleich die gehoͤrige Lage der
beiden Traͤger ee, wenn das Gehaͤuse
aus dem Ringe genommen werden soll. Zwei Arme GG,
Fig. 1,
wovon auch einer in Fig. 2 dargestellt ist, springen an jeder Seite bei diesen
Hoͤhlungen aus dem Ringe hervor, und sind mit Fugen versehen, um die Enden
der herabsteigenden Fuͤße hh des metallnen
Rauchfanges F aufzunehmen, welche Enden bei gg an dem Ringe E
angenietet, oder auf eine andere Weise befestigt sind, und so die Lampe A in ihrem Gehaͤuse C
mit dem besagten metallnen Rauchfange F verbinden. In
diesem Rauchfange sind zwei Einschnitte, ii, Fig. 1, 2 und 11, welche zur
Aufnahme einer metallnen duͤnnen Gabel G dienen,
welche durch dieselben in das Innere dieses metallnen Rauchfanges F
tritt, und dadurch den glaͤsernen Rauchfang D
mittelst des Randes an dem oberen Ende, wie Fig. 8 und 12 zeigt, in dem
metallnen Rauchfange F festhaͤlt, wenn die Lampe
A, und ihr Gehaͤuse C weggenommen werden. Die Gabel G, wird in dem
metallnen Rauchfange F mittelst des Stiftes H, Fig. 1, 2 und 13, an ihrer Stelle
festgehalten, welcher durch Loͤcher in dem oberen Theile von einem der
Fuͤße h, und durch die Gabel selbst durchgestekt
wird. Wenn der glaͤserne Rauchfang D abgenommen
werden soll, so kann dieß dadurch geschehen, daß man den Stift H herauszieht, und die Gabel G wegnimmt: auf die entgegengesezte Weise wird derselbe wieder an seine
Stelle in dem metallnen Schornsteine F gebracht. An dem
oberen Theile des metallnen Schornsteines F sind zwei
Haken, jj befestigt, Fig. 2, deren untere
Theile in rechten Winkeln umgebogen sind, und bei r, r
ein Loch haben; dessen Nuzen unten erklaͤrt werden soll. Durch diese Haken
jj wird die ganze Lampe mit ihren Reverberen,
deren Form und Einrichtung unten genauer beschrieben werden soll, an der Querstange
I aufgehaͤngt: der Theil derselben zwischen
diesen Haken, jj, ist nach der Seite
gekruͤmmt, theils damit sie nicht den freien Austritt der erhizten Luft aus
der Lampe hindert, theils um genau die Lage zu bestimmen, in welcher diese Haken jj an derselben angebracht werden muͤßen,
so daß naͤmlich die Lampe in der Mitte des Glases J zu haͤngen kommt. Die Enden der Querstange I sind unter rechten Winkeln abwaͤrts gebogen, und passen in Ringe
kk, welche in dem Metall-Ranfte k angebracht sind, der das Glas J stuͤzt, und dadurch in der gehoͤrigen Lage erhalten wird.
Aus dem unteren Theile des metallnen Rauchfanges F
treten zwei Haken l, l, Fig. 2, hervor, welche
durch zwei Loͤcher, SS, in den
Reverber-Fluͤgeln, LL, laufen, und
dadurch die an dem metallnen Rauchfange F
zunaͤchst stehenden Enden derselben tragen, waͤhrend die gegenuͤberstehenden
Enden dieser Fluͤgel frei bleiben, und, nach Umstaͤnden, gehoben oder
gesenkt werden koͤnnen. An den Enden dieser Reverber-Fluͤgel,
welche dem metallnen Rauchfange F zunaͤchst
stehen, ist ein kreisfoͤrmiger Theil von jedem weggeschnitten, so, daß sie
durchgehen und so nahe als moͤglich an einander kommen koͤnnen, um die
moͤglich groͤßte Menge von Lichtstrahlen, welche oben aus der Flamme
der Lampe A ausstroͤmen, aufzufangen und
zuruͤkzuwerfen. An dem metallnen Rauchfange befinden sich daselbst auch
hervorragende Raͤnder oder kleine Gesimse, auf welchen die Fluͤgel der
Reverbere ruhen koͤnnen. An diesen Fluͤgeln, LL, befindet sich noch uͤberdieß ein Haken,
M, M,
Fig. 1, 2, und 14, der bei
n, n ein Knie und eine Schraubenmutter o, o hat, in welche die Haken p,
p eingeschraubt werden koͤnnen. Wenn diese Schrauben-Haken
p, p mit ihren Nieten q,
q in die Loͤcher r, r, der Haken j, j, gebracht sind, so ist das Gehaͤnge der
Reverber-Fluͤgel, L, L, fertig, welche nun
mittelst der Haken p, p an ihren von dem
Metall-Rauchfange am weitesten entfernt stehenden Enden aufgezogen oder
niedergelassen werden koͤnnen, so, daß sie den von ihnen
zuruͤkzuwerfenden Lichtstrahlen eine mehr horizontale oder auf- oder
abwaͤrts geneigte Richtung, je nachdem es die Umstaͤnde erfodern,
geben koͤnnen. Nachdem die Reverber-Fluͤgel in die
gehoͤrige Stellung gebracht wurden, koͤnnen sie mittelst der
Schrauben-Nieten, q, q, die mit den geknieten
Haken M, M, bei o, o in
Verbindung gebracht werden, Fig. 2. in derselben
erhalten werden. Das Glas J wird mit seinem Dekel N auf die gewoͤhnliche Weise versehen, und in dem
eisernen Ringe des Lampen-Eisens mittelst drei oder mehrerer an den Ranft k angeloͤtheter Zungen (wovon zwei in ss dargestellt sind,) festgehalten. Am Boden des
Glases J ist eine Oeffnung, die weit genug ist, daß ein Mann mit seiner Hand
durch dieselbe hinein kann, um die Lampe A in ihr
Gehaͤuse C einsezen, und aus demselben
herausnehmen zu koͤnnen. Das Glas hat einen an dasselbe angekitteten
Metall-Ranft O, um welchen zwei hervorragende
Gesimse laufen, zur Aufnahme des Metall-Ringes t,
t. An diesem Ringe t, t befindet sich ein Angel
u aus einem Stuͤke Metall oder ein metallner
mit einem Stuͤke Glas ausgefuͤllter Ring, wodurch jene Oeffnung
geschlossen wird, und der in jede beliebige Lage gedreht werden kann, so, daß er,
wenn er herabhaͤngt, die Lampe, wenn sie angezuͤndet werden soll,
gegen den Wind schuͤzt. Wenn das Glas geschlossen werden soll, so wird er
durch die Feder s in seiner Lage erhalten; bei dem Ringe
w wird dasselbe geoͤffnet.
Wir haben diese Lampe hier so genau und umstaͤndlich als moͤglich
beschrieben, damit, wo der Termin unseres Patentes verlaufen seyn wird, jeder unsere
Erfindung alsogleich selbst benuͤzen kannBald nach Erscheinung dieses Patentes ward Bond-Street
praͤchtig erleuchtet durch diese Lampen und Reverberen, und man
brauchte deren nur Eine, wo ehevor zwei standen. Das Licht war so stark, daß
man nicht bloß das Gesicht der Personen, die auf dem Trottoir giengen,
sondern selbst derjenigen, die mitten in der Straße in Kutschen fuhren,
erkennen konnte. A. d. O..
Die auf Tab. V. Nr. 2 dargestellte Lampe fuͤr Zimmer, Hallen und andere
Oerter, wo das Licht nur in die Runde umher in horizontaler Richtung
gleichfoͤrmig verbreitet werden soll, hat, statt der
Fluͤgel-Reverberen, die fuͤr Straßen-Lampen
gehoͤren, nur eine Kreisfoͤrmige.
Der Bau dieser Lampe ist dem, so eben in der Zeichnung Nr. 1 beschriebenen, der
vorigen Lampe sehr aͤhnlich, so, daß wir hier nur auf die Unterschiede
aufmerksam machen duͤrfen. Der Koͤrper der Lampe A (dieselben Buchstaben bezeichnen hier dieselben Gegenstaͤnde,
wie in der Zeichnung Nr. 1) hat keinen Vorsprung wie bei E, und in dem Gehaͤuse C und in E ist keine Aushoͤhlung zur Aufnahme desselben,
indem die Stellung der Flamme bei der kreisfoͤrmigen Reverbere beinahe
gleichguͤltig ist. Der Behaͤlter kann die Form einer Vase oder eine
beliebige andere Gestalt bekommen. In den Enden der Fuͤße h, h,Im Originale
ist durch Drukfehler p, p. A. d. Ueb.
welche von dem metallnen Rauchfange F herabsteigen, sind
hier mehrere Loͤcher statt eines einzigen (wie in Nr. 1. der Fall ist), um
den Ring E, welcher die Lampe A in ihrem Gehaͤuse C haͤlt,
hoͤher und niedriger stellen, und dadurch die Flamme dem Reflektor Q naͤhern, oder von demselben entfernen, und
folglich die zuruͤkgeworfenen Lichtstrahlen nach Belieben uͤber eine
groͤßere oder kleinere Flaͤche unter der Lampe verbreiten zu
koͤnnenEs ist offenbar, daß
diese Vorrichtung etwas langweilig ist, und eine Stellschraube dasselbe weit
leichter und bequemer zu leisten vermag. A. d. Ueb.: hat man die
gewuͤnschte Stellung gefunden, so kann der Ring oder die Lampe in derselben
mittelst der zwei Stifte, die man durch die gehoͤrigen Loͤcher stekt,
befestigt werden. Der untere Theil des metallnen Rauchfanges hat hier gleichfalls
eine andere Form, und ist nicht, wie in Nr. 1 gebildet, sondern zilindrisch, mit
einem nach auswaͤrts rings umher hervorstehenden Rande, damit die
kreisfoͤrmige Reverbere darauf ruhen kann. Auch die Stellen, wo die beiden
metallnen Haken, j, j, sich befinden, sind hier
abgeaͤndert, damit der kreisfoͤrmige Reflektor uͤber dieselben
weglaufen kann, und dieß zwar mittelst der zwei Ausschnitte an jeder Seite des
kreisfoͤrmigen Loches in dem Mittelpunkte desselben, durch welche die
Schenkel der Fuͤße hh durchlaufen, und
durch welche die Reverbere zugleich auf jenen Rand aufgelehnt wird.
Durch die beiden metallnen Haken jj, kann die Lampe
zugleich unter einer glaͤsernen oder metallnen Scheibe aufgehaͤngt
werden, damit der Rauch die Deke nicht verdirbt.
Die Weise, nach welcher die Luft, die zum Verbrennen des angewendeten brennbaren
Materiales hier noͤthig ist, regulirt wird, ist gleichfalls
abgeaͤndert; die Kappe c ist ganz und die
Einschnitte oder Oeffnungen, durch welche die Luft eintreten soll, befinden sich an
dem unteren Ende der Roͤhre C.
Auch diese Lampe kann in einem glaͤsernen Gehaͤuse J, wie in Fig. 1, Nr. 1,
aufgehaͤngt und eingeschlossen werden, was jedoch in einem Zimmer nicht
noͤthig ist, um so weniger, als hier der Bau des Luft-Registers C so geaͤndert ist, wie Fig. 23 und 24 zeigen, und
die Luft zwingen in die Roͤhre C nach oben, durch
ihren Boden, und nicht seitwaͤrts, einzudringen, und dadurch jede
Stoͤrung der Flamme durch einen allenfalls entstehenden Zug verhindern.
In dieser Hinsicht befindet sich an dem Grunde der Roͤhre C eine Metallplatte mit einem Loche in ihrem
Mittelpunkte, und einem, zwei, drei oder mehreren anderen Loͤchern ringsumher
um ihren Umfang in der Entfernung ihrer Durchmesser voneinander. Eine andere
aͤhnliche Metallplatte, mit aͤhnlichen Loͤchern und
Zwischenraͤumen, befindet sich entweder ober oder unter der vorigen, und
mittelst einer Achse, welche durch sie laͤuft, an der vorher
erwaͤhnten Platte befestigt ist, und nach Unten in einen Knopf sich endet,
kann die lezt erwaͤhnte Platte so gedreht werden, daß sie die besagten
Loͤcher alle oͤffnet oder schließt, und so, wie es noͤthig
wird, der Luft mehr oder minder freien Zugang gestattet. In Fig. 17 ist Q ein Grundriß der kreisfoͤrmigen Reverbere, mit
zwei Ausschnitten an jeder Seite des kreisfoͤrmigen Loches im Mittelpunkte
derselben. Die Figuren 18, 19, 20 und 21 zeigen in QQ, vier verschiedene Durchschnitte durch die
Mittelpunkte der kreisfoͤrmigen Reverbere, welche einige Abaͤnderungen
zeigen sollen, die
wir an der reflektirenden Kruͤmmung anbrachten, je nachdem sie
naͤmlich zu verschiedenen Zweken dienen soll.
Fig. 22 zeigt
eine Tischlampe zu haͤuslichem und anderem Gebrauche, die gleichfalls mehrere
Theile mir der Fig.
16 beschriebenen Lampe, die Buchstaben fuͤr dieselben Theile aber
alle gemein hat. Das Gehaͤuse C, welches den
Koͤrper der Lampe A enthaͤlt, ist wie in
der Lampe Fig.
16, nur ist die Roͤhre laͤnger, um die Flamme
gehoͤrig uͤber den Tisch zu erheben. An dem untern Ende derselben ist
ein Fuß R angebracht, damit die Lampe fest auf dem Tisch
stehen kann. Die Weise, wie der Luftzug hier regulirt wird, der zur Verbrennung
noͤthig ist, ist folgende: An dem untern Thele der Roͤhre ist ein
beweglicher Ring angepaßt, S, mit Loͤchern und
Zwischenraͤumen, die dem Durchmesser derselben gleich sind. Der untere Theil
der Roͤhre hat gleichfalls solche Loͤcher und Zwischenraͤume,
welche mit jenen in dem Ringe korrespondiren, so, daß, je nachdem man den Ring mehr
oder minder auf die eine oder auf die andere Seite dreht, nach Beduͤrfniß
mehr oder minder Luft zugelassen werden kann. Bei T sind
zwei metallene Arme, welche an der kreisfoͤrmigen Reverbere befestigt sind,
und deren untere Theile in zwei Ringe passen, die sich in dem Gehaͤuse C befinden, und die Reverbere stuͤzen. Hiedurch
wird zugleich der glaͤserne Rauchfang vor dem Falle bewahrt. Wenn man die
Lampe aber ohne Reflektor braucht, so muß der glaͤserne Rauchfang mittelst
eines Ringes festgehalten werden, welcher mit Armen von Metall verbunden ist (die
die punktirten Linien zeigen) und deren beide Enden in die besagten Ringe an den
Seiten des Gehaͤuses C passen. Der untere Theil
des glaͤsernen Rauchfanges D ruht auf dem flachen
Koͤrper der Lampe A, und wird daselbst mittelst
drei oder mehrerer Metallstifte, wovon zwei bei d, d,
dargestellt sind, und
die sich an die Außenseite des glaͤsernen Rauchfanges anlegen, in seiner
gehoͤrigen Lage erhalten.
Aus dem Maͤrz-Stuͤke von
Gill's
technical Repository. S. 162.Nr. III. stellt Fig. 75 eine Lampe zur
Beleuchtung von Hallen, Durchgaͤngen, Treppen u. d. gl. dar, und kann auch
als Steh- oder Tischlampe gebraucht werden. Sie hat einige Theile mit der
Lampe Fig.
22. Nr. II. und dieselben Buchstaben gemein. Ihre
Unterschiede sind folgende: Die Roͤhre C ist
kuͤrzer, und unter dem beweglichen Ringe c des
Luftregisters S ist eine Basis oder Fuß W, angebracht, in welchem sich noch eine andere
Roͤhre X befindet, die etwas verduͤnnt
zulaͤuft und dazu dient, die Lampe in den Hals eines Leuchtets oder in die
Buͤchse einer Glasvase zu stellen, wie es bei Lampen an Durchgaͤngen
gewoͤhnlich ist. Im leztern Falle kann die kreisfoͤrmige Reverbere
auch mittelst der Kette und der Haken y, y, y in einem
glaͤsernen Gehaͤuse aufgehaͤngt werden, und wird das Loch im
Mittelpunkte weiter gemacht, wie bei Z, so hindert die
Reverbere nicht, daß das Licht auch in die Hoͤhe steigt, und doch noch immer
Lichtstrahlen genug unter die Lampe zuruͤkgeworfen werden. Will man diesen
kreisfoͤrmigen Reflektor bei einer Tischlampe brauchen, so kann er mittelst
daran befestigter Arme daruͤber gehalten oder in einem Einsaze, der sich auf
dem Traͤger des glaͤsernen Rauchfanges D
schieben laͤßt, befestigt werden.
In der Zeichnung Nr. IV.
Fig. 30 ist
eine Art dargestellt, nach welcher eine kreisfoͤrmige Reverbere R an eine gemeine Patent-Lampe mit einem
kreisfoͤrmigen Oelbehaͤlter uͤber derselben angebracht werden
kann. In dieser Hinsicht ist naͤmlich ein Haken an der Roͤhre
befestigt, welche aus diesem Behaͤlter hervortritt, und an der einen Seite
der Reverbere befindet sich ein Ausschnitt zur Aufnahme dieser Roͤhre, und dicht neben diesem
Ausschnitte ein Loch zur Aufnahme des Hakens, wodurch die Reverbere an dieser Seite
gehalten wird. An der andern Seite der Reverbere ist ein kleines, mit einem Loche
versehenes Stuͤk befestigt, und ein anderes Loch befindet sich unter dem
Behaͤlter. Wenn nun die Reverbere in dem an der Roͤhre des
Behaͤltes befindlichen Haken eingehaͤngt ist, so wird ein metallener
Stift durch obige Loͤcher an der entgegengesezten Seite gestekt, und die
Reverbere ist so sicher befestigt.
Fig. 31.
derselben Zeichnung zeigt unsere Methode, einen, zwei oder mehrere Brenner mit einem
Dochte oder mit zwei flachen Dochten in jedem derselben, oder einen oder zwei
Brenner mit runden Dochten an einem solchen Gefaͤße oder Oelbehaͤlter
auf einem Fuße und von gewoͤhnlicher Art, mittelst unserer
kegelfoͤrmigen Schrauben-Kniee so anzubrigen, daß einer oder der
andere derselben nach Belieben gebraucht und leicht zum Puzen oder zu andern Zweken
weggenommen werden kann. B ist ein Brenner, der aus
einer metallenen Roͤhre oder aus einem Metallkoͤrper besteht, und das
Oel in sich haͤlt. C ist ein Dochthaͤlter
mit zwei flachen parallelen Dochten ccn einer
Luftroͤhre zwischen denselben, deren unteres offenes Ende ein Register F hat, um die zum Verbrennen des angewendeten Oels
noͤthige Luft zuzulassen und zu reguliren. D ist
ein Glasgewoͤlbe oder ein glaͤserner Rauchfang, welcher bei dd gewoͤlbt ist, und nach Oben sich in eine
enge Roͤhre verschmaͤlert: er tritt tiefer unter die Flamme hinab, als
in den beschriebenen Lampen, und paßt in einen eigenen Traͤger E, welcher bei e eine
Federroͤhre besizt, und dadurch in den Stand gesezt wird, außen an dem
Koͤrper des Brenners B anzuschieben, so, daß er
auf und niedergeschoben und in der verlangten Stelle nach Belieben erhalten werden
kann: uͤberdieß befindet sich noch ein Ring oder Reifen uͤber
demselben, ff, um den glaͤsernen Rauchfang
zu umfassen, und fest zu
halten. In dem Theile des Traͤgers E, auf welchem
der glaͤserne Rauchfang ruht, befindet sich eine Menge Loͤcher, um
durch dieselben einen neuen Luftzug zu erzeugen, welcher sich mit Schnelligkeit
zwischen dem Koͤrper des Brenners B, und dem
verlaͤngerten Theile des glaͤsernen Rauchfanges D bewegt, und von dem Gewoͤlbe desselben, d,
d, auf die Flamme zuruͤkgeschlagen, das Verbrennen des Oels
vollendet: die erhizte und zersezte Luft entweicht dann mit Schnelligkeit durch die
engere Roͤhre des Rauchfanges. Dieser Theil des Traͤgers mit seinen
Loͤchern ist unter E in Fig. 37 besonders
dargestellt. Eine andere Verbesserung im Baue dieser Lampe besteht in Entfernung des
Ringes oder des Reifes f, f, des Traͤgers E; in dem der glaͤserne Rauchfang D soweit unter die Flamme der Lampe verlaͤngert
ist, daß der Ring oder Reif f, f die Lichtstrahlen in
ihrer Verbreitung nach allen Seiten hin nicht hindern kann. Der Dochthaͤlter
C wird von dem Koͤrper der Lampe B auf drei oder mehreren kurzen Stiften, wie g, g, g, sind, getragen. g
ist ein kleiner glaͤserner Becher, der in einem Metallringe gehalten wird, um
das Oel aufzufangen, welches allenfalls durch den Brenner ablaufen koͤnnte.
Fig. 32
und 33 stellt
den doppelten Dochthaͤlter des Brenners, von zwei verschiedenen Seiten
gesehen, vor. In Fig. 34 ist eine Lampe, bestehend aus einer Metallroͤhre oder
einem Koͤrper zur Aufnahme des Oels mit einem Dochthaͤlter H mit flachen Dochte: der obere Theil dieser
Roͤhre laͤuft, an jeder Seite sich verschmaͤlernd, schief nach
oben i, i zu, um die frische Luft, welche durch die
Loͤcher in den Traͤger E des
glaͤsernen Rauchfanges D eindringt, wie die Fig. 31 so
eben beschrieben wurde, in zwei Stroͤmen an jeder Seite der Flamme zu leiten.
Der Dochthaͤlter h kann entweder durch 4 kurze
Stifte innerhalb des Koͤrpers des Brenners gestuͤzt werden, wovon zwei
bei g, g dargestellt sind, oder, wie in Fig. 35 und 36, wo der
einzelne Dochthaͤlter in zwei verschiedenen Lagen dargestellt ist, mittelst
Haken jj, welche an jedem Ende hervorragen, und
wodurch er oben an dem Koͤrper des Brenners gestuͤzt werden kann. Fig. 49, 50 und 51, zeigen
andere Gestaltungen des Traͤgers E des
glaͤsernen Rauchfanges D, so, daß er zugleich als
Register beim Einlassen der Luft dienen kann. Statt der Loͤcher an dem
Theile, welcher den glaͤsernen Rauchfang traͤgt, ist der
Traͤger hier aus zwei Metall-Platten gebildet, deren jede ein Loch,
oder zwei, drei und mehrere aͤhnliche Loͤcher mit
Zwischenraͤumen von gleichem Durchmesser mit denselben besizt. Da die untere
Platte mittelst eines Zapfens p, der unten hervorsteht,
gedreht werden kann, so, daß sie diese Loͤcher mehr oder minder schließt, so
wird dadurch auch mehr oder minder Luft, wie es eben noͤthig ist,
eingelassen. Statt einer Feder-Roͤhre, um den Traͤger E des glaͤsernen Rauchfanges an dem Brenner der
Lampe zu befestigen, wie in Fig. 31 und 34, kann die
Roͤhre k bei 11 zur Haͤlfte, und dann
wieder bei m getheilt seyn, so, daß sie außen an dem
Brenner B
Fig. 31, H
Fig. 34, oder
J
Fig. 38,
loker anliegt, und da die beiden Enden n, n unter
rechten Winkeln gebogen und durchgebohrt, und mittelst einer Schraube o verbunden sind, so kann sie, wenn diese Schraube
angezogen wird, in jeder beliebigen Lage außen an dem Brenner erhalten werden. Fig. 38, g ist ein Laͤngen-Durchschnitt des
Brenners mitten durch den Zilinder, mit einem runden Dochte und einer Vorrichtung,
denselben aufzuziehen. Die verschiedenen Theiler des Brenners sind in den Fig. 39, 40, 41, 42, 43, und 44, unter
gleichen Buchstaben fuͤr dieselben Theile, dargestellt. Fig. 30 zeigt den
Koͤrper des Brenners, welcher das Oel enthaͤlt: er besteht aus zwei
Roͤhren, wovon die innere an ihrem unteren Theile an der aͤußeren
befestigt ist. Da sie unten offen ist, hat sie ein Luft-Register, F,
um einen Theil der die Verbrennung des Oeles unterhaltenden Luft zu reguliren, und
eine hervorstehende Rippe q, deren Nuzen wir unten
zeigen werden. An dem unteren Theile der aͤußeren Roͤhre ist eine
kurze Roͤhre a angebracht, welche außen mit einer
maͤnnlichen Schraube versehen ist, und die innenwendig kegelfoͤrmig
zulaͤuft: ihr Nuzen wird sogleich erhellen. Durch die aͤußere
Roͤhre gehen dort, wo die oben beschriebene kurze Roͤhre daran
befestigt ist, Loͤcher, um das Oel zufließen zu lassen, und jeden fremden
Koͤrper abzuhalten. Fig. 40 zeigt jenen Theil
des Brenners, k, welcher zum Emporschieben des Dochtes
dient. Er besteht aus zwei Roͤhren, welche oben an einander befestigt sind,
und hinlaͤnglichen Raum zwischen sich lassen, um die aͤußere
Roͤhre, Fig.
39, I dazwischen aufzunehmen. Die innere
Roͤhre hat eine spiralfoͤrmige Furche oder einen
spiralfoͤrmigen Kanal r, r, r, r etc. an ihrer
inneren Seite. Fig.
42 und 43 sind zwei verschiedene Ansichten von dem Dochthaͤlter, einer
kurzen Roͤhre, deren obere Außenseite zur Haͤlfte einen kleineren
Durchmesser hat, als die untere, um den runden Docht der Lampe auf derselben
aufzunehmen, welcher durch den duͤnnen Metallring, Fig. 44, der
daruͤber gestekt wird, in seiner Lage erhalten wird. Dieser
Dochthaͤlter gleitet in der inneren Roͤhre des Brenners I
Fig. 39 auf
und nieder, und wird durch eine Furche s innerhalb
derselben, welche die oben beschriebene Rippe qq
in Fig. 39
aufnimmt, gehindert sich zu drehen. Die aͤußere Oberflaͤche des
unteren Theiles des Dochthaͤlters hat eine Menge senkrechter Furchen rund um
dieselbe, wie Fig.
42 sie darstellt, um mittelst derselben das Oel zu dem Dochte gelangen zu
lassen, und hat uͤberdieß noch einen kurzen Stift oder Zapfen t angesezt, welcher in der spiral- oder
schraubenfoͤrmigen Furche r, r, r, etc.
innenwendig in der Roͤhre k, Fig. 40, wie oben
beschrieben wurde, fortschiebt, so, daß, je nachdem man diese Roͤhre auf eine oder auf die
andere Seite dreht, der Dochthaͤlter entweder gehoben oder gesenkt wird. Fig. 41 ist
ein metallner Ring, welcher oben in die Roͤhre k,
Fig. 40,
innenwendig paßt, und innen kegelfoͤrmig zulaͤuft; er dient den Docht
zusammenzuhalten.
An diesem Brenner ist der glaͤserne Rauchfang D
und sein Traͤger E eben so angebracht, wie Fig. 31 und
34; und
da lezterer mittelst einer Feder- oder Schrauben-Roͤhre, e oder k, an der
aͤußeren Roͤhre K, Fig. 40, befestigt ist,
so muß, wenn er rechts oder links gedreht wird, die aͤußere Roͤhre K folglich mitgedreht, und dadurch der Docht gehoben
oder gesenkt werden. Fig. 45, 46, 47 und 48, zeigt die Theile,
welche unser kegelfoͤrmiges Schrauben-Knie bilden, in verschiedenen
Lagen. Fig.
45 ist ein Theil der Roͤhre, welche aus dem Behaͤlter A, Fig. 31, hervortritt mit
dem Theile a des Kniees an demselben. Dieser Theil ist
nach Außen an seinem Ende kegelfoͤrmig, und so gebildet, daß er genau in den
kegelfoͤrmigen Theil der kurzen Schrauben-Roͤhre a, welche an den Brennern B,
Fig. 31,
H, Fig. 34 und I, Fig. 38 und 39 befestigt
ist, paßt. Diese Roͤhre, Fig. 45, hat noch
uͤberdieß eine hervorstehende Schulter bei uu, fuͤr den inneren Theil des Schrauben-Ringes a
Fig. 46 und
47, um
gegen denselben zu druͤken, und da dieser Ring außen auf die kurze
kegelfoͤrmige Roͤhre a, Fig. 34, 38 und 39, aufgeschraubt ist,
entweder durch seine gezaͤhnelte Kante, oder mit der Schraubgabel Fig. 53, deren
Arme man in seine zu dieser Absicht in der gezaͤhnelten Kante angebrachten
Ausschnitte v, v einsezt, so werden dadurch die
konischen Theile des Knies a in genaue Beruͤhrung
gebracht, und die Verbindung wird hinlaͤnglich sicher. Fig. 52 zeigt in
punktirten Linien eine Anwendungs-Art unserer eifoͤrmigen Reverberen,
welche das Licht nur in einer Richtung (wie unten beschrieben wird)
zuruͤkwerfen, an irgend einer Lampe mit einem oder mit zwei runden oder flachen Dochten.
Die Zeichnung Nr. 5 Tab. VI. stellt eine Art und Weise dar, wie man einen unserer
Brenner mittelst unsers kegelfoͤrmigen Schrauben-Knies an einem
uͤber der Lampe befindlichen Oelbehaͤlter anbringen kann. A, Fig. 1, zeigt einen
Brenner mit zwei flachen Dochten, mit seiner Luftroͤhre und mit dem Register,
dem glaͤsernen Schornsteine und dem Traͤger, wie diese bereits
beschrieben wurden. Er ist an der Roͤhre B
mittelst des besagten kegelfoͤrmigen Schrauben-Kniees befestigt. Diese
Roͤhre B laͤßt sich auf der inneren
Roͤhre C, welche von dem Oelbehaͤlter D herabsteigt, auf- und abwaͤrts schieben.
C wird vor dem Herabfallen durch einen Einschnitt
ε in der Metallfeder E, welche an dem Oelbehaͤlter befestigt ist, gesichert, indem
dieser Einschnitt das Metallstuͤk b, welches in
der Mitte eine Oeffnung hat, und die Feder E
durchlaͤßt, aufnimmt. Diese innere Roͤhre C hat bei c eine kegelfoͤrmige Klappe
von gewoͤhnlicher Form, und die aͤußere Roͤhre B hat eine Metallplatte, welche durchloͤchert und
bei d befestigt ist: diese nimmt den Schenkel oder Fuß
der konischen Klappe auf, und hebt folglich die Klappe selbst, wenn die
Roͤhre B in die in der Zeichnung vorgestellte
Lage hinaufgeschoben wird, und laͤßt hiedurch das Oel aus dem
Behaͤlter D zur Lampe oder zum Brenner A fließen. Eine halbzillndrische Roͤhre f, welche unten geschlossen, oben aber offen ist, ist an
der Seite der aͤußeren Roͤhre B befestigt,
und steht mit der inneren Seite derselben mittelst einer Oeffnung m in Verbindung, um der Luft Zutritt zu gestatten, und
das Oel fließen zu lassen. Der Behaͤlter D hat
einen Sperrhahn, F, mit einem Trichter, durch welchen er
gefuͤllt werden kann, wenn die Klappe, c,
geschlossen ist, was durch Herabziehen der Roͤhre B und des Brenners A zugleich mit demselben in die durch die
punktirten Linien angezeigte Lage geschieht; ehe man diese Klappe durch das
Hinaufschieben des Brenners A und der Roͤhre B in die vorige Lage oͤffnet, muß der Hahn
geschlossen werden. Der Behaͤlter D wird von der
Platte G getragen, welche an dem metallnen Schornsteine
H befestigt ist, dessen oberer Theil zwei metallne
Haken gg fuͤhrt, mittelst welcher die ganze
Lampe an der Querstange J aufgehaͤngt wird. Zwei
Einschnitte, hh, an jeder Seite des metallnen
Schornsteines H nehmen die Arme der Gabel i auf, welche den glaͤsernen Schornstein der
Lampe traͤgt, wenn die Lampe abgenommen wird, und zugleich den
Behaͤlter D mit dem metallnen Schornsteine
verbindet.
Zwei Haken kk, Fig. 2. mit einem Loche an
dem unteren Ende derselben zur Aufnahme des kniefoͤrmigen Schraubenhakens der
Fluͤgel-Reverberen sind gleichfalls an dem besagten metallnen
Schornsteine befestigt, wenn diese Fluͤgel-Reverberen an der Lampe,
wie L in Fig. 1 sie darstellt,
gebraucht werden sollen: diese Reverberen werden dann auf die in Nr. 1, Fig. 1, 2
beschriebene Weise gestuͤzt. Wenn man eine kreisfoͤrmige Reverbere
anbringen will, so wird diese von einem kreisfoͤrmigen Ranfte oder
Vorsprunge, der, wie die punktirten Linien zeigen, und wie in Nr. 2 Fig. 1. beschrieben wurde,
um den metallnen Schornstein laͤuft, getragen. Wenn die Lampe
angezuͤndet werden soll, muß der Brenner in die, durch die punktirten Linien
in der Figur angezeigte, Lage herabgezogen werden, und ein zweiter Einschnitt ε in der Feder E
faͤllt dann in das Loch der Platte b, und
haͤlt diese in ihrer Lage. Druͤkt man E
gegen die Roͤhre B, so wird b wieder los, und der Brenner kann, nach Belieben, auf
und abwaͤrts gezogen werden.
Fig. 2 auf
derselben Tafel zeigt den metallnen Schornstein H; G ist
die Platte, welche den Oelbehaͤlter stuͤzt, und von den zwei Haken kk getragen wird, welche, unter der Platte G hervortretend, wieder an jeder Seite des metallnen
Schornsteines aufsteigen, bis sie oben in zwei Haken, kk, sich enden, welche in zwei Einschnitte passen, die zur Aufnahme
derselben in dem oberen Theile des metallnen Schornsteines H angebracht sind, wodurch die Platte G
entfernt werden kann, wenn man eine kreisfoͤrmige Reverbere aufsezen will,
und zur Aufnahme des Behaͤlters D wieder
angebracht werden kann. Bei h zeigt sich einer jener
Einschnitte, der zur Aufnahme der Gabel i bestimmt ist,
und bei ll sind zwei Haken, welche durch
Loͤcher laufen, die in den Fluͤgel-Reverberen zur Aufnahme
derselben angebracht sind, und auf welchen Haken die Reverberen mit ihren
zunaͤchst an dem metallnen Schornsteine stehenden Enden ruhen.
In Fig. 3 ist
D der Oelbehaͤlter mit seinem Sperrhahne,
seiner herabsteigenden Roͤhre C, und seiner
Klappe c, und E die Feder
mit ihren beiden Einschnitten e und ε.
In Fig. 4.
stellt A den Brenner der Lampe mit seinen beiden Dochten
und mit der Luftroͤhre dar. a ist das
kegelfoͤrmige Schraubenknie an der Roͤhre B, mit einem hervorstehenden Stuͤke b,
welches in der Mitte eine Oeffnung hat, durch die die Feder E
Fig. 1 und
3
laͤuft; mit einer durchloͤcherten Platte d, um den Stoͤpsel der Klappe c, Fig. 1 und 3, zu tragen;
und mit einer halb zilindrischen Roͤhre f, die
unten geschlossen, oben offen und an B fest
angeschlossen ist. Diese Roͤhre f steht mit der
Roͤhre B mittelst einer Oeffnung m in Verbindung, um der Luft den Zutritt zu gestatten,
und das Oel in dieser halbzilindrischen Roͤhre oder Cisterne f aufsteigen zu lassen.
Der gegenwaͤrtige Beschluß dieses
Patentes erschien erst im Mai-Stuͤke des technical Repository von Hrn. Gill. Nachdem wir nun im Allgemeinen
das Hauptsaͤchliche unserer Verbesserungen in dem genauesten Detail
beschrieben haben, bleibt uns nur noch uͤbrig, den geometrischen Bau der Form
der Reverberen zu zeigen, damit sie ihrem Zweke vollkommen entsprechen, d.h. jene
Lichtstrahlen der Flamme der Lampe, welche sonst verloren gehen wuͤrden, oder
wenigstens den groͤßten Theil derselben so zuruͤkwerfen, verbreiten
und vertheilen, daß die Oberflaͤche oder der ganze Umfang des zu
beleuchtenden Raumes so gleichfoͤrmig als moͤglich erleuchtet wird. Da
die Art und Weise, wie dieß in jedem einzelnen Falle zu geschehen hat, nothwendig
von der jedesmaligen Form und von dem Umfange der zu beleuchtenden Flaͤche
oder des zu beleuchtenden Raumes abhaͤngt, so ist alles, was hier geschehen
kann, dieß, daß man so klar als moͤglich die Grundsaͤze aufstellt,
nach welchen die Reverberen im Allgemeinen eingerichtet seyn muͤssen, und
dann einige Beispiele zur Anwendung derselben auf die gewoͤhnlichsten
Faͤlle vortraͤgt. Es sey L. in Fig. 5. Tab. VI
Nr. 6. die Flamme der Lampe; AB die Weite der
Oberflaͤche oder des zu beleuchtenden Raumes (welchen wir im vorliegenden
Falle als eine horizontale Flaͤche betrachten); RQ die brauchbare Weite der Reverbere, welche uͤber der Lampe L so angebracht werden soll, daß sie alle jene
Lichtstrahlen auffaͤngt, welche sonst unnuͤz verloren giengen, oder
wenigstens so viele derselben, als nur immer moͤglich ist; R die naͤchste und Q
die weiteste brauchbare Entfernung irgend eines Theiles der Reverbere von der
Lampen-Flamme L, so muͤssen, nach den
bereits aufgestellten Grundsaͤzen, jene Strahlen der Lampe, welche auf R fallen, als den naͤchsten Punkt der Reverbere,
nach B, als den weitesten Punkt der zu beleuchtenden
Flaͤche hingeworfen, und jene Strahlen, welche auf Q fallen, als den weitesten Punkt der Reverbere, auf A, als den naͤchsten Punkt der zu beleuchtenden
Flaͤche, oder gerade unter die Lampe zuruͤkgeworfen werden. Man ziehe also LR und LQ, und
RB und QA.
Da nun die Einfalls- und Zuruͤkprellungs-Winkel einander gleich
sind, so ist offenbar, daß, wenn wir durch R eine gerade
Linie ziehen, pq, und durch Q eine andere Gerade az, so daß der
Winkel LRp gleich ist dem Winkel BRq, und der Winkel LQaEs ist offenbar, daß
im Originale die Linie LQ nicht gezogen
ist; und so alle folgende von L ausgehende
Linien, wir ließen sie daher in unserer Kopie in punktirten Linien ziehen.
A. d. Ueb. gleich dem Winkel AQz diese Linien qp und az Tangenten der krummen Linie seyn werden, welche
die Reverbere bildet, und zwar auf den Punkten R und Q. Man ziehe demnach die Linien pq und az als
Tangenten auf diese Punkte, und die Richtungen, in welchen sie mit der krummen Linie
der Reverbere auf diesen Punkten zusammentreffen, geben folglich auch die lezteren.
Um nun die Richtung der Krummen der Reverbere an einer gehoͤrigen Anzahl von
Zwischenpunkten zu bestimmen, z.B. an vieren, und darnach im Stande zu seyn, die
gehoͤrige Krumme durch diese Punkte zu fuͤhren, ziehe man so viele
gerade Linien LS, LU, LW und LY, so, daß die Winkel RLS, SLU, ULW, WLY, und YLQ unter sich gleich sind, oder so, daß der ganze
Winkel RQL durch die Linien LS, LU, LW, und LY, in gleiche Theile getheilt wird. Man theile die gerade Linie AB in gleiche Theile auf eben so vielen Punkten
zwischen A und B,
naͤmlich auf vier, in C, D, E und F, und ziehe SF, UE,
WD und YC. Man ziehe ferner noch die
Geraden rs, tu, vw, und xy durch die dazugehoͤrigen Punkte S, U, W, und Y, so, daß der
Winkel rSL gleich ist dem Winkel sST, der Winkel TUL gleich ist dem Winkel uUE, der
Winkel vWL gleich ist dem Winkel wWD, und der Winkel xYL gleich ist dem Winkel yYC, so werden
die respektiven Linien rs, tu,
vw, und xy, wenn sie gezogen werden, mit
der erfoderlichen krummen Linie der Reverbere RQ
an jenen respektiven Zwischenpunkten S, U, W und Y zusammentreffen, durch welche die erfoderliche Krumme
RQ sich folglich leicht aus freier Hand wird
ziehen lassen. Wenn wir die ganze beleuchtete Flaͤche uns als
kreisfoͤrmig denken, oder als uͤberall gleichfoͤrmig von der
Lampe entfernt, so wird die Reverbere offenbar eine Figur haben muͤssen,
welche durch Umdrehung der Krummen RQ um LR, als ihre Achse, entsteht, wie bei der
kreisfoͤrmigen Reverbere Q in Fig. 30, Tab. V. Nr. 4.
der beigefuͤgten Zeichnung. Wenn, in einem anderen Falle, der zu beleuchtende
Raum von der Art ist, daß man die Strahlen nur in der Richtung von B von der Lampe zuruͤkgeworfen haben will, dann
ist die eigentliche Form der Reverbere die eines Hutes, welche durch die Umdrehung
der Krummen RQ um die Linie LB als ihre Achse, wie in Fig. 20, entsteht, in der
Zeichnung der Tab. V. Nr. 3. Wenn man sich auf diese Weise ein Paar solide Muster
oder Model von gehoͤriger Form gebildet hat, naͤmlich einen
fuͤr die aͤußere oder konvexe Oberflaͤche, und den anderen
fuͤr die innere oder konkave der Reverbere, so kann man sie mit einer
gehoͤrigen Flugpresse, wie diese bereits haͤufig bei Fertigung der
Reverberen von verschiedener Form und bei anderen aͤhnlichen Operationen, wo
duͤnne Metall-Platten, wie z.B. Bleche fuͤr Beken, in
verschiedene konvexe, konkave und zugleich erhabene und vertiefte Formen getrieben
werden, gewoͤhnich angewendet wird, abdruͤken. Auf Tab. VI. Nr. 6. ist
QQ in Fig. 6 ein Durchschnitt
einer solchen kreisfoͤrmigen Reverbere, wie diese bereits in Fig. 16, Nr. 2, und Fig. 30, Nr.
4. beschrieben wurde, und hier, wie in der lezteren dieser beiden Figuren, an einer
Smethurst und White's Patent-Lampe angebracht gedacht wird. In der
gegenwaͤrtigen Figur sind die verschiedenen mit aaa bezeichneten Linien die geraden Strahlen der Lampe, so wie sie aus der Flamme A aufsteigen; c, c, c, jene
Strahlen der Lampe, welche auf den Reflektor QQ
auffallen; und d, d, d, bezeichnen die Richtung, welche
diese Lichtstrahlen nehmen, nachdem sie zuruͤkgeworfen wurden: woraus
gleichfalls erhellt, daß jene Lichtstrahen, welche auf die der Flamme am
naͤchsten liegenden Theile der Reverbere fallen, diejenigen sind, die am
weitesten zuruͤkgeworfen werden, und umgekehrt.
QQ in Fig. 7 derselben Tafel
zeigt einen Durchschnitt einer anderen kreisfoͤrmigen Reverbere, welche mit
der vorigen analog ist, aber dadurch sich von derselben unterscheidet, daß sie zur
Beleuchtung eines kreisfoͤrmigen Raumes von begraͤnztem Umfange
bestimmt ist, so, daß also die Entfernung, bis auf welche sie die am weitesten
entfernten Lichtstrahlen zuruͤkwerfen muß, gleichfalls begraͤnzt ist,
und der Grad der Beleuchtung auf diesem begraͤnzten Raume folglich
erhoͤht werden kann.
In Fig. 8
derselben Tafel sind mn, m 1
n, m 2 n und m 3 n vier Durchschnitte verschiedener Reflektoren,
welche, nach der Weite, in welche sie die Lichtstrahlen werfen sollen, verschieden
gekruͤmmt sind.
QQ in Fig. 9 derselben Tafel
stellt den Durchschnitt einer Reverbere dar, welche so gebaut ist, daß sie die
Lichtstrahlen beinahe senkrecht zuruͤkwirft, oder vielmehr in einer etwas
konvergirenden Richtung. Sie laͤßt sich bei solchen Lampen anwenden, welche
zur Erleuchtung von Treppen und dergleichen oben in dem Treppen-Raume
aufgehangen werden. In diesem Falle ist ein glaͤserner Schornstein eben nicht
nothwendig, man kann einen kleinen metallnen Schornstein F oben an der Reverbere anbringen, und die ganze Vorrichtung an einem
gekruͤmmten Drahte f, f, f,
aufhaͤngen.
B in Fig. 10 derselben Tafel
ist eine bequeme Form einer Reverbere fuͤr eine Kutschen-Lampe, in
welcher der Mittelpunkt
des erleuchteten Raumes sich unter einem Depressions-Winkel von
ungefaͤhr 45° von der Lampe befindet.
Tafeln