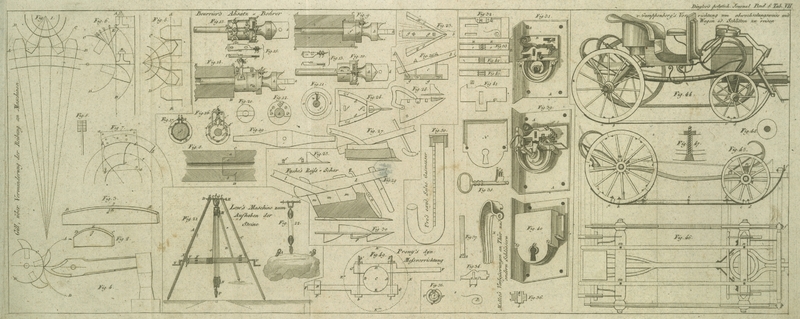| Titel: | Bericht des Hrn. Baillet über gebohrte Brunnen (puits ardésiens) und über die Sucher der HHn. Beurrier, Quellen-Sucher zu Abbeville, Dptt. de la Somme: der Société d'Émulation pour l' Industrie nationale im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste vorgetragen. |
| Fundstelle: | Band 8, Jahrgang 1822, Nr. L., S. 401 |
| Download: | XML |
L.
Bericht des Hrn. Baillet über gebohrte Brunnen (puits ardésiens) und über die SucherUeber die Sucher, (instruments de sondage) kommt nichts vor; nur
uͤber Roͤhrenbohrer. A. d. Ueb. der HHn. Beurrier, Quellen-Sucher zu Abbeville, Dptt. de la Somme: der Société d'Émulation pour l' Industrie nationale im Namen des Ausschusses der mechanischen Künste vorgetragen.
Aus dem Bulletin dieser Gesellschaft. Maͤrz 1822. S. 73. Frei uͤbersezt.
Mit Abbildungen auf Tab. VII.
Baillet über gebohrte Brunnen.
Die Kunst, das Wasser unter der Erde mittelst des Suchers oder
Erdbohrers aufzufinden, dasselbe auf die Erde und selbst uͤber diese hinauf zu
foͤrdern, ist seit langer Zeit in Europa und in Amerika bekannt.
BelidonScience des Ingénieurs Liv. IV. Ch. 12.
A. d. O. hat, vor beinahe hundert Jahren schon, den gebohrten
Brunnen des Klosters St. Andre, anderthalb franz. Meilen von Aire, beschrieben,
dessen Wasser 4 Mêtres „(beinahe 3 Klafter)“
uͤber die Straße stieg, und in jeder Stunde mehr als 100 Tonnen Wasser
gab.
Fuͤnfzig Jahre vorher hat CassiniVergl. Mém. de
l' Acad. r. d. Scienc. d. Paris, 1666. und Bern. Ramazzini's lateinische Abhandlung:
„De fontium Mutinensium admiranda
scaturigine.“ A. d. O. die gebohrten
Brunnen in Unter-Oesterreich, und in den Umgebungen von Modena und Bologna,
die ihr Wasser aus reichen Adern schuͤtten, und den gebohrten Brunnen, den er in dem Fort Urbain bohren ließ, und aus welchem
das Wasser 5 Mêtres uͤber den Boden stieg, und zum
oͤffentlichen Gebrauche in ein Marmor-Beken herabfiel,
beschrieben.
Auch England besizt seit langer Zeit in mehreren Grafschaften (Lancashire,
Dorsetshire, Yorkshire, Derbyshire) Brunnen, und selbst fließendes Wasser, welches
nicht vorhanden waͤre, wenn der Sucher nicht dasselbe in groͤßerer
oder geringerer Tiefe gefunden haͤtteVergl. Philos. Transact. Essays on Agriculture by anderson, Tilloch's Phil.
Magaz. A. d. O..
Selbst Amerika hat, nach DarwinPhytologia, or the
philosophy of Agriculture etc. Lond. 1800. Travels throngd. america.
Lond. 1789. A. d. O., seine gegrabenen Brunnen. Hartford
in Konnektikut besizt jezt einen Bach, der gebohrt wurde, und dessen Wasser nun seit
mehr dann hundert Jahren aus einem Loche quillt, das der Sucher 20 Mêtres
tief unter der Erde gefunden, und dessen Oeffnung man durch Sprengung erweitert
hatAuch in dem
duͤrren Afrika finden wir aͤhnliche Beispiele. Vergl. Shaw Voyag. en Barberie T. 1. p. 169, wo die
Beschreibung der Brunnen vorkommt, welche mitten in den ungeheueren Ebenen
von Algier gebohrt wurden, und aus welchen das Wasser mit Heftigkeit
hervorquillt, so bald man ein dem Schiefer aͤhnliches Steinlager
durchbohrt hat, welches, wie man im Lande sagt, das bahar-taht-el-reel
oder das Meer unter der Erde bedekt. A. d.
O..
So allgemein bekannt auch diese Thatsachen waren, und so groß auch der Vortheil ist,
den die Anwendung des Erdbohrers bei dem Aufsuchen unterirdischer Wasser
gewaͤhrt, so ist doch die Methode, Quellen und Brunnen zu bohren, bisher nur
gewißen Laͤndern eigen geblieben, und hat sich nicht uͤber dieselben
verbreitet. In Frankreich kennt man sie nur erst in den zwei noͤrdlichen
Departements, Pas de Calais et du Nord, und erst seit
wenigen Jahren wurde sie mit dem beßten Erfolge im Dptt de la
Somme versuchtSeit 1816, wo Hr.
Traullé, k. Prokurator zu Abbeville,
mehrere Wasser-Sucher von St. Omer kommen ließ, die mitten in dem
Garten desselben in einer Tiefe von 12 Mêtres auf Kreide Wasser
fanden, das jezt 7–8 Decimêtres uͤber die
Wasserflaͤche des benachbarten Baches springt. Im Dptt du Pas de Calais findet man mehrere
Beispiele, daß Muͤhlen von Wasser getrieben werden, welches aus 2
oder 3 in dieser Absicht gegrabenen Brunnen quillt. A. d. O..
Waͤhrend die Gesellschaft, meint Hr. Baillet, die
gebohrten Brunnen im Lande zu verbreiten bemuͤht ist, um dadurch nicht bloß
einem Beduͤrfniße fuͤr Menschen und Thiere abzuhelfen, sondern auch
die Kultur des Bodens, und selbst den Gebrauch hydraulischer Maschinen zu
foͤrdern; waͤhrend sie in dieser Hinsicht den Verfasser der beßten
Abhandlung uͤber die Kunst, Brunnen zu bohren, kroͤnte, und goldene
Medaillen denjenigen zusicherte, welche in einer Gegend Brunnen bohren
wuͤrden, wo man aͤhnliche Brunnen bisher noch nicht besizt, sollte sie
auch diejenigen nicht vergessen, die diese nuͤzliche Kunst schon seit langer Zeit
getrieben, und die dazu noͤthigen Geraͤthe verbessert und
vervollkommnet haben, wie dieß bei den HHn. Beurrier
(Vater und Sohn) der Fall ist, welche seit 5 Jahren eine Menge von Brunnen in
verschiedenen Gegenden des noͤrdl. Frankreich's gegraben haben.
Einer dieser Brunnen, den sie zu Noyelle sur mer bohrten,
wo sie in 17 Mêtres Tiefe auf Kreide Wasser fanden, ebbt und fluthet mit der
See; sein Wasser steht naͤmlich bei der Ebbe zwei Mêtres unter der
Oberflaͤche der Erde, und steigt bei der Fluth beinahe bis an die
Oberflaͤche herauf. Durch eine geschikt angebrachte Klappe wird,
waͤhrend dieses Steigens, das Wasser abgesperrt, und das Zuruͤksinken
desselben gehindert. Aehnliche fluthende Brunnen kommen auch in England vor.
Die HHn. Beurrier haben die sogenannten Sucher, und
namentlich die Bohrer, bedeutend verbessert. Eines dieser Instrumente, dessen man
sich schon seit langer Zeit bedient, ist dazu bestimmt, an dem einen Ende der
Brunnen-Roͤhre einen hohlen zilindrischen Hals anzubringen: die HHn.
Beurrier haben demselben eine Nußschraube, und eine
doppelte Mutterschraube beigefuͤgt, wodurch die Stellung der eisernen Spize
nach Belieben abgeaͤndert werden kann, und diese, wie man in der Kunstsprache
sagt, mehr oder minder einbeißt.
Das zweite Instrument, das sie erfanden, bildet an dem anderen Ende der Roͤhre
eine Art von walzenfoͤrmigen Halsstuͤke, welches in die von dem ersten
Bohrer gegrabene Kehle paßt. Man bemerkt an demselben zwei Nußschrauben, welche
senkrecht uͤber einander gestellt sind. Eine derselben laͤßt die
eiserne Spize parallel mit ihrer Laͤnge vordringen, die andere naͤhert
oder entfernt sie von der Achse der Roͤhre, um der aͤußeren
zilindrischen Oberflaͤche des Halsstuͤkes genau den Durchmesser der gegrabenen Kehle
zu geben, die dasselbe ausfuͤllen soll.
Diese beiden Instrumente, von welchen die Maschinen-Sammlung der k.
Bergbauschule Modelle besizt, werden von den HHn. Beurrier seit mehreren Jahren mit vielem Vortheile angewendet. Sie dienen
nicht bloß zur moͤglich genauesten Verbindung der Roͤhren unter
einander, sondern schneiden auch, nachdem diese Roͤhren in das Loch des
Suchers eingefuͤhrt, und bis auf die Ramme der Wasserbank hinabgekommen sind,
auf der Stelle das obere Ende der Roͤhren ab, und vereinigen dasselbe beinahe
hermetisch mit dem Boden des Bottiches oder des hoͤlzernen Behaͤlters,
den man gewoͤhnlich auf demselben anbringt.
Die auf diese Weise gebildeten Einfuͤgungen sind fest, dauerhaft, unwandelbar
und vollkommen undurchdringlich; sie beduͤrfen gar keiner Einfassung, und
keines Kalfaterwerges, was dort, wo man nur den ersten Bohrer zum Graben der Kehle
braucht, und Meißel und Schnizer oder aͤhnliche Werkzeuge zum Schneiden des
Halsstuͤkes anwendet, immer unentbehrlich ist.
Hr. Baillet traͤgt am Ende seines Berichtes auf
eine Medaille fuͤr die HHn. Beurrier an.
Beschreibung zweier Instrumente, die man Absaz-Bohrer (Tarands ou tariéres d' embases) nennt, und die zur Einfuͤgung der Brunnen-Roͤhren bei gebohrten Brunnen dienen.
Erklaͤrung der Figuren auf Tab. VII.
Fig. 8
Laͤngendurchschnitt, oder Durchschnitt zweier Roͤhren mit
zilindrischer Einfuͤgung in halbem Holze.
ab, hohle Kehle, in welche das Halbstuͤk
cd von gleichem Durchmesser genau
paßt.
Fig. 9
Laͤngendurchschnitt einer Roͤhre, deren Kehle oder
walzenfoͤrmige Oeffnung beinahe fertig gebohrt ist, und in welcher man im Aufrisse
den maͤnnlichen Bohrer sieht, der diese Kehle
ausgrub.
Fig. 10
Aufriß dieses Instrumentes in senkrechter Richtung auf Fig. 9.
Fig. 11
Grundriß dieses Instrumentes von Unten.
Fig. 12
Durchschnitt, jenseits der Nußschraube genommen.
Fig. 13
das Eisen dieses Instrumentes im Grundrisse und im Aufrisse: die Schneide ist
rechtwinkelig, um vorne und an der Seite zu schneiden.
Fig. 14
Laͤngendurchschnitt einer Roͤhre, an welcher das Halsstuͤk
beinahe ausgebohrt ist, und in welchem man das zweite Instrument, oder den weiblichen Bohrer sieht, welcher das Halsstuͤk
ausschnitt.
Fig. 15
Aufriß dieses Instrumentes, senkrecht auf die vorige Figur.
Fig. 16
Grundriß desselben Instrumentes von Unten.
Fig. 17
Durchschnitt jenseits des Buͤgels.
Fig. 13
Eisen desselben Instrumentes im Grundrisse und im Aufrisse: es hat, wie jenes in
Fig.
13, zwei unter einem rechten Winkel stehende Schneiden, um das Holz
vorne und seitwaͤrts zu schneiden.
Fig. 19
Griff der beiden Instrumente: er wird am Zapfen k
der Fig.
9, 10, 14 und 15 angebracht, und
daran mittelst eines Bolzens befestigt.
Fig. 20
Grundriß des Handgriffes von einem seiner Enden aus gesehen.
Detail der Figuren 9, 10, 11, 12 und 13.
ABCD Roͤhre, deren Muͤndung oder
walzenfoͤrmige Kehle ab
beinahe ausgebohrt ist.
ek Instrument, oder maͤnnlicher Bohrer zum Ausbohren obiger Kehle
ab: es besteht aus einem
einzigen Stuͤke Holz, welches vier verschiedene Theile enthaͤlt;
naͤmlich: den Zapfen e, die beiden
Absaͤze f und g,
und den Kopf hk.
e der Zapfen hat einerlei
Durchmesser mit dem zilindrischen Kanale der Roͤhre, in welche man
denselben einfuͤhrt. Er dient der schneidenden Klinge dieses Instrumentes
als Leiter und als Stuͤze, wenn man dasselbe mittelst des Griffes, Fig. 19,
dreht.
f der zilindrische Absaz, ist
in seinem Durchmesser um einige Millimêtres kleiner, als der Durchmesser
der Kehle ab, die er bohren muß. Er
ist an der Seite bei n, eingeschnitten, oder
ausgehoͤhlt, um das Eisen oder die Klinge lm, und die Spaͤne daselbst aufzunehmen. Die Hoͤhe oder
Laͤnge dieses Absazes ist um einige Millimêtres kuͤrzer,
als die Tiefe, welche die Kehle ab
erhalten soll.
g, der zweite zilindrische
Absaz, bestimmt die Tiefe der Kehle; denn der Bohrer hoͤrt auf einzubeissen, sobald dieser Absaz das Ende der
Roͤhre CD beruͤhrt. Er hat eine
in der Richtung des Einschnittes n fortlaufende,
Furche o, um die Klinge durchzulassen, und einen
großen Einschnitt p an seiner Basis.
q ist eine
hufeisenfoͤrmige Stuͤze, welche mit vier Schrauben auf dem Ende
des zweiten Absazes g uͤber dem Einschnitte
p befestigt ist. Die Schraube r der Klinge lm
laͤuft durch diese Stuͤze, und die beiden Schraubenmuͤtter
s, t, lassen diese Klinge vorwaͤrts oder
ruͤkwaͤrts schieben, und dadurch mehr oder weniger einbeißen.
lm, die Klinge, hat zwei
unter einem rechten Winkel stehende Schneiden, deren eine das Holz in der Tiefe
der Kehle schneidet, die andere die innere Oberflaͤche der Kehle ebnet: diese
beiden Schneiden muͤßen immer um einige Millimêtres, sowohl an der
Seite als an dem vorderen Ende des Absazes, vorstehen. Die Klinge wird durch den
Druk der beiden Schrauben uu in ihrer Lage
festgehalten; die Loͤcher, durch welche diese Schrauben gehen, sind
laͤnglich, damit die Klinge durch die zwei weiblichen Schrauben s, t, vor- und ruͤkwaͤrts
geschoben werden kann, sobald die Schrauben u, u
nachgelassen werden.
Detail der Figuren 14, 15, 16, 17 und 18.
EFGH ist eine Roͤhre, deren
walzenfoͤrmiges Halsstuͤk cd,
Fig.
8, beinahe fertig ist.
ek, der weibliche Bohrer zum Ausschneiden des
Halsstuͤkes cd.
e, Zapfen, der, wie bei dem
maͤnnlichen Bohrer, dem Bohrer als Leiter und als Stuͤze dient,
wenn er gedreht wird.
f, erster Absaz, auf welchem
man mittelst der Schrauben xx eine große
walzenfoͤrmige Zwinge aus Eisenblech, yy, befestigt, deren innerer Durchmesser um einige Millimêtres
groͤßer, als jener des Halsstuͤkes ist, welches ausgeschnitten
werden soll. Diese Zwinge besteht aus einem 3 Millimêtres diken
Eisenbleche, dessen beide Laͤngenraͤnder nach außen parallel gegen
einander zuruͤkgebogen sind, und die Klinge lm aufnehmen, welche durch die Schrauben uu festgehalten wird. Die
Laͤnge zwischen dem Ende der Zwinge, und dem Absaze f ist gleich der Hoͤhe des Absazes f in Fig. 9–10, woraus
die gehoͤrige Hoͤhe, die das Halsstuͤk haben muß,
hervorgeht.
g, zweiter Absaz, jenem in Fig.
9–10 aͤhnlich.
Er hat 1tens eine Seitenfurche o in verlaͤngerter Richtung der Raͤnder zz der Zwinge, um den Stiel der Klinge
durchzulassen, und 2tens einen Einschnitt p an seiner Basis. Die Schraube r der Klinge lm
laͤuft durch eine Stuͤze q, und die
beiden Schrauben st lassen die Klinge ihrer
Laͤnge nach vor- und ruͤkwaͤrts schieben, so daß die
vordere Schneide der Klinge vor dem vorderen Ende der Zwinge mehr oder weniger
vorsteht.
a'b'c'd' ist ein außen auf der
Zwinge, und quer uͤber der Klinge durch die Schrauben a'd' befestigter Buͤgel.
Eine Schraube e', deren Ende
f' mittelst eines Gewindes oder durch ein
Vorstekstiftchen auf der Klinge lm feststeht,
durch den Buͤgel laͤuft, und dessen beide Schraubennieten oder
weibliche Schrauben g'h' die Laͤngenschneide
der Klinge mehr oder minder nach innen in der Zwinge vorstehen lassen. Auf diese
Weise kann man mit Leichtigkeit dem zylindrischen Halsstuͤke einen
solchen Durchmesser geben, daß es genau in die durch den maͤnnlichen
Bohrer gebohrte Kehle paßt. Nachdem die Klinge lm mittelst der Schrauben r und e' in die gehoͤrige Lage gebracht wurde, wird
sie in dieser Lage unwandelbar durch die zwei Schrauben uu festgehalten. Die
Loͤcher, durch welche diese Schrauben gehen, sind kreisfoͤrmig,
und groß genug, damit die Spindeln dieser Schrauben die beiden Bewegungen der
Klinge, parallel mit seiner Laͤnge, und senkrecht auf dieselbe, nicht zu
hindern vermoͤgen. Die Zwinge yy muß
bei n in Form eines Viertel-Kreises
ausgeschnitten seyn, und zwar vorne und nahe an dem Winkel der beiden Schneiden
der Klinge lm, um die Spaͤne
durchzulassen.
Detail der Figuren 19 und 20.
Der Kopf k der beiden so eben
beschriebenen Instrumente wird in den Griff, Fig. 19, eingezapft,
und mit einem Bolzen befestigt. Ist der Griff rund, so daß alle seine
Durchschnitte, wie in Fig. 20,
kreisfoͤrmig sind, so sind zur Befestigung noch zwei Schuͤhelchen
noͤthig, ii.
Wie diese Bohrer angewendet werden.
Man wendet sie eben so, wie die gewoͤhnlichen Bohrer der
Brunnen-Roͤhren an.
Wenn eine Roͤhre gebohrt ist, und es sich darum handelt, an dem einen Ende
derselben entweder eine Kehle oder ein Halsstuͤk auszuschneiden, um sie mit
einer anderen Roͤhre zusammenzufuͤgen, so bringt man die Roͤhre
horizontal auf die Rohrbank, und befestigt sie daselbst in dieser Lage,
fuͤhrt den Zapfen e des maͤnnlichen oder
weiblichen Bohrers in dieselbe ein, und dreht denselben mittelst des Griffes auf die
gewoͤhnliche Weise. Die am Ende stehende Schneide der Klinge schneidet die
Querfasern, und die an der Seite die Laͤngenfasern des Holzes, und ebnet die
konkave oder konvexe Oberflaͤche der Kehle oder des Halsstuͤkes; die
Spaͤne werden bei dem Ausschnitte herausgestoßen. Sobald der Absaz das Ende
der Roͤhre beruͤhrt, ist die Operation vollendet.
Tafeln