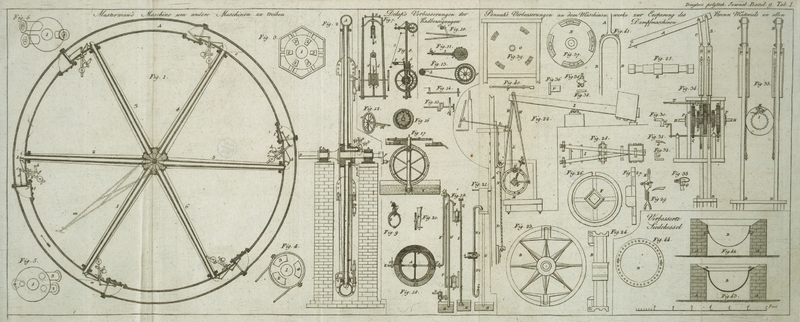| Titel: | Eine Maschine um andere Maschinen zu treiben, welche mittelst Dampfes und Wassers oder eines anderen Flüßigkeit ohne Cylinder, Stämpel, Flugrad, und mit geringerem Verlust an Kraft, als bei irgend einer der jezt gebräuchlichen Dampf-Maschinen, in Bewegung gesezt wird, und worauf Thomas Masterman, Gemeinde-Brauer, Nr. 38, Broadstreet, Radcliffe, Middlessex, dd. 22. Jäner 1822 ein Patent erhielt. |
| Fundstelle: | Band 9, Jahrgang 1822, Nr. I., S. 1 |
| Download: | XML |
I.
Eine Maschine um andere Maschinen zu treiben, welche mittelst Dampfes und Wassers oder eines anderen Flüßigkeit ohne Cylinder,
Stämpel, Flugrad, und mit geringerem Verlust an Kraft, als bei irgend einer der jezt gebräuchlichen Dampf-Maschinen, in Bewegung
gesezt wird, und worauf Thomas Masterman, Gemeinde-Brauer, Nr. 38, Broadstreet, Radcliffe, Middlessex, dd. 22. Jäner 1822 ein Patent erhielt.
Aus dem Repertory of Arts, Manufactures et Agriculture. N. CCXLIII. August 1822. S. 139.
Mit Abbildungen auf Tab. I.
Masterman über eine Maschine um andere Maschinen zu treiben.
Fig. 1 Tab. I.
stellt einen senkrechten Durchschnitt durch den Mittelpunkt desjenigen Theiles der
Maschine dar, den ich den Tausch (troke) nenne, und der
sich dreht.
Fig. 2 ist ein
Querdurchschnitt dieses Tausches, und der beiden spaͤter zu
erwaͤhnenden Masken. Der Tausch besteht aus der Achse, aus dem Kerne (oder
Mittelpunkte, durch welchen die Achse geht), aus dem Ringe, (welcher hohl ist, und
die unten anzufuͤhrenden Klappen enthaͤlt), und aus den Halbmessern,
welche die Durchgaͤnge fuͤr den Dampf zwischen dem Kerne und den
Ringen bilden.
Fig. 3 ist ein
Grundriß des Kernes und desjenigen Theiles, den ich das Gesicht nenne. Das Gesicht
ist jener in der Figur dargestellte Theil der Seite, welcher zwischen den beiden concentrischen
Kreisen eingeschlossen ist. Es ist eine vollkommene Ebene, welche mit dem Umkreise
des Kernes rechte Winkel bildet. Die andere Seite des Kernes ist parallel mit dem
Gesichte. Die Achse, welche dicht ist, geht unter rechten Winkeln mit der Ebene des
Gesichtes durch ein Loch 1, welches gerade weit genug ist, um dieselbe aufzunehmen.
Sechs Locher, 2, alle von gleicher Figur und gleicher Weite, sind in gleichen
Entfernungen in dem Gesichte, in dem Raume zwischen den beiden von dem Mittelpunkte
der Achse aus beschriebenen concentrischen Kreisen eingelassen. Die Durchmesser
dieser Kreise sind so genommen, daß sie sowohl gegen die Achse hin, als gegen die
aͤußere Kante des Gesichtes einen Raum uͤbrig lassen, und jedes dieser
Loͤcher an zwei Seiten derselben begraͤnzen: die beiden anderen Seiten
dieser Locher werden von Halbmessern begraͤnzt, welche von dem Mittelpunkte
der Achse aus gezogen sind. Die Loͤcher sind in einer Tiefe von 3 bis 4 Zoll,
oder bis auf die Haͤlfte des Kernes, parallel mit der Achse eingesenkt; dann
kruͤmmen sie sich unter rechten Winkeln auf die Achse, und oͤffnen
sich in dem Umfange des Kernes in gleichen Entfernungen von einander.
Der Ring A, in Fig. 1, besteht aus sechs
gleichen Abschnitten: an jeder Einfuͤgung derselben, und an dem Ende eines
jeden Halbmessers ist eine Klappe befestigt, welche, auf ihr Lager zugeschliffen,
wenn sie sich schließt, dampfdicht schließt.
Die Halbmesser 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind Roͤhren, welche mit dem Kerne und mit dem
Ringe verbunden sind, so daß sie dampfdichte Verbindungen zwischen jedem Loche in
dem Gesichte, und der inneren Seite des Ringes bilden. Sie sind an ihren Seiten zu
ihrer Verstaͤrkung mit Rippen versehen.
Fig. 4 ist ein
Grundriß der inneren Maske einer kreisfoͤrmigen Metall-Platte von
gleichem Durchmesser mit dem Gesichte, ungefaͤhr zwei Zoll dik, und beide
Flaͤchen auf jeder Seite vollkommen parallel unter einander.
Vier Loͤcher gehen durch dieselbe, 1, 2, 3, 4; 1 ist gerade weit genug zur
Aufnahme der Achse; 2, 3, 4 sind von solcher Form und Weite und in solcher Lage,
daß, wenn die innere Maske auf die Achse und uͤber das Gesicht aufgesezt ist,
jedes derselben gerade weit genug ist, um uͤber ein Loch in dem Gesichte, und
uͤber den Zwischenraum zwischen diesem und dem naͤchststehenden zu
passen. 2 und 3 liegen so weit von einander, daß ein Raum zwischen beiden bleibt,
der gerade hinreicht, um eines der Loͤcher in dem Gesichte vollkommen zu
deken. 4 ist von 2 und 3 gleichweit entfernt.
Der Umfang dieser Maske ist von einem eisernen Reifen umgeben, aus welchem ein Hebel
hervorspringt, der beinahe bis an den Ring reicht, und mit einer kleinen geneigten
Stange, die quer uͤber das Ende desselben laͤuft, versehen ist. In
Fig. 4 ist
der Anfang dieses Hebels, und in Fig. 1 ist er beim ganz
mit dem Reifen und der Querstange durch punktirte Linien dargestellt.
Fig. 5 ist ein
Grundriß der inneren Seite der aͤußeren Maske.
Fig. 6 ist ein
Grundriß der aͤußeren Seite derselben.
Diese Maske ist ein kreisfoͤrmiges Stuͤk Metall von gleichem
Durchmesser, und beinah von derselben Dike, wie die innere. Die innere Seite
desselben, Fig.
5, ist eine vollkommene Flaͤche; 1, ein Loch, gerade so weit, als
noͤthig, um die Achse aufzunehmen; 2, 3, 4, siehe Fig. 6, sind
Roͤhren, welche an der Außenseite dieser Maske hineingehen, und an der
inneren sich oͤffnen. Die Oeffnungen sind durch die drei kleineren Kreise in
Fig. 5
dargestellt, und so angebracht, daß, wenn man die aͤußere und innere Maske
auf einander legt, dem
Mittelpunkte eines jeden der Locher 2, 3, 4 der inneren Maske gegenuͤber eine
Oeffnung zum Vorscheine kommt. 2 ist die Dampfroͤhre, durch welche der Dampf
aus dem Kessel in die Maschine gelangt; 3 ist die Ableitungsroͤhre, durch
welche der Dampf aus der Maschine in den Verdichter, oder, wo kein solcher gebraucht
wird, in die Luft geleitet wird; 4 ist eine Roͤhre, durch welche irgend ein
Verlust oder Ueberschuß an Wasser in dem Ringe ersezt oder beseitiget werden kann:
wenn die Maschine im Gange ist, wird sie durch einen Sperrhahn geschlossen
erhalten.
Ein Ende der Achse geht, nachdem es durch den Kern durchgegangen ist, in beiden
Masten durch i. Die innere Maske wird zunaͤchst an dem Gesichte, die
aͤußere zunaͤchst an der inneren aufgezogen, und beide werden dicht
auf das Gesicht hin mittelst am Ruͤken der aͤußeren Maske angebrachter
Schrauben so fest auf einander gedruͤkt, daß sie sowohl unter sich, als mit
dem Gesichte luftdicht schließen, wozu ein unbedeutender Druk hinreicht, in dem die
entgegengesezten Flaͤchen auf einander geschliffen wurden. Die aͤußere
Maske erhaͤlt, mit Ruͤksicht auf Fig. 1, eine solche Lage,
daß die Roͤhren 2 und 3 horizontal werden, oder gegen den Halbmesser 2, oder
die aufsteigende Seite des Tausches hingekehrt sind (in dieser Lage erscheint sie
auch in Fig.
6), und sie bleibt immer in Ruhe. Die innere Maske ist, hinsichtlich der
aͤußeren, so gestellt, daß die Roͤhren 2, 3, 4 der lezteren mit den
mit eben diesen Zahlen bezeichneten Loͤchern der erstem in Verbindung stehen,
und folglich eine Verbindung zwischen denn Roͤhren in der aͤußeren
Maske, und dem Gesichte herstellen. Sie ist in Fig. 4 in dieser Lage
gezeichnet.
Auf diese Weise dienen demnach die Loͤcher in der inneren Maske zu demselben
Zweke, wie die Roͤhren in der aͤußeren, welche mit korrespondiren den Zahlen
bezeichnet sind.
Die innere Maske ist, mittelst des Hebels m, beweglich,
jedoch, wenn die Maschine im Gange ist, nur in so fern, daß die Verbindung zwischen
2 und 3 in der aͤußeren Maske und in dem Gesichte nicht unterbrochen
wird.
Die Querdurchschnitte beider Masken sind in Fig. 2 in ihren relativen
Lagen dargestellt.
Alle Verbindungen und Gefuͤge des Tausches sind dampfdicht, so daß der Dampf,
welcher durch die Dampfroͤhre eingeleitet wird, keinen anderen Ausgang, als
bei der Ableitungsroͤhre findet.
Dieselben Buchstaben in Fig. 1 und 2 bezeichnen dieselben
Theile. pp in Fig. 2 ist die Achse; qq sind die Lager; r
ist ein an dem Ende der Achse angebrachter Winkelhebel, um die Speise-Pumpe,
und, wo ein Verdichter zugegen ist, die Luftpumpe zu treiben.
Da die Klappen, und die Einrichtung, durch welche sie gestellt werden, bei allen
Abschnitten des Ringes dieselben sind, so hat man nur zwei derselben, die eine
offen, die andere geschlossen, mit Buchstaben bezeichnet.
Die Lager der Klappen sind besondere Metallstuͤke, welche zwischen den Enden
eines jeden Abschnittes angebracht sind; auch kann ein Ende eines jeden Abschnittes,
wenn es vollkommen eben geschliffen wird, als Lager dienen. Die Oeffnungen in
denselben sind so weit, als die Hoͤhlung des Ringes, welcher, dort wo die
Klappe wirkt, zur Aufnahme derselben erweitert ist. Alle Klappen, f, sind einander gleich, und oͤffnen sich in
derselben Richtung: ihre Zapfen bewegen sich frei in Roͤhrengehaͤusen,
welche an dem Klappen-Lager auf der zunaͤchst an der Achse gelegenen
Seite befestigt sind. Die ganze Vorrichtung bei denselben besteht in Folgendem: a ist eine kleine hohle Hervorragung, oder eine Klappe,
welche auf dem Ringe
aufgeschraubt ist, und mit der inneren Seite desselben in Verbindung steht. An einer
seiner inneren Seiten ist ein Roͤhrengehaͤuse, an der
gegenuͤberstehenden eine Verstopfungsbuͤchse: ein Ende der Spindel
laͤuft in dem Roͤhrengehaͤuse, das andere geht durch die
Verstopfungsbuͤchse bis an die aͤußere Oberflaͤche der Klappe.
An diesem Ende ist der Hebel b, und an dem Mittelpunkte
der Hebel c angebracht, welche beide mit der Spindel
rechte Winkel bilden, und in entgegengesezter Richtung stehen. Mit dem Ende von c ist, mittelst eines beweglichen Gelenkes, die Stange
d verbunden, und an dem Ende von b ist ein Gewicht e
befestigt, das mehr als hinreicht, um f aufzuwiegen, und
mittelst eines anderen beweglichen Gelenkes an dem anderen Ende von d damit verbunden, und an dem Mittelpunkte von f befestigt ist. Die Hebel sind so gestellt, daß f halb offen steht, wenn sie nach der Achse hinweisen.
Es ist also offenbar, daß, waͤhrend der Umdrehung des Tausches, zwei von den
Klappen f, an der (hier durch die Pfeile angedeuteten)
aufsteigenden Seite, durch da bloße Uebergewicht von e
geschlossen seyn werden, alle uͤbrigen aber offen seyn muͤßen, wie es
in Fig. 1
gezeichnet ist. Um die Wirkung dieser Klappen noch leichter zu begreifen, wollen wir
annehmen, daß ihre Bewegungen bloß durch die Schwere von e hervorgebracht wuͤrden: unten werden wir aber zeigen, daß diese
Bewegungen mit noch groͤßerer Genauigkeit mittelst des Faͤngers h und des Hebels m geregelt
werden. Wir wollen auch gegenwaͤrtig von den Klappen i und den Hebeln k Umgang nehmen, in dem sie
nicht wesentlich nothwendig sind, und ihr Nuzen spaͤter, besonders angegeben
werden soll.
Oben beschriebene Maschine ist aus Gußeisen, die Klappen und die innere Maske
ausgenommen, (welche von Messing sind, wenn kein Queksilber gebraucht wird), und die
klappen nebst
Zugehoͤr und Hebel m, welche von geschlagenem
Eisen sind.
Sie steht in einem Gehaͤuse von Stein, Bakstein, Elsen oder einem anderen
Materials so eingeschlossen, daß der Tausch sich frei um seine Achse drehen kann,
welche horizontal zu jeder Seite auf dem Gehaͤuse ruht, und beide Enden
dieser Achse ragen zu jeder Seite uͤber dasselbe hervor. Der Tausch muß genau
abgewogen werden, so daß er sich in vollkommenem Gleichgewichte dreht, ehe
Fluͤßigkeit in den Ring eingelassen wird.
Die Maschine, welche durch den Tausch in Bewegung gesezt wird, wird an dem der Fig. 1
zunaͤchst stehenden Ende angebracht. Die zu dem Tausche gehoͤrigen
Pumpen werden an dem an dem anderen Ende befindlichen Winkelhebel angebracht.
Der Dampf wird auf die gewoͤhnliche Weise erzeugt und verdichtet; denn meine
Erfindung hat weder Bezug, auf den Kessel noch auf den
Verdichtungs-Apparat.
Die in der beigefuͤgten Kupfertafel dargestellte Maschine ist von der Art, daß
Wasser in dem Ringe gebraucht werden kann, und die Weise, nach welcher sie, unter
dieser Bedingung, in Thaͤtigkeit gesezt wird, folgende:
Der Ring wird beinahe zur Haͤlfte mit Wasser gefuͤllt, und dieses
Wasser braucht niemals wieder herausgelassen zu werden. Nach dem der Tausch so
gestellt wurde, daß zwei seiner Halbmesser vollkommen senkrecht stehen, wird m niedergedruͤkt, so daß 2 an der inneren Maske
mit dem untersten Loche im Gesichte in Verbindung steht. Nun wird der Dampfhahn
gedreht, und folglich stroͤmt der Dampf durch die Roͤhre und das Loch
2 in die aͤußere und innere Maske, und durch das unterste Loch in dem
Gesichte in den unteren Halbmesser, und, nach dem er der Oberflaͤche des
Wassers in diesem Halbmesser seine eigene Temperatur mitgetheilt hat, druͤkt
er dieses Wasser nieder,
fließt in den Ring ein, und verdichtet sich in dem Wasser solang, bis lezteres
dadurch siedend wird, was sehr schnell geschieht. Wenn das Wasser siedet, muß m etwas gegen die aufsteigende Seite des Tausches
gehoben werden, worauf der Dampf durch das Wasser auf dieser Seite allem aufsteigen
wird, und da er eine verschlossene Klappe findet, das unter derselben befindliche
Wasser abwaͤrts druͤken, und folglich an der entgegengesezten Seite in
eben dem Verhaͤltnisse aufwaͤrts treiben wird, bis das Uebergewicht,
welches diese Seite dadurch erhaͤlt, hinreichend ist, den Widerstand der an
der Achse angebrachten, in Bewegung zu sezenden, Maschine zu
uͤberwaͤltigen. Unmittelbar darauf wird der Tausch anfangen, sich zu
drehen; m muß jezt in seine wirkende Lage, d.h. so
gestellt werden, daß das Loch 2 so hoch zu stehen kommt, daß der Dampf gerade
uͤber der hinabgedruͤkten Oberflaͤche des Wassers, wie es der
Druk des Dampfes zeigen wird, in den Ring einstroͤmt.
Da der Dampf immer gleichfoͤrmig nachstroͤmt, so wird das Wasser
waͤhrend der Umdrehungen des Tausches beinahe immer an derselben Stelle
bleiben. Die Oberflaͤchen desselben sind durch die punktirten Linien n und o angedeutet.
So wie der Tausch sich dreht, kommt nach und nach jedes Loch in dem Gesichte mit 2 an
der inneren Maske in Verbindung.
Man muß nie vergessen, daß, wie vorher bemerkt wurde, die Lage der inneren Maske,
wenn die Maschine in Thaͤtigkeit ist, nie so sehr veraͤndert wird, daß
2 und 3 an derselben gehindert wuͤrde, mit den correspondirenden
Roͤhren in der aͤußeren Maske in Verbindung zu bleiben.
Aus dem Baue der Maschine erhellt, daß ein ganzes Loch in dem Gesichte, oder zwei
Theile der Loͤcher, die einem ganze gleich sind, stets mit 2 in der inneren
und aͤußeren Maske
in Verbindung bleiben, so daß der Dampf immer gleichfoͤrmig in den Ring
einstroͤmt: auf diese Weise wird die hinabgedruͤkte Oberflaͤche
des Wassers gehindert, mit der geschlossenen aufsteigenden Klappe aufzusteigen, und
folglich das Uebergewicht, welches dadurch entsteht, daß das Wasser an einer Seite
des Tausches niedergedruͤkt wurde, immer unterhalten.
Die Loͤcher in dem Gesichte werden, so wie sie nach und nach von 2 zu 3 in der
inneren Maske Uebergehen, durch den zwischen denselben enthaltenen Raum gedekt, und
so wie sie mit 3 in Verbindung kommen, stroͤmt der zwischen den zwei
geschlossenen Klappen eingesperrte Dampf aus dem Ringe durch 3 in die Luft, oder in
den Verdichter, wenn ein solcher angewendet wird; und, bis dasselbe Loch in dem
Gesichte vor 3 voruͤber gekommen ist, bleibt eine Verbindung mit der Luft
oder mit dem Verdichter uͤbrig, um den Dampf zu entladen.
Da auf diese Weise der Druk des Dampfes von jeder Klappe f entfernt wuͤrde,
wird sie, sobald es bis dahin gekommen ist, durch die Schwere von e sich oͤffnen, so wie sie anfaͤngt
herabzusteigen, (siehe die Klappe f zum Theile
geoͤffnet in Fig. 1,) und so der Wassersaͤule erlauben, auf dieser Seite des
Tausches zu bleiben.
Das Wasser wird die Halbmesser fuͤllen, so wie ihre Enden unter die
hoͤher stehende Oberflaͤche desselben, unter o, herabkommen, und wird dort bleiben, bis der Dampf dasselbe
herausdruͤkt, beilaͤufig bei n; es kann
aber weder in die Luft, noch in den Verdichter (wenn einer da ist) entweichen, wenn,
ehe es noch in den Halbmesser eintritt, das Loch in dem Gesichte vor dem Loche 3
voruͤber ist; denn sonst wuͤrde allerdings das Wasser durch das Loch
in die Luft oder in den Verdichter ausstroͤmen.
Auf diese Weise wird nun eine gleichfoͤrmige Umdrehungs-Bewegung erzeugt, und so lang
unterhalten, als der Dampf gleichmaͤßig in den Ring einstroͤmt: ihre
Kraft wird mit dem Uebergewichte des Wassers auf der einen Seite des Tausches
uͤber das auf der anderen Seite im Verhaͤltnisse stehen.
Diese Kraft laͤßt sich leicht berechnen: sie ist gleich dem Gewichte einer
senkrechten Wassersaͤule, deren Hoͤhe dem Unterschiede zwischen den
beiden Wasserstaͤnden, und deren Grundflaͤche der Flaͤche des
Querdurchschnittes des Ringes gleich ist. Dieß ist der Druk auf die geschlossene
Klappe.
Wir wollen nun zur Beschreibung der Faͤnge h und
der Klappen i uͤbergehen. Der Vorsprung g wird mit a in einem
Stuͤke gegossen. h ist an einer Seite dieses
Vorsprunges mittelst eines Stiftes befestigt, welcher der Stuͤzpunkt ist, auf
welchem es sich bewegt. Durch die Schulter in der Naͤhe seines unteren Endes
wird es ihm unmoͤglich, sich uͤber einen Winkel von mehr als
ungefaͤhr 20 Graden zu schwingen, dieses Ende ist viel diker als das andere,
und mehr als hinreichend schwer, um dasselbe aufzuwiegen. Nahe an der Spize seines
duͤnneren Endes ist ein, ungefaͤhr vier Zoll langer, Stift befestigt;
ein anderer, ungefaͤhr eben so langer, Stift ist an b innerhalb e befestigt. Diese beiden Stifte
springen, wie die Figur zeigt, unter rechten Winkeln auf h und b hervor, und weisen, ersterer gegen das
Auge, der andere nach der entgegengesehen Richtung. Der Stift auf b ruht in dem Einschnitte an dem duͤnnen Ende von
h, sobald er gerade unter m ist, und hindert auf diese Weise, daß e auf
f wirken kann; sobald aber der Faͤnger vor
m voruͤber ist, kommt der auf h befindliche Stift in Beruͤhrung mit dem unteren
Ende der Querstange auf m, und ehe er noch vor der Spize
desselben ganz voruͤber ist, wird er soweit gegen den Ring hin getrieben, daß
er den Stift auf b aus dem Einschnitte loͤst,
worauf e alsogleich niederfaͤllt, und f schließt.
Die groͤßere Schwere des runden Endes von h
haͤlt den Einschnitt zuruͤk oder gegen den Ring hin, waͤhrend
dieser Theil des Tausches herabsteigt; eben diese bringt ihn auch wieder
vorwaͤrts, so daß er den auf b befindlichen Stift
stuͤzen kann, wenn dieser Theil aufsteigt.
Wenn die Maschine mit ihrer schwersten last arbeitet, so kommt die
herabgedruͤkte Wasserflaͤche dem untersten Theile des Ringes so nahe
als moͤglich, ohne dem Dampfe einen Durchgang nach der anderen Seite des
Tausches zu gestatten: je leichter die Last, desto ferner vom untersten Theile des
Bodens wird die Wasserflaͤche sich befinden. Nun ist es aber sowohl zum
Schließen von f, als zum Eintreten des Dampfes sehr
foͤrderlich, daß beides uͤber einer so sehr niedergedruͤkten
Wasserflaͤche geschieht, in dem sonst die Schnelligkeit der Maschine leiden,
und die Oberflaͤche des Wassers zu sehr aufgetrieben werden koͤnnte:
denn, wuͤrden die Klappen f sich immer auf dem
Punkte schließen, wo der Dampf in den Ring eintritt, so wuͤrde entweder
obiger Nachtheil eintreten, wenn die Maschine mit leichter Last arbeitet, oder die
Wassersaͤule muͤßte beschraͤnkt, oder ein Theil des Wassers
muͤßte aus dem Ringe ausgelassen werden.
Es ist offenbar, daß irgend eine Veraͤnderung in der Lage von m den Schluß-Punkt von f veraͤndern muß, in dem der Punkt veraͤndert wird, in
welchem der Stift auf h mit der Querstange an m zusammentrifft. Es ist gleichfalls offenbar, daß
irgend eine Veraͤnderung in der Lage der inneren Maske auf dieselbe Weise den
Punkt veraͤndern muß, bei welchem der Dampf in den Ring eingelassen wird. Ehe
der Haͤlter auf die innere Maske aufgeschraubt wird, muß folgende Vorrichtung
getroffen werden. Man lasse ein Loch in dem Gesichte (welches z.B. mit dem
Halbmesser 2 in Verbindung steht) mit dem Raume zwischen 2 und 3 an der inneren
Maske sich deken. Bei dieser Lage der Maske wird die Stellung von
f unmittelbar unter diesem Halbmesser der
vortheilhafteste Punkt seyn, wo die Klappen f sich
schließen sollen, in dem das bedekte Loch unmittelbar darauf mit dem Ableitungsloche
3 in Verbindung steht, und folglich, wenn sie dann nicht geschlossen waͤren,
wenn der Dampf in den Halbmesser 1 tritt, dieser so lang verloren gehen
wuͤrde, bis sie geschlossen werden, in dem er durch den Halbmesser 2
ausfuͤhre, ohne seine Kraft geaͤußert zu haben. Wuͤrden die
Klappen tiefer, als bei dem Pfeile, geschlossen, das
heißt, wenn eine bedeutende Menge Dampfes durch den Halbmesser 2
hereintraͤte, so wuͤrden sie durch den Druk wieder geoͤffnet,
m muß daher in eine solche Lage gebracht werden, daß
f auf diesem Punkte geschlossen werden muß. Und
diese Richtung ist beinahe dieselbe, in welcher m in
Fig. 1
erscheint. Der Haͤlter oder Reif wird dann, mittelst der Schrauben und
Muͤtter, in Fig. 4, so fest angezogen, daß die Lage der inneren Maske bei jeder
Bewegung von m veraͤndert werden muß. Bei solcher
Vorrichtung wird ein einfacher Druk auf m den Dampf
nicht nur uͤber der hinabgedruͤkten Oberflaͤche des Wassers
einstroͤmen, sondern auch die Klappen f auf dem
vortheilhaftesten Punkte, in Hinsicht auf das Einstroͤmen des Dampfes
naͤmlich, sich schließen lassen. Es wird nicht schwer seyn, den Dampf diese
Bewegung dadurch regeln zu lassen, daß er auf einen mit dem Hebel m verbundenen kleinen Staͤmpel druͤkt. Wo
die Last staͤtig und gleichfoͤrmig ist, kann die innere Maske, der
Hebel m, und der Fang-Apparat weg bleiben, wenn
die Oeffnungen in der aͤußeren Maske von derselben Form und Groͤße,
wie jene an der inneren sind, und beinahe so tief, als die Dike der Maske, gehen,
und wenn man die Klappen f durch die Schwere von e regeln laͤßt. Wo Feuerungs-Materiale
wohlfeil ist, koͤnnen auch die Klappen i
wegbleiben, wodurch sowohl die Auslagen bei Verfertigung der Maschine, als die
Ausbesserungs-Kosten derselben erspart werden, und sie selbst einfacher wird. Der einzige
Nuzen der Klappen bei i ist der, daß kein Wasser bei o in die Halbmesser eintreten kann.
Ihr Bau und ihre Wirkung ist folgende:
Das Ende des Halbmessers, welches in den Ring ein, tritt, hat einen ungefaͤhr
1 Zoll breiten Saum, auf welchem i sich schließt. Die
Zapfen von i bewegen sich frei in
Roͤhrengehaͤusen, welche an dem Saume angeschraubt sind.
Der Hebel k ist mit dem Hebel c durch die Stange verbunden, die man in Fig. 1 sieht, und welche
an beiden Enden beweglich eingefuͤgt ist. Durch den Mittelpunkt von k und durch das eingeschnittene Ende des kleinen
Vorsprunges, laͤuft ein Stift. Der Vorsprung ist an dem Ringe befestigt, und
bildet folglich eine Stuͤze fuͤr denselben. So wie die Klappe f, die zum Theile offen dargestellt ist,
anfaͤngt, sich zu oͤffnen, druͤkt das Ende von k gegen den Ruͤken von i, bis die Schwere desselben anfaͤngt, sie zu schließen. Diese
Schwere haͤlt sie geschlossen, bis sie unter die horizontale Linie
herabgestiegen ist, wo der Druk des Wassers sie hindert sich zu oͤffnen, bis
der durch ihren Halbmesser hereintretende Dampf sie aufdruͤkt. 1 ist eine
flache auf den Ring aufgeschraubte Kappe, durch welche die Klappen zugaͤngig
werden, wenn etwas an denselben auszubessern ist.
Der Tausch ist, wie wir oben gesagt haben, in einem Gehaͤuse eingeschlossen,
um alle Verdichtung abzuhalten, wenn er in Thaͤtigkeit, und alle
Erkuͤhlung, wenn er in Ruhe ist, in dem die erhizte Luft zunaͤchst an
seiner Oberflaͤche eingeschlossen wird. Um dieses Erkuͤhlen noch mehr
zu verspaͤten, ist die Ausduͤnstung durch Schluß-Klappen an den
Dampf- und Abkuͤhlungs-Roͤhren unmoͤglich
gemacht. Unter solchen Vorsichts-Maßregeln bleibt das Wasser bis zum
folgenden Tage nur wenige Grade unter dem Siedepunkte, und die Maschine ist folglich
augenbliklich brauchbar.
Meine Erfindung besteht in der oben genau beschriebenen Maschine, welche noch
uͤberdieß, wie unten sogleich angegeben wird, abgeaͤndert werden kann;
sie bildet, mittelst Dampfes und einer Fluͤßigkeit, eine Maschine, welche ans
deren Bewegung mittheilt, oder, mit anderen Worten, eine
Rad-Dampfmaschine.
Wenn kein Verdichter gebraucht wird, erspart man Feuerungs-Materiale dadurch,
daß der Dampf aus der Ableitungs-Roͤhre seine Hize dem Wasser
mittheilen muß, mit welchem der Kessel gespeist wird: doch dieß gehoͤrt nicht
zu meiner Erfindung.
Der Durchmesser des Tausches darf, wo er Wasser in sich fuͤhrt, nie kleiner
seyn, als 23 Fuß, in dem die Maschine nur mit einem Dampf-Druke von nicht
weniger als 10 Pfd. auf ein Quadrat-Zoll in Thaͤtigkeit gesezt werden
kann; dieser Durchmesser braucht aber nimmer mehr vergroͤßert zu werden, in
dem man die allenfalls noͤthige groͤßere Kraft durch Erweiterung des
Ringes erlangen kann. Nur um eine sehr große Kraft zu erhalten, koͤnnte es
allenfalls vortheilhaft seyn, den Durchmesser des Tausches zu
vergroͤßern.
In Fig. 1 ist
der Durchschnitt des Ringes kreisfoͤrmig: bei groͤßerer Kraft wird er
vierekig, bei noch groͤßerer laͤnglich seyn koͤnnen, damit die
Breite der Klappen an ihren Zapfen nie groͤßer als 18 Zoll seyn darf, um ihre
Wirkung beschraͤnken zu koͤnnen.
Wenn man Queksilber statt des Wassers im Ringe ans wendet, bleibt der Bau der
Maschine, dem Principe nach, derselbe: der Durchmesser darf aber dann, auch
fuͤr die groͤßte Kraft, wo man einen Verdichter anwendet, nie
groͤßer seyn, als 6 Fuß, in dem die große specifische Schwere des Queksilbers
schon bei einer Saͤule von 30 Zoll dem Dampfe den erfoderlichen Druk
mittheilt, und der Durch, schnitt des Ringes muß immer laͤnglich seyn, in dem
er in dieser Form am
wenigsten Queksilber noͤthig hat. Mehrere Theile der Maschine koͤnnen
in diesem Falle weggelassen werden: z.B. die Klappen i,
weil, bei einer Saͤule von 30 Zoll, die Halbmesser zur horizontalen Linie
herabsteigen, ehe noch ihre Enden die Oberflaͤche des Queksilbers erreichen,
und die Temperatur desselben uͤberall gleich ist. Auch die innere Maske kann
wegbleiben, (die aͤußere behaͤlt die oben angegebene Form) weil der
Schluß-Punkt der Klappen hier nie veraͤndert zu werden braucht, in dem
eine, verhaͤltnißmaͤßig zum Durchmesser des Tausches so niedrige,
Saͤule dem Dampfe den Eintritt in den Ring beinahe so hoch oben, als die
horizontale Linie der Halbmesser selbst, gestattet, ohne daß ein Halbmesser in das
Queksilber eher herabsteigen muͤßte, als bis vorlaͤufig seine
Verbindung mit Loch 3 aufgehoben wurde. Aus demselben Grunde, (der Kuͤrze der
Saͤule naͤmlich) koͤnnen die Halbmesser bis auf 5 oder 4
vermindert werden. Auch die Roͤhre 4 kann wegbleiben, da kein Queksilber
verloren geht. Die Menge Queksilbers darf offenbar nicht groͤßer seyn, als
noͤthig ist, um eine Saͤule von 30–34 Zoll von demselben zu
erhalten, ohne seine untere Oberflaͤche so tief herabzudruͤken, daß
der Dampf durch das Queksilber entweichen koͤnnte. Statt des obigen
Gehaͤuses kann der Tausch mit seiner Maske und mit seinem Dampfrohre, wenn
Queksilber gebraucht wird, in einem dampfdichten Gehaͤuse aus Gußeisen
eingeschlossen seyn: wenn dann der Dampf sogleich in dasselbe, und von da in das
Dampfrohr geleitet wird, so ist alle Verdichtung des Dampfes in dem Ringe vermieden.
Man wird einsehen, daß, wo Queksilber gebraucht wird, die Maschine außerordentlich
dicht seyn muß: wo der Raum sehr beschraͤnkt ist, kann der Tausch in dem
Kessel selbst sich drehen, der in dieser Hinsicht oben mit einem Vorsprunge versehen
ist: dieß ist die wohlfeilste Methode. Die Spindeln maͤßen in den lezten beiden Faͤllen in
Verstopfungs-Buͤchsen laufen. Es ist offenbar, daß man sich nur einer
Fluͤßigkeit in dem Ringe bedienen kann, und daß, da Schwere und
Fluͤßigkeit die einzigen in dieser Hinsicht brauchbaren Eigenschaften des
Wassers und des Queksilbers sind, auch andere Fluͤßigkeiten, welche diese
Eigenschaften bei der Hize des siedenden Wassers besizen und erhalten, statt
derselben angewendet werden koͤnnen.
Diese oben beschriebene Maschine ist folgender Abaͤnderungen
faͤhig:
Die Zahl der Klappen in dem Ringe kann, von vier aufwaͤrts, abgeaͤndert
werden: in eben demselben Verhaͤltnisse auch die Zahl der damit
correspondirenden Halbmesser und Loͤcher im Gesichte.
Die die Klappen f regelnden Gewichte koͤnnen auch
innenwendig in dem Ringe angebracht seyn, wo ein Vorsprung zu ihrer Bedekung
angebracht ist.
Dieselben Klappen koͤnnen durch Gewichte geregelt werden, welche an einem Ende
des Zapfens der Klappe angebracht sind, wo dieses Ende durch eine
Verstopfungs-Buͤchse an die Außenseite des Ringes hervortritt; sie
koͤnnen auch Schieber-Klappen seyn.
Der Schluß dieser Klappen kann auch (statt der Faͤnge und Haͤlter, wie
sie oben, angegeben wurden) durch einen Stift auf den Hebel b bewerkstelliget werden, der in eine gekruͤmmte Furche (an der
Seite des Gehaͤuses und an der aufsteigenden Seite des Tausches) eingreift,
ehe noch die Schwere des Gewichtes e anfaͤngt,
auf die Klappe zu wirken. Der Stift druͤkt auf diese Weise auf die obere
Seite der Krummen, und macht, daß die Klappe sich schließt; und wenn die Schwere des
Gewichtes e auf die Klappe wirkt, stuͤzt die
untere Krumme der Furche den Stift, und macht, daß die Klappe sich
allmaͤhlich schließt. Diese gekruͤmmte Furche muß, wenn eine innere Maske da ist,
an dem Hebel m, statt an der Querstange auf demselben,
angebracht seyn.
Die beigefuͤgten Zeichnungen sind nach keinem besonderen Maßstabe entworfen,
in dem die Dimensionen der Maschine nach der verschiedenen Kraft, die sie
aͤußern soll, nothwendig sehr verschieden seyn muͤßen. Die Kraft
selbst kann auf zwei verschiedene Weisen modificirt werden, entweder dadurch, daß
man den Durchmesser des Tausches aͤndert, oder die Weite des Ringes. Bei den
wohlbekannten Grundsaͤzen des Drukes der Fluͤßigkeiten kann es nicht
schwer fallen, die Dimensionen fuͤr eine Maschine von dem oben angegebenen
Baue zu finden, welche mit einer bestimmten Kraft wirken, und von einem bestimmten
Druke in Thaͤtigkeit gesezt werden soll. Die gehoͤrigen Dimensionen
fuͤr die verschiedenen einzelnen Theile werden sich aus der Betrachtung der
Zweke ergeben, zu welchen jeder derselben verwendet wird.
Aus obiger Beschreibung wird es ferner erhellen, daß meine Erfindung
vorzuͤglich in der einfachen und kraͤftigen Methode, den Dampf in
dieselbe einzufuͤhren, und aus derselben wieder abzuleiten, besteht; und daß
folglich, ungeachtet aller kleinen Abaͤnderungen an einzelnen Theilen, die
Erfindung immer dieselbe bleibt.
Die Vortheile, welche aus der außerordentlichen Einfachheit des Baues dieser Maschine
und der beinahe gaͤnzlichen Vermeidung aller Reibung entstehen, sind zu
auffallend, als daß sie hier besonders aufgezahlt werden duͤrften.
Bemerkungen der Patenttraͤger.
Die Wichtigkeit der Erfindung einer wirksamen und wohlfeilen Rad-Dampfmaschine
wird wohl nicht bestritten werden koͤnnen, wenn man bedenkt, daß die nach dem
Grundsaze der Abwechslung erbaute Dampfmaschine ungefaͤhr die Haͤlfte
der Kraft des Dampfes verschlingt, und dieß selbst dann noch, wo sie durch den
meisterhaftesten Bau und durch bewunderswerthe Kunst in ihrer Anwendung und
Benuͤzung zu dem erwuͤnschten Zweke den hoͤchsten Grad von
Vollendung erreicht zu haben scheint. Dieser Verlust an Kraft entsteht
vorzuͤglich durch Reibung, und durch den Wechsel in der Bewegung: daher
scheint eine Maschine, welche urspruͤnglich eine staͤtige
radfoͤrmige Bewegung erhaͤlt, das beßte Mittel, diesem Uebel
abzuhelfen. Man hat bisher eine große Anzahl solcher Maschinen ausgedacht: keine
derselben hat jedoch einen so entschiedenen Vorzug vor jenen, die nach dem Grundsaze
der abwechselnden Bewegung gebaut sind, daß sie in der Anwendung einen Vorzug
verdiente. Der Fehler an denselben ist vorzuͤglich der Reibung der Theile,
oder der Genauigkeit und Zartheit, mit welcher sie gearbeitet werden muͤßen,
und daher auch den hohen Verfertigungs- und Ausbesserungs-Kosten
zuzuschreiben. Obige Beschreibung wird es einleuchtend machen, daß diese Hindernisse
hier endlich besiegt sind, und daß die in derselben dargestellte Maschine in
Hinsicht auf gluͤklichen Erfolg es kuͤhn mit den Dampfmaschinen mit
abwechselnder Bewegung aufnehmen darf.
Die ersten Gestehungs-Kosten der Rad-Dampfmaschine sind, in
Vergleichung mit jener in abwechselnder Bewegung, (wenn Wasser gebraucht wird) bei
gleicher Kraft um vieles geringer.
Dieß wird daraus erhellen, wenn man bedenkt, daß die Klappen die einzigen Theile
sind, welche, so wie ihre Lager, die Masken, und das Gesicht, welche alle dampfdicht
seyn muͤßen, Genauigkeit bei ihrer Verfertigung fodern; sie werden aber schon
dadurch allem dampfdicht, daß sie eine vollkommen ebene Flaͤche erhalten,
welche ihnen auf einer Schleifbank leicht gegeben werden kann; daß alle
uͤbrigen Theile des Tausches, mit Ausnahme der Achse, schon in dem rohen
Zustande, in welchem sie aus dem Guße kommen, zusammengefuͤgt werden koͤnnen, und daß
bei dem Zusammenfuͤgen derselben weit weniger Umstaͤndlichkeit Statt
hat. Die Groͤße, die die Maschine noͤthig hat, wo sie Wasser
fuͤhrt, wird von geringem Belange in Hinsicht auf Kosten zu seyn scheinen,
wenn man weiß, daß der Ring und die Halbmesser eines Troges von 28 Fuß im
Durchmesser fuͤr 10 Pfund Sterling 10 Schill, die Tonne, zu Worcester
gegossen, und nach London geliefert wurden.
Der Unterschied bei dieser Vergleichung der ersten Gestehungs-Kosten nimmt im
Verhaͤltniße der Kraft zu, und faͤllt, wo sie einmal bis zur Kraft von
50 Pferden und daruͤber steigt, gar sehr zu Gunsten der
Rad-Dampfmaschine aus, in dem die einzige bedeutende Vergroͤßerung der
Maschine, die zur Vermehrung der Kraft noͤthig ist, die Flaͤche des
Querdurchschnittes des Ringes betrifft.
Die Gestehungs-Kosten einer solchen Maschine, bei welcher man Queksilber als
Fluͤßigkeit anwendet, kommen jener einer Dampf-Maschine mit
abwechselnder Bewegung beinahe gleich, und betragen, bei einer Staͤrke von
ungefaͤhr zehn Pferden, mehr: Ersparung an Dampf und an
Ausbesserungs-Kosten wird sie aber an allen jenen Plaͤzen zu einer
hoͤchst wohlfeilen Maschine machen, wo Feuerungs-Materiale und
Arbeitslohn theuer sind. Wenn man ferner die
Aufrichtungs-Ausbesserungs- und Betreibungs-Kosten beider
Maschinen unter einander vergleicht, so faͤllt das Resultat offenbar zu
Gunsten der Rad-Dampfmaschine aus.
Die einzige Reibung, welche bei dem Betriebe der Rad-Maschine, ohne
Verdichter, Statt hat, ist – die der Fluͤßigkeit in dem Ringe,
– des Gesichtes gegen die Maske – der Stifte gegen die Querstangen auf
m- und der Achse selbst: alle diese sind aber
hoͤchst unbedeutend. Beweis hieruͤber liefert die im vorigen Dezember
zum Versuche erbaute (Wasser) Maschine bei den HHn. Hague und Topham's zu London, Spitalfields: sie wurde
mit einem Druke von drei Achtel Pfund auf einen Quadrat-Zoll in Bewegung
erhalten. Ihr Gewicht ist ungefaͤhr 3 Tonnen.
Ihre Dimensionen sind:
Durchmesser
des Tausches
15 Fuß
0 Zoll,
– –
der Achse
0 Fuß
4 Zoll,
– –
des Gesichtes und der Maske
1 Fuß
0 Zoll.
Da die Flache des Querdurchschnittes des Ringes 78 Quadrat-Zoll
betraͤgt, so ist dieser Druk weniger als 30 Pfd. gegen die geschlossene
Klappe. Die Reibung des Wassers im Ringe wurde als unbedeutende Kleinigkeit
befunden, in dem der Tausch mit einem Druke von 1 1/2 Pfund auf das
Quadrat-Zoll sich 10 mal in einer Minute umdrehte (eine Schnelligkeit von 420
Fuß), und es wahrscheinlich ist, daß ein Theil dieses Drukes zum Austreiben des
Dampfes durch die Halbmesser verwendet werden mußte.
Um den zur Ueberwindung der lezterwaͤhnten Reibung noch noͤthigen Druk
zu schaͤzen, muß man sich nur erinnern, daß das Wasser beinahe immer stehen
bleibt, also nur wenig oder gar keine vis inertiae zu
uͤberwinden ist. Der noch noͤthige Druk betraͤgt also den
Unterschied zwischen dem Druke, der noͤthig ist, die niedergedruͤkte
Oberflaͤche des Wassers auf einem gewißen Punkte zu erhalten, wenn die
Maschine in Ruhe steht, und zwischen demjenigen, den man noͤthig hat,
dieselbe auf demselben Punkte zu erhalten, wenn die Maschine in voller
Thaͤtigkeit ist: dieser Unterschied ist gewiß unbedeutend.
Es ist allgemein bekannt, daß die weitesten Roͤhren in unseren tiefen
Bergwerken nur einige Zolle Aufsaz brauchen, um die Reibung des Wassers in der
Pamproͤhre, oder in dem Raume uͤber dem Staͤmpel zu
uͤberwinden. Die Reibung des Gesichtes an der Maske wurde unbedeutend
gefunden. Wenn man nun den Bau dieser Maschine betrachtet, und bedenkt, daß beinahe
alle Reibung beseitigt, und das, was davon noch uͤbrig ist, zunaͤchst an
der Achse sich befindet, daß die Kraft staͤts an dem Ende des Hebels
angebracht ist, und beide sich in den moͤglich vortheilhaftesten Lagen
befinden; so wird es einleuchtend, daß das nothwendige Resultat hievon bedeutende
Ersparung an Feuerungs-Materiale seyn muß.
Aus dem Baue dieser Maschine folgt auch der wichtige Vortheil, daß sie ohne
Verdichter arbeiten kann, und zwar bei ungefaͤhr halbem Druke des Kessels,
welchen eine abwechselnde Maschine von derselben Staͤrke bei gleicher Menge
von Feuerungs-Materiale fodert.
Die verlangte Geschwindigkeit der Maschine, (wo man Wasser bei derselben braucht) ist
ungefaͤhr 400 Fuß in der Minute; dieß ist etwas mehr, als die aͤußerste Schnelligkeit einer abwechselnden
Dampf-Maschine, naͤmlich 345 Fuß, waͤhrend der Staͤmpel
durch den Mittelpunkt des Cylinders laͤuft, wenn seine mittlere Geschwindigkeit 220 Fuß betraͤgt. Erstere verhaͤlt
sich zu der anderen, wie der Umfang des Kreises zu seinem doppelten Durchmesser.
Diese Geschwindigkeit der Maschine ist aber, (wo Queksilber angewendet wird)
geringer.
Es ist allgemein bekannt, daß, in Hinsicht auf die abwechselnde
Dampf-Maschine, die Geschwindigkeit derselben nicht leicht ohne bedeutenden
Verlust an Kraft, und ohne Zerstoͤrung ihrer Theile uͤber obige 220
Fuß waͤhrend Einer Minute gebracht werden kann, und daß, hinsichtlich auf das
Wasser-Rad, die Geschwindigkeit des Umfanges desselben nicht ohne gleichen
Verlust an Kraft uͤber 330 Fuß in einer Minute zu treiben ist. Die Ursachen
dieser Beschraͤnkung der Geschwindigkeit scheinen, bei den abwechselnden
Dampf-Maschinen, die Reibung und die abwechselnden Bewegungen ihrer Theile,
und, bei den Wasser-Raͤdern, theils das Zuruͤkfahren des Rades
vor der Kraft mit beschleunigter
Geschwindigkeit, theils der Verlust an Wasser aus den Eimern, durch die
Centrifugal-Kraft, die dasselbe erhaͤlt, zu seyn. Bei obiger
Rad-Dampfmaschine kann aber keine dieser Beschraͤnkungen der
Geschwindigkeit eintreten; alle Reibung ist beinahe beseitigt, die Bewegung ist
beinahe gleichfoͤrmig radfoͤrmig, und das Wasser in dem Ringe
faͤhrt nicht vor der Kraft zuruͤk: da dasselbe beinahe immer auf
derselben Stelle bleibt, so erlangt es auch keine Centrifugal-Kraft.
Die oben erwaͤhnte, zum Versuche aufgestellte Maschine drehte sich auf 688 Fuß
in einer Minute bei einem Druke von ungefaͤhr 3 1/2 Pfund auf ein
Quadrat-Zoll; ein bedeutender Theil dieses Drukes mußte durch die
Einschließung oder die Drahtzuͤge des Dampfes auf seinem Durchgange durch die
Halbmesser entstanden seyn. Wenn man irgend einen Verdacht hegen koͤnnte, daß
diese Geschwindigkeit, wegen des Drukes, der zur Ueberwindung der Reibung des
Wassers in dem Ringe erfodert wuͤrde, zu hoch angegeben waͤre, so
beliebe man sich zu erinnern, daß in einer Pumpe von 12 Zoll im Durchmesser, die das
Wasser 20 Faden hoch mit einer Geschwindigkeit von einem Fuß in jeder Secunde zieht,
die Reibung des Wassers auf dieser ganzen Streke nur 2 1/2 Pfund, oder 1/50 Pfund
auf ein Quadrat-Zoll betraͤgt, und daß diese Reibung in dem einfachen
Verhaͤltniße des Durchmessers und der Tiefe, und in dem doppelten der
Geschwindigkeit steht.
Die Maschinen dieser Art, welche Wasser fuͤhren, schiken sich am beßten
fuͤr große Kraftanwendung, und, je groͤßer sie sind, desto mehr
erspart man an denselben in Hinsicht auf Gestehungs-Kosten und
Feuerungs-Materials, verglichen mit schwaͤchern.
Mit dem Baue solcher Maschinen von ungeheuer großer Kraft hat es keine Schwierigkeit,
da bei der langsamen Bewegung des Tausches auf seiner Achse keine besonders große
Staͤrke des Materiales erfoderlich ist. Die Form selbst (ein Rad) und die Form des Ringes und der
Halbmesser (Roͤhren) koͤnnen in Hinsicht auf Starke und Dichtheit
nicht schiklicher gedacht werden.
Tausche von 40 Fuß im Durchmesser sind keinesweges unausfuͤhrbar. Der Bau und
die besondere Wirkung von Flugraͤdern scheint allerdings es nothwendig zu
machen, die Durchmesser derselben innerhalb dieser Graͤnzen zu
beschraͤnken; es ist aber offenbar, daß zwischen Flugraͤdern und den
Tauschen, vorzuͤglich in Hinsicht auf ihre Wirkung, nur wenig Analogie Statt
hat.
Die Kraft der lezteren ist also eben so wenig beschrankt, als die der abwechselnden
Dampf-Maschinen. Es koͤnnte scheinen, daß die radfoͤrmige
Bewegung derselben sie zum Wasserschoͤpfen untauglich macht; sie taugen
indessen weit besser, als eine Dampf-Maschine mit abwechselnder Bewegung, um
eine Dreistoß-Pumpe (three throw pump) zu
treiben, und es ist bekannt, daß eine solche Pumpe, bei gleicher an derselben
angebrachter Kraft, mehr Wasser foͤrdert, als eine gewoͤhnliche
Hebepumpe, in dem das Wasser in ihr ununterbrochen durch die Roͤhren
stroͤmt, waͤhrend an der Hebepumpe der Strom unterbrochen wird, und
die vis inertiae der ganzen Wassersaͤule bei
jedem Zuge uͤberwunden werden muß. Aus eben diesem Grunde hat erstere Pumpe
auch den Vortheil von Zugroͤhren mit kleinerem Durchmesser, als an der
lezteren.
Die Tausche mit Queksilber schiken sich am beßten fuͤr kleinere
Kraͤfte, und je kleiner sie sind, desto mehr Vortheil gewaͤhren sie in
Hinsicht auf Reibung und Ersparung an Feuerungs-Materiale, im Vergleiche mit
abwechselnden Dampf-Maschinen von gleicher Staͤrke.
Es muß jedem einsichtsvollen Leser sich von selbst aufdringen, daß es fuͤr
Dampfbothe keine geeignetere Vorrichtung geben kann, als diese Maschine mit
Queksilber, in dem sie in einem hohen Grade Raum- und Feuerungs-Material ersparung in sich
vereinigt, und die starken und ungleichen Nisse an dem Schiffe und die unangenehme
zitternde Bewegung, welche die gegenwaͤrtigen Dampf-Maschinen an
denselben hervorbringen, beseitiget.
Der bedeutende Verlust an Kraft, welcher durch die an abwechselnden
Dampf-Maschinen auf Dampf-Bothen nothwendig werdende
Verkuͤrzung der Laͤnge des Streiches hervorgeht, und der Schaden, den
sie an Schiffen durch ihre abwechselnden Bewegungen verursachen, sind Nachtheile von
solcher Wichtigkeit, daß eine wirksame und oͤkonomische Rad-Maschine
hoͤchstes Beduͤrfniß wird, zumal, da der beengte Raum auf
Dampf-Boͤthen jede Ersparung an Brenn-Materiale doppelt
vorteilhaft macht.
Diese Maschine, sie mag mit Wasser oder mit Queksilber gefuͤllt seyn,
laͤßt sich auch sehr bequem ausfuͤhren, in dem ihr Bau hoͤchst
einfach ist, und das Aufsezen, Treiben und Ausbessern derselben wenig
Geschiklichkeit fodert. Dieß ist vorzuͤglich bei den
Queksilber-Maschinen der Fall, die wenig Raum einnehmen, eben so wenig
Muͤhe als Geschiklichkeit bei dem Aufstellen und Ausbessern derselben
erfodern, und noch uͤberdieß einen Gewinn auf der Mauth gewaͤhren: man
erhaͤlt naͤmlich von der zu 1 Shill. 8 Den. auf das Pfund Queksilber
gesezten Mauth 1 Shill. 1 Den. bei der Ausfuhr zuruͤkbezahlt, und der
Einfuhrs-Zoll auf Queksilber betraͤgt in den meisten uͤbrigen
Staaten weniger als der Rest der engl. Mauth nach Abzuge des zuruͤkbezahlten
1 Shill. 1 Den.
Eine solche Maschine (mit Wasser in dem Ringe) wird nun auf der Fawdon Steinkohlen-Grube, bei Newcastle, gebaut: ihr Tausch hat 28
Fuß im Durchmesser, und der Ring, dessen Durchschnitt kreisfoͤrmig ist, einen
Fuß.
Eine andere, mit Queksilber, ist beinahe fertig, und wird in Kuͤrze in
Vinestreet, Nr. 1, Waterloo-road, near the SouthendSonthend of Waterloo-bridge im Umtriebe seyn. DasDasr Patent gilt fuͤr die vereinigten Koͤnigreiche und
fuͤr die Colonien: fuͤr Frankreich ward ein Brevet d'importation genommen.
Die gegenwaͤrtigen Besizer des Patentes, die HHn. I. und T. Masterman zu
London, Nr. 68, Old-Broad-street ertheilen, unter billigen
Bedingungen, Licenzen sowohl auf die Verfertigung, als auf die Anwendung dieser
Maschinen, und sind auch geneigt, ihre Patent-Rechte zu verkaufen.
Eine kleine Schrift, in welcher die Vortheile, die diese Maschine gewahrt,
aufgezaͤhlt, und vergleichende Tabellen der Kraft und des Bedarfs an
Feuerungs Materials zwischen, dieser und der abwechselnden Dampf-Maschine
vorgelegt sind, ist so eben erschienen, und bei den HHn. Underwood in Fleetstreet zu haben.
Tafeln