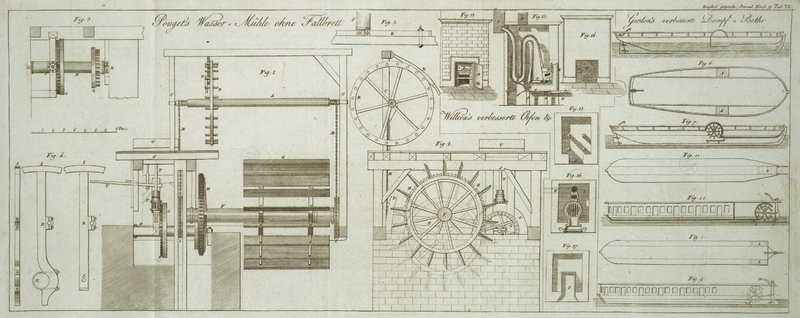| Titel: | Beschreibung einer Wassermühle ohne Fallbrett und Dämmung, welche weder das Flößen noch das Wässern hindert, und wofür ihr Erbauer, Hr. Pouguet, Zimmermeister und Maschinist zu Ornans, Dpts. du Doubs, den von der Société d'Encouragement auf die Erbauung einer solchen Mühle gesezten Preis von 1,000 Franken erhielt. |
| Fundstelle: | Band 9, Jahrgang 1822, Nr. LXIII., S. 410 |
| Download: | XML |
LXIII.
Beschreibung einer Wassermühle ohne Fallbrett und Dämmung, welche weder das Flößen noch das Wässern hindert, und wofür ihr
Erbauer, Hr. Pouguet, Zimmermeister und Maschinist zu Ornans, Dpts. du Doubs, den von der Société d'Encouragement auf die Erbauung einer solchen Mühle gesezten Preis von 1,000 Franken erhielt.
Aus dem Bulletin de la Société d'Encouragement Jan. 1822. S. 15.
Mit einer Abbildung auf Tab. VII.
Pouguet über eine Wassermühle ohne Fallbrett und Dämmung.
Diese Muͤhle mit 2 Gaͤngen sieht seit 4 Jahren
am rechten Ufer der Loue, einem kleinen Fluͤßchen, das bei Ornans
voruͤber fließt; sie geht sehr regelmaͤßig, ist leicht zu bedienen und
liefert bei hohem, wie bei niedrigem Wasserstande, sehr schoͤnes Mehl. Das
Gemaͤuer ist aus gehauenen Steinen; nach Außen, gegen das Wasser hin,
befindet sich bloß das Wasserrad, und der Apparat, wodurch dasselbe gehoben und
gesenkt werden kann: dieß geschieht naͤmlich mittelst eines innenwendig
angebrachten Zapfenrades, welches ein Weib mit Leichtigkeit handhaben kann. Es ist
kein Fall- oder Schuzbrett (Wehr oder Fluder) weder mit Winde, noch mit Schraube oder Schwanz,
wie an den uͤbrigen Muͤhlen, an dieser Muͤhle angebracht: wenn
man die Muͤhle in Gang bringen oder stellen will, darf man nur das Wasserrad
heben oder senken. Auf diese Weise wird also die Schiffahrt auf dem Wasser, welches
die Muͤhle treibt, nicht gehindert: denn, wollte ein Fahrzeug dicht an der
Muͤhle vorbei, so duͤrfte das Rad nur auf die gehoͤrige
Hoͤhe aufgehoben werden. Die einzige nothwendige Bedingung bei diesem an und
fuͤr sich sehr wohlfeilen Muͤhlenbaue ist, daß man einen solchen Ort
am Wasser fuͤr die Muͤhle waͤhle, wo der Fall des Wassers sehr
schnell ist. Die Muͤhle des Hrn. Pouguet steht an
einem Orte, der 6 Millimétre im Métre Fall hat.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 1 Aufriß
der Muͤhle von Vorne.
Fig. 2 Aufriß
der Muͤhle von der Seite, und zwar von der Wasserseite.
Fig. 3 Ansicht
der Muͤhle von Oben auf das Kammrad und den Trilling hinab, der die
Muͤhlsteine dreht.
Fig. 4 die
Schwengel des beweglichen Gestelles, einzeln, von Vorne und von der Seite.
Fig. 5 ein
Theil des Wellbaumes des großen Rades, um zu zeigen, wie er sich in dem beweglichen
Gestelle dreht.
Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Gegenstaͤnde.
A Querbaum, auf welchem das Zapfenrad B aufgezogen ist; C Pfosten
des Muͤhlengehaͤuses; D hoͤlzerner
Hebel in Form eines Sperrkegels, der mit seinem gabelfoͤrmigen Ende in einen
der Zapfen des Rades B eingreift, um dasselbe zu
stellen: dieser Hebel wird mit der Hand gefuͤhrt. EE
Fig. 4 der
innere und aͤußere Schwengel des beweglichen Gestelles, welche die Zapfen des
Wellbaumes F tragen. Diese Schwengel drehen sich um einen
Mittelpunkt, und lassen sich mittelst der Ketten MM heben und senken. G, ein auf dem Wellbaume
F aufgezogenes Rad, dessen Schaufeln nur so tief als
noͤthig, in das Wasser tauchen. H, ein Stirnrad
auf demselben Wellbaume G, welches, das Rad G mag wie immer gestellt seyn, stets in den Triebstok
Q eingreift. II
Kreisausschnitte, welche das eine Ende der Schwengel EE bilden, und eine Kehle haben, welche die Ketten aufnimmt, K ein gegossener Ring, in welchen das Ende des
Lagerbaumes N paßt; dieser Ring ist mittelst
Schrauben-Bolzen auf dem inneren Schwengel E
befestigt, und dient ihm zugleich als Mittelpunkt seiner Bewegung. L
Fig. 5 ist
eine Schraubenmutter, welche durch das Ende des inneren Schwengels, und durch den
Tragebalken der Muͤhle laͤuft: auf dem durch diese Schraubenmutter
laufenden Bolzen bewegt sich dieser Theil des beweglichen Gestelles. MM sind Ketten, welche an den
Kreis-Ausschnitten der Schwengel befestigt sind, und sich um jedes Ende des
Baumes A aufrollen: sie tragen das bewegliche Gestell
und das Wasserrad, und heben und senken diese lezteren, je nachdem man das Zapfenrad
B dreht. N ist der
Lagerbaum der Muͤhle, dessen eines Ende durch den gegossenen Ring K lauft. O ist ein
Raͤdchen, dessen Zaͤhne in die Spindeln des Triebstokes P greifen; Q, ein anderes
Rad, welches durch das Stirnrad getrieben wird. Die Zahne dieses Rades Q bleiben bestaͤndig zwischen den Zaͤhnen
des Rades Q, das Wasserrad mag so hoch oder tief, als
man nur immer will, gehoben oder gesenkt werden. R eines
der Lager, welches die Zapfen des Lagerbaumes aufnimmt. S die Unterlage der Muͤhle mit einer staͤhlernen Pfanne zur
Aufnahme der senkrechten Achse T, welche den
Muͤhlstein U traͤgt. V, ein Hebel, womit man die Feinheit des Mehles
bestimmen kann.
Man hat in der ersten Figur die Buͤtte, den Rumpf etc. weggelassen, in dem sie
auf die gewoͤhnliche Weist eingerichtet sind.
Wenn man eine groͤßere Muͤhle dieser Art erbauen wollte, so
duͤrfte man nur das Wasserrad etwas weiter in das Wasser herausschieben: da
dieses Rad aber in diesem Falle schwerer seyn wuͤrde, so muͤßte es
durch Gegengewichte, die an zwei anderen Ketten, die uͤber die Schwengel und
uͤber eine senkrecht an jeder Kette angebrachte Rolle laufen, befestigt sind,
im Gleichgewichte erhalten werden.
Tafeln