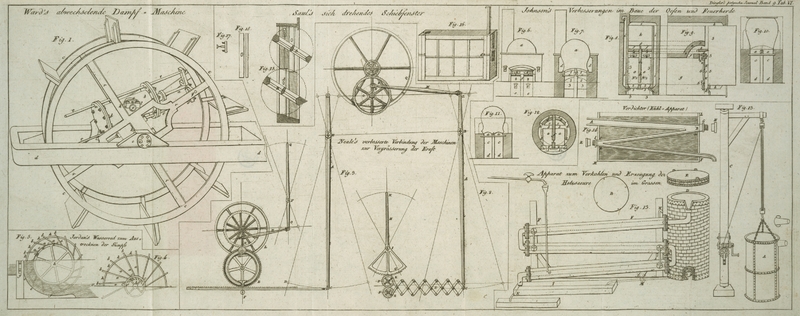| Titel: | Ueber die Fabrikation der brennzeligen Holzsäure im Großen in Frankreich, nebst dem Verfahren, aus derselben die reine Essigsäure fabrikmäßig darzustellen. |
| Fundstelle: | Band 9, Jahrgang 1822, Nr. LXVIII., S. 431 |
| Download: | XML |
LXVIII.
Ueber die Fabrikation der brennzeligen Holzsäure im GroßenUeber Gewinnung der Holzsaͤure vergleiche man polytechn. Journal Bd. 7. S. 264. D. in Frankreich, nebst dem Verfahren, aus derselben die reine Essigsäure fabrikmäßig darzustellen.
Aus dem Dictionnaire Technologique in Gill's technical Repository. N. VI. 1822. S. 401.
Mit Abbildungen auf Tab. VI.
Ueber die Fabrikation der brennzeligen Holz- und reinen Essigsäure in Frankreich.
Diese Operation gruͤndet sich auf die allgemeine
Eigenschaft der Hize, die Elemente der Pflanzen-Koͤrper zu entbinden,
in anderer Ordnung wieder zusammen zu stellen, und hiedurch Koͤrper zu
erzeugen, welche vor ihrer Einwirkung in den Pflanzen nicht vorhanden waren. Das
respective Verhaͤltniß dieser Products ist nicht bloß in verschiedenen
Substanzen, sondern auch nach dem groͤßeren oͤder geringeren Grade der
angewendeten Hize, und noch mehr nach der groͤßeren oder geringeren Sorgfalt,
die man waͤhrend des Verlaufes dieses Processes auf denselben wendete,
verschieden. Wenn man einen Pflanzen-Koͤrper in verschlossenen
Gefaͤßen destillirt, so erhalt man zuerst das in demselben enthaltene Wasser;
dann kommt das Wasser, welches aus dem in diesem Koͤrper enthaltenen
Sauerstoffe und Wasserstoffe erzeugt wird; es bildet sich eine
verhaͤltnißmaͤßige Menge von Kohle, und durch allmaͤhliche
Vermehrung der Hize verbindet sich ein kleiner Antheil des Kohlenstoffes mit
Sauerstoff und
Wasserstoff, und bildet Essig-Saͤure, welche man lang unter dem Namen
der brennzeligen Holzsaͤure als eine besondere
Saͤure betrachtete. Da der Kohlenstoff hier vorwaltet, so verbindet er sich
in hoͤherem Verhaͤltnisse mit anderen Stoffen, und bildet zuerst ein
fluͤchtiges, brennzeliges, etwas gefaͤrbtes Oel, welches an Farbe und
Dichtigkeit zunimmt, und endlich mit einer Menge Kohlenstoffes beladen
uͤbergeht.
Verschiedene elastische Fluͤßigkeiten begleiten die verschiedenen Produkte.
Kohlensaures Gas entwikelt sich, obschon in geringer Menge; dann wird viel
gekohlstofftes Wasserstoffgas erzeugt, und gegen das Ende der Operation kommt eine
große Menge gasartigen Kohlenstoff-Oxides. Alle Kohlen, welche nicht zu
diesen verschiedenen Verbindungen verbraucht wurden, bleiben in der Retorte
zuruͤk, und behalten gewoͤhnlich die Form des
Pflanzen-Koͤrpers, der sie lieferte.
Seit wir anfingen uͤber die verschiedenen Verfahrungs-Weisen in
Kuͤnsten und Gewerben reiflich nachzudenken, und sie auf wissenschaftlichen
Fuß zu behandeln, gelang es uns, Verbesserungen in verschiedenen Zweigen des
Fabrik-Wesens anzubringen, von welchen man sich ehevor kaum etwas
haͤtte traͤumen lassen koͤnnen. Daher die ungeheueren
Fortschritte in der Koͤhlerei, und die Moͤglichkeit mit bedeutendem
Gewinne Producte zu erzeugen, die man ehevor gaͤnzlich
vernachlaͤßigte. Um Holz in Waͤldern zu verkohlen, schlichtet man
dasselbe, nach der gewoͤhnlichen Routine, in kegelfoͤrmigen Haufen
auf, und laͤßt zwischen den Scheitern am Grunde derselben Raum genug, um die
Verbrennung zu beguͤnstigen; dekt dann den Haufen mit Erde, und bildet so
eine Art von Ofen. Oben werden hie und da Spalten, als Rauchzuͤge, offen
gelassen, durch welche Rauch und Dampf entweichen kann. Nachdem das Holz so
aufgeschlichtet ist, wird es angezuͤndet; es faͤngt an zu brennen; das
in dem Holze enthaltene
Wasser geht in Dampfgestalt davon, und nachdem die Hize einen gewißen Grad von
Hoͤhe erreicht hat, und gleichfoͤrmig vertheilt ist, schließt man die
Zugloͤcher zu. Die erhoͤhte Temperatur der ganzen Masse wird eine Zeit
lang unterhalten, und die Verkohlung faͤhrt fort, bis die Verbrennung aus
Mangel des Zutrittes der Luft aufhoͤrt.
Jezt verfahrt man aber anders, und erhalt erfreulichere Resultate. Man bringt das zu
verkohlende Holz in große kreisfoͤrmige oder vierekige Gefaͤße A (Fig. 13 Tab. VI.), die
aus zusammen genieteten Eisen-Platten bestehen, und oben mit einem kleinen
Cylinder, gleichfalls aus Eisenblech, versehen sindEine etwas konische Form ist zu diesem Behuf geeigneter. D.. An dem oberen Theile des Gefaͤßes ist ein eiserner Dekel B, welcher mittelst Stiften und Klammern darauf
befestigt ist. Dieses, so geschlossene, Gefaͤß bildet, wie die Figur zeigt,
eine sehr große Retorte. Nachdem dieses Gefaͤß auf obige Weise vorgerichtet
wurde, hebt man dasselbe mittelst eines großen Krahnes C
in den Ofen D, der nach dem Gefaͤße erbaut ist,
und bedekt die obere Oeffnung desselben mit dem mit Ziegelwerk umgebenen Dekel E. Hierauf wird mit irgend einem tauglichen
Brennmateriale Feuer angeschuͤrt, und geheizt. Zuerst geht die in dem Holze
enthaltene Feuchtigkeit in Dampfgestalt aus dem Ofen. Aber bald verlieren diese
Dampfe ihre Durchscheinenheit und werden rauchig; und nun ist es Zeit, den
Verlaͤngerer, oder einen Cylinder mit einer Handhabe an zu sezen. Dieser
Verlaͤngerer paßt in eine Roͤhre von derselben Neigung, und
faͤngt den Verdichtungs-Apparat an.
Die Art dieser Verdichtung ist, nach Umstaͤnden, verschieden. In einigen
Fabriken kuͤhlt man bloß durch die Luft, und laͤßt die Dampfe durch
eine lange Reihe von Cylindern, Faͤssern oder Gefaͤßen laufen, die genau in
einander passen; gewoͤhnlich bedient man sich aber zur Verdichtung des
Wassers, wo man dasselbe in reichlicher Menge und leicht sich verschaffen kann. Der
einfachste Apparat, den man hiezu waͤhlen kann, besteht aus zwei Cylindern,
FF, die einander umhuͤllen, und Raum
genug zwischen sich halten, um reichlich Wasser durchstroͤmen zu lassen, und
dadurch die Dampfe abzukuͤhlen. Dieser Doppel-Cylinder wird an den
Destillir-Apparat unter gleicher Neigung angepaßt; an diesen Apparat kommt
ein zweiter, und nicht selten noch ein dritter: alle sind genau von gleicher Form
und laufen, um Raum zu gewinnen, in Zig-Zag unter einander hin.
Das Wasser wird durch eine sehr sinnreiche, jezt in vielen Fabriken angewendete,
Vorrichtung im Kreislaufe erhalten. Aus dem unteren Ende des Apparates G steigt eine senkrechte Roͤhre empor, welche
etwas hoͤher seyn muß als alle uͤbrigen Theile. Bei H ist eine kurze gegen den Boden hin abgeneigte
Roͤhre angebracht, die als Ausguß, dient. Das Wasser, welches aus einem
Behaͤlter kommt, laͤuft durch die senkrechte Roͤhre an den
unteren Theil des Apparates hinab, und fuͤllt, nach und nach aufsteigend, den
Raum zwischen allen Cylindern aus. Wenn die Maschine im Gange ist, erhoͤhen
die Dampfe, so wie sie sich verdichten, die Temperatur des Wassers, welches, dadurch
mehr ausgedehnt und leichter werdend, oben bei H heraus
tritt. (Kaltes Wasser wird dann wieder durch die Roͤhre G nachgelassen.)
Der Verdichtungs-Apparat endet sich in einen von Baksteinen gemauerten Kanal
I unter der Erde. Am Ende dieses Kanales ist K eine gekruͤmmte Roͤhre, welche die
Fluͤßigkeit in die erste Cisterne leitet, und diese Cisterne entleert sich,
wenn sie voll ist, mittelst einer Ausguß-Roͤhre in einen
groͤßeren Behaͤlter. Das hiebei entwikelte Gas wird von einer Seite
des Kanales durch die Roͤhre LL unter das
Aschenloch in den Ofen
geleitet. Diese Roͤhre ist mit einem Hahne M
versehen, der in einiger Entfernung von der Vorderseite des Ofens angebracht ist, um
die Gas-Roͤhre stellen, und nach Belieben die Verbindung mit dem
Inneren des Apparates unterbrechen zu koͤnnen. Der Theil der Roͤhre,
welcher unter dem Herde befindlich ist, steigt einige Zoll senkrecht aus dem Boden
empor, und endet daselbst in einen Knopf, N, der wie die
Brause an einer Gießkanne gestaltet ist. Auf diese Weise verbreitet das Gas sich
gleichfoͤrmig unter dem Gefaͤße, ohne daß man befuͤrchten
duͤrfte, daß die Roͤhre durch Kohlen oder Asche verlegt
wuͤrde.
Die zur Verkohlung noͤthige Hize bedarf nicht besonders groß zu seyn; gegen
das Ende hin muß sie jedoch so verstaͤrkt werden, daß das Gefaͤß roth
gluͤhend wird, und die Laͤnge dieser Operation haͤngt
nothwendig von der Menge Holzes ab, welches auf einmal verkohlt werden soll.
Fuͤr ein Gefaͤß, das ein Demi-DécastéreEin Décastére ist 316,6 Wiener Kubikfuß; ein
Demi-Décastére also 158,3 Wien. Kub. Fuß. oder
ungefaͤhr 7/10 Wiener Klafter. A. d. Ueb. Holz faßt, reichen 8 Stunden hin. Aus der Farbe der Gas-Flamme
erkennt man leicht, wann die Verkohlung vollendet ist. Anfangs ist diese Flamme
roͤthlich gelb; dann wird sie blau, weil sie dann mehr
Kohlenstoff-Oxid als gekohlstofftes Wasserstoffgas bei sich fuͤhrt; am
Ende wird sie vollkommen weiß, wahrscheinlich weil das Gefaͤß dann am
heißesten ist, und die Verbrennung fuͤr vollendet angesehen werden kann. Es
gibt noch eine andere Methode, die Vollendung dieser Operation zu beurtheilen, auf
welche man haͤufiger Ruͤksicht nimmt; man sieht naͤmlich auf
das Abkuͤhlen der oberen Theile der Roͤhren, die nicht vom Wasser
umgeben sind, und wirft einige Tropfen Wassers darauf: wenn dieses ohne Gezisch
verduͤnstet, so haͤlt man die Operation fuͤr lang genug fortgesezt. Der
Verlaͤngerer oder Anpasser muß nun vom Kitte befreit und abgenommen, und die
Oeffnung alsogleich mit einer Platte von Eisenblech geschlossen, und diese mit
Ofenlehm aufgekittet werden. Hierauf wird der Dekel des Ofens mittelst des Krahnes
ab- und das Gefaͤß mittelst eben desselben herausgehoben, und
alsogleich durch ein anderes bereits vorgerichtetes ersezt. Nachdem das aus dem Ofen
gehobene Gefaͤß beinahe ganz erkaltet ist, wird es geoͤffnet, und die
Kohle herausgenommen. Ein Demi-Décastére Holz gibt
ungefaͤhr 7 1/2 Karren Kohle.
Man mag was immer fuͤr eine Holzart anwenden, die Resultate sind in Hinsicht
auf die erhaltene Saͤure beinahe dieselben, nicht aber in Hinsicht auf die
gewonnene Kohle, welche desto besser wird, je dichter das Holz warDieß ist nicht allgemein guͤltig. A. d. Ueb.. Man hat bemerkt, daß das Holz, welches lange Zeit an der Luft lag, eine
schlechtere Kohle liefert als jenes, welches noch in demselben Jahre verkohlt wird,
wo man dasselbe geschlagen hat: denn ersteres wird dadurch mehr poroͤs und
folglich schlechter, gibt eine Kohle, die leicht bricht, und zu Staub
zerfaͤllt.
Die auf obige Weise erhaltene brennzelige Holzsaͤure muß nun gereinigt werden,
denn sie ist roͤthlich braun, und haͤlt eine Menge brennzeliges Oel
und Theer aufgeloͤst, welche beide zu gleicher Zeit mit der Saͤure
erzeugt werden. Ein anderer Theil des Produktes erscheint in dem Zustande einer
duͤnneren Mischung. Die Saͤure wird von diesen Produkten so bald als
moͤglich abgeschieden, was durch bloßes Sezenlassen der schwereren Theile
sehr leicht geschieht. Es wurde bereits oben bemerkt, daß der
Destillir-Apparat sich in einen unterirdischen Behaͤlter endet, in
welchem die Products aller Gefaͤße gesammelt werden. An diesem
Behaͤlter ist eine gewoͤhnliche Pumpe angebracht, deren roͤhre bis an den Grund
derselben reicht, um den Theer aufzupumpen, welcher in Folge seiner Dichtheit zu
Boden sinkt: diese Pumpe wird gelegentlich gezogen. Eine Abzug-Roͤhre
ist etwas hoͤher an dem Behaͤlter angebracht, durch welche die hellere
Saͤure in einen Ausguß-Brunnen geleitet, und aus diesem durch eine
andere Pumpe aufgezogen wird.
Die auf diese Weise von dem nicht aufgeloͤsten Theere abgeschiedene
brennzelige Holzfaͤule wird aus dem Ausguß-Brunnen in große eiserne
Kessel aufgezogen, wo sie entweder mit gebranntem oder ungebranntem Kalk
gesaͤttigt wirdVortheilhafter ist es, die essigsaure (holzsaure) Daͤmpfe bei dem
Destillations- oder Verkohlungs-Prozeß unmittelbar in Kalk zu
leiten. D.. Die Saͤure scheidet waͤhrend dieser Saͤttigung eine
neue Menge Theeres aus, welcher mit Schaum-Loͤffeln herausgenommen
wird: man erlaubt dann dem Ruͤkstande einige Zeit um sich zu sezen, worauf
man die uͤbrig gebliebene Saͤure durch bloßes Abgießen abscheiden
kann.
Der auf diese Weise erhaltene essigsaure Kalk zeigt, wenn er mit Wasser gewaschen
wird, denselben Grad, den die angewendete Saͤure ausweiset. Diese
Aufloͤsung wird so lang abgeraucht, bis sie 15° am Araͤometer
zeigt, wo dann eine concentrirte Aufloͤsung von schwefelsamer Soda zugesezt
wird. Die Saͤuren verwechseln nun ihre Basen; auf der einen Seite bildet sich
Gips oder schwefelsaurer Kalk, der zu Boden faͤllt; auf der anderen
essigsaure Soda, welche aufgeloͤst bleibt. In einigen Fabriken loͤst
man mit Huͤlfe der Waͤrme schwefelsaure Soda in dieser
Essigsaͤure auf, und saͤttigt sie spaͤter mit Kalk; auf diese
Weise erspart man das Wasser bei Aufloͤsung des schwefelsauren Salzes, und
erhalt ohne Abrauchung ein eben so concentrirtes Salz, wie auf die vorige Weise. In jedem Falle
laͤßt man aber den Gips vorlaͤufig sich sezen, und gießt dann die
helle Fluͤßigkeit sacht ab. Der Niederschlag wird abgewaschen, und das
angewendete Wasser zu den folgenden Aussuͤßungen gebraucht.
Die aus dieser doppelten Zersezung erhaltene essigsaure Soda wird nachher bis auf 27
oder 28° abgeraucht, je nachdem naͤmlich die Jahreszeit ist. Wenn die
Aufloͤsung diesen Grad von Concentration erreicht hat, wird sie in weite
Krystallisir-Gefaͤße gegossen, und nach drei bis vier Tagen, je
nachdem die Gefaͤße groß sind, wird die Mutterlauge abgezogen. Aus dieser
ersten Krystallisation erhalt man eine Menge rhomboidaler Prismen, die stark
gefaͤrbt sind, breite Flaͤchen und deutlich ausgebildete Kanten haben.
Die Mutterlauge wird wiederholt abgeraucht und krystallisirt, und wenn keine
Krystalle mehr anschießen, wird sie bis zur Trokenheit abgeraucht und in kohlensaure
Soda verwandelt.
Um leere Versuche zu vermeiden (die immer nachteilig sind, sowohl wegen des
Zeitverlustes, den sie verursachen, als wegen der unsicheren Resultate, die sie nur
zu haͤufig gewaͤhren), ist es gut, wenn man vorlaͤufig das
Verhaͤltniß genau berechnet, das zur wechselseitigen Zersezung nothwendig
ist: dieß ist aber nur dann unerlaͤßlich noͤthig, wenn entweder die
Saͤure oder das schwefelsaure Salz geaͤndert wird. Wenn zwei Salze von
demselben Saͤttigungs-Grade faͤhig sind, sich wechselweise zu
zersezen, so darf keines von beiden vorwaltend, und die Menge der wirklichen
Saͤure muß in beiden dieselbe seyn. Diese wirkliche Menge der Saͤure
sieht aber im Verhaͤltnisse mit dem absoluten Gewichte dieser Saͤure
und mit der Saͤttigungs-Faͤhigkeit derselben, das heißt mit dem
Saͤure messenden Grade, welcher als das Product des absoluten Gewichtes
multiplicirt mit diesem Grade dargestellt werden kann. Wenn nun vor der
Saͤttigung der Essigsaͤure der Grad derselben auf dem
Saͤure-Messer bestimmt wurde, wird dieser mit der Zahl der Kilogramme, welche man
anzuwenden gedenkt, multiplicirt, und das erhaltene Produkt ist die wirklich in der
ganzen Menge enthaltene Saͤure, die in essigsauren Kalk zu verwandeln ist.
Eben so bestimmt man den Grad der Saͤure, der in dem schwefelsauren Salze
enthalten ist, und hierauf theilt man die Zahl, welche die wirklich vorhandene
Essigsaͤure ausdruͤkt, mit der Zahl, welche den Grad des
schwefelsauren Salzes bezeichnet; der Quotient druͤkt die Zahl der Kilogramme
von schwefelsaurer Soda aus, welche zur Zersezung noͤthig sind.
Man seze z.B. 1500 Litres Essigsaͤure von 8°, so ist die Menge der in
denselben wirklich vorhandenen Essigsaure = 12,000, das Produkt obiger beiden
Zahlen. Man seze ferner, daß das angewendete schwefelsaure Salz 30° zeige,
und finde die Zahl, welche, mit 30 multiplicirt, 12,000 gibt, d.h. man theile 12,000
durch 30, so werden demnach 400 Kilogramme schwefelsauren Salzes von 30° am
Saͤure-Messer den essigsauren Kalk vollkommen zersezen, der aus der
Saͤttigung von 1500 Litres Essigsaͤure von 8° am
Saͤure-Messer entsteht. Es bleibt nun nur noch uͤbrig zu
zeigen, wie man den Grad des schwefelsauren Salzes erkennt, und dieß geschieht auf
eine sehr einfache Weise. Man loͤst eine gewiße Mengt dieses schwefelsauren
Salzes in destillirtem Wasser auf, und sezt der Aufloͤsung eine etwas
geringere Menge von salzsaurer Baryt-Aufloͤsung zu, und saͤuert
dieselbe zugleich mit etwas weniger Salpetersaͤure. Hierauf wird diese
Mischung filtrirt, der schwefelsaure Ruͤkstand auf dem Filtrum mit
destillirtem Wasser ausgesuͤßt, getroknet und endlich gewogen. Da nun die
Zusammensezung des schwefelsauren Barytes genau bekannt ist, so wird hiedurch die
Menge Schwefelsaͤure, welche in dem untersuchten Theile schwefelsaurer Soda
enthalten ist, leicht abgeleitet, und folglich auch der Grad am
Saͤure-Messer, den diese Menge ausdruͤckt: wobei nicht zu vergessen ist,
daß im schwefelsauren Baryte die Saͤure wasserfrei, und folglich ein
Fuͤnftel ihres Gewichtes an Wasser zugegeben werden muß, um sie auf
66° Beaumé, oder auf den angenommenen Normal-Punct zu
bringen.
Wir duͤrfen hier nicht ermangeln zu bemerken, daß, ungeachtet aller Vorsorge,
bei dieser doppelten Zersezung eine bedeutende Menge schwefelsaurer Soda und
Essigsaͤure immer gaͤnzlich verloren gehen wirdWenn sorgfaͤltig gearbeitet wird, dann verliert man nur 8 Prozent
schwefelsaures Soda. Hat man die Holzsaͤure vorher uͤber etwas
Kohle destillirt, dann verliert man 1/5tel Saͤure, bei Anwendung der
rohen Saͤure 1/3tel Essigsaͤure. D.. Ist es nicht wahrscheinlich, daß hier, wie bei den Salzpfannen, ein
unaufloͤsbares dreifaches Salz aus Schwefelsaͤure, Kalk und Soda sich
bildet? Wenn dieses waͤre, so koͤnnte man sich diesen Abgang leicht
erklaͤren.
Es ist bisher nicht moͤglich, alle diese Zwischen-Verbindungen zu
umgehen, wenn man die Essigsaͤure von den brennzeligen Producten, die ihre
Bildung begleiten, befreien will. Der Chemiker, welcher ein Mittel finden
wuͤrde, wodurch man sich dieselben ersparen koͤnnte, wuͤrde
sicherlich hohen Vortheil davon ziehen koͤnnen. Man sollte glauben, daß es
hinreichend waͤre, die brennzelige Holzsaͤure mit Kalk zu verbinden,
und den essigsauren Kalk zu calciniren, um alles brennzelige Oel zu
zerstoͤren, und hierauf durch directe Einwirkung der Schwefelsaͤure
reine Essigsaͤure zu erhalten, allem, so sorgfaͤltig man auch hiebe!,
und vorzuͤglich bei der Calcination, verfahren mag, so gibt der essigsaure
Kalk doch niemals gute Essigsaure. Ja man hat sogar behauptet, daß die aus dem
reinsten essigsauren Kalke wieder dargestellte Essigsaͤure (aus essigsaurem
Kalke, der mit der reinsten Essigsaͤure bereitet wurde) weit hinter derjenigen
zuruͤkbleibt, die man zur Bildung des essigsauren Kalkes angewendet hat. So
viel ist gewiß, daß bis jezt kein Chemiker der essigsauren Soda entbehren konnte.
Mehrere haben versucht, dieses Salz durch Saͤttigung der Essigsaͤure
mit roher Soda zu erhalten: der hoͤhere Preis der reineren wird indessen
durch Zeit- und Kohlen-Ersparung reichlich ersezt. Ueberdieß entsteht
bei Anwendung der rohen Soda auch noch der Nachtheil, daß waͤhrend der
Saͤttigung derselben ein abscheulicher Gestank entsteht, in dem eine Menge
geschwefelten Wasserstoffes aus dem Schwefel entwikelt wird, welcher in der rohen
Soda enthalten ist.
Die essigsaure Soda laͤßt sich leicht durch Krystallisation und
Roͤstung reinigen. Diese lezte Operation befreit sie, wenn sie
gehoͤrig durchgefuͤhrt wird, vollkommen von allen
zuruͤkbleibenden Theer-Theilen, welche sie allenfalls noch enthalten
mag. Diese Roͤstung, die man in den franzoͤsischen Fabriken fritte nennt, fodert viele Aufmerksamkeit und
Geschiklichkeit: sie geschieht gewoͤhnlich in Kesseln von Gußeisen.
Waͤhrend ihrer ganzen Dauer (400 Kilogramme fodern gewoͤhnlich 24
Stunden) muß diese essigsaure Soda bestaͤndig mit einer Kruͤke
umgeruͤhrt werden, und man muß sich sehr in Acht nehmen, daß die Hize nie so
hoch steigt, daß das essigsaure Salz durch dieselbe zersezt werden koͤnnte,
sondern uͤberall gleichfoͤrmig und gehoͤrig fortwirkt: wenn das
kleinste Theilchen der Masse anfaͤngt sich zu zersezen, so schreitet diese
Zersezung mit solcher Raschheit durch die ganze Masse fort, daß sie nur mit der
aͤußersten Muͤhe noch aufgehalten werden kann. Nie darf die Hize so
groß werden, daß das essigsaure Salz zu rauchen anfaͤngt. So bald die ganze
Masse schoͤn geflossen ist, hoͤrt die Entwikelung von Blaͤschen
auf, und die Operation ist vollendetDurch dieses Roͤsten verliert man bei angewendeter destillirter
Saͤure die Haͤlfte und bei Anwendung roher Saͤure ein
3/4tel der angewendeten Saͤure. Die Anwendung der lezteren ist jedoch
mehr oͤkonomisch. D.. Man laͤßt dann die Masse abkuͤhlen und sich aufloͤsen,
oder vielleicht ist es noch besser, sie in Faͤsser zu werfen, welche mit
Wasser gefuͤllt sind. Bei diesem lezteren Verfahren entsteht jedoch eine
solche Detonation, daß, um alles Ungluͤk zu vermeiden, die Faͤsser in
die Erde eingesenkt, und mit starken Brettern wohl befestigt werden
muͤßen.
Nachdem dieses essigsaure Salz aufgeloͤst wuͤrde, muß das kohlige
Wesen, welches durch Zerstoͤrung des Theeres entstand, abgeschieden werden,
und hiebei erzeugen sich einige Schwierigkeiten, indem dieser Ruͤkstand
meistens aus so kleinen und allgemein verbreiteten Theilchen besteht, daß die die
Fluͤßigkeit im Durchgange durch das Filtrum hindernDieses, wird durch Filtrir-Apparate, denen die Fluͤßigkeit
durch eine hohe Saͤule, wie beider Real'schen Preße,
zugefuͤhrt wird, sehe erleichtert. D.. Die Leichtigkeit dieser Theilchen macht ihre Abscheidung durch Abgießen
unmoͤglich, wenn die Fluͤßigkeit hoͤher als 15° am
Saͤure-Messer ist: sonst aber koͤnnen sie leichter davon
geschieden werden. Durch neue Abrauchung erhaͤlt man ein vollkommen reines
Salz, und in diesem Zustande von Reinheit wird dann die Essigsaͤure durch
Zersezung mittelst Schwefelsaͤure aus demselben abgeschieden.
Diese texte Operation, so einfach sie scheint, fodert viele Vorsicht und Erfahrung.
Die krystallisirte essigsaure Soda muß gepuͤlvert in einen Siedekessel
gebracht, und sodann die zur Zersezung der ganzen angewendeten Menge derselben
noͤthige Schwefelsaͤure zugesezt werden. Man laͤßt beide eine
hinlaͤngliche Zeit uͤber bei einander; allmaͤhlich
verlaͤßt die Essigsaͤure ihre Verbindung, und steigt an die
Oberflaͤche.
Der groͤßte Theil der nun erzeugten schwefelsauren Soda sezt sich als Pulver
oder in kleinen Krystallen ab, waͤhrend ein anderer Theil derselben in der
Fluͤßigkeit aufgeloͤst zuruͤk bleibt Die Essigsaͤure
wird nur durch Destillation von der schwefelsauren Soda abgeschieden, und
erhaͤlt auf diese Weise einen eben so feinen Geschmak als Geruch; gegen das
Ende der Destillation wird, sie aber etwas brennzelig und etwas entfaͤrbt, so
daß es nothwendig wird, dasjenige, was zulezt uͤberging, von dem, was man
zuerst erhielt, abzusondern. Die Essigsaͤure, die man bei Tische gebraucht,
muß in einer Blase destillirt werden, deren Helm und
Verdichtungs-Roͤhren von Silber sind. Die auf diese Weise erhaltene
Saͤure zeigt gewoͤhnlich 40° am Araͤometer fuͤr
Sauren. Will man dieselbe jedoch in einem sehr concentrirten Zustande, so maß
derselben kochsalzsaurer Kalk in reichlicher Menge zugesezt, und sie dann neuerdings
destillirt werden. Diese sehr concentrirte Essigsaͤure wird hierauf dem
Froste ausgesezt, wo der staͤrkste Theil derselben krystallisirt. Die
Fluͤßigkeit wird abgegossen, die Krystalle werden bei einer Temperatur von 15
bis 20° zerlassen, und diese Operation so lang wiederholt, bis die
Saͤure ohne allen Ruͤkstand bei einer Temperatur von 12 bis 13°
friert: dann hat sie ihr Maximum erreicht, und zeigt an dem Araͤometer
fuͤr SaͤurenSaͤnren 88 bis 90°. Die wasserfreie Essigsaͤure hat 100°,
d.i. auf demselben Grade, auf welchem 66 graͤdige Schwefelsaͤure sich
befindet.
Wir wollen diesen Artikel mit einer Bemerkung uͤber die Zersezung der
essigsauren Soda durch Schwefelsaͤure beschließen. Wenn man die
Schwefelsaͤure zu sacht zusezt, so werden sich bei dieser Operation viele
Schwierigkeiten zeigen; denn die außerordentliche Hize, welche sich dabei entwikelt,
reißt eine solche Menge Essigsaͤure mit sich fort, daß die Arbeiter davon
laufen muͤßen. Dieser Nachtheil kann dadurch durch vermieden werden, daß man
alle Schwefelsaͤure auf einmal zugießt; sie geht dann auf den Boden des
Gefaͤßes hinab, und zersezt nur jene Theile, mit welchen sie in
Beruͤhrung kommt: die hiebei entwikelte Hize wird daher nothwendig in einem
weiten Raͤume vertheilt, und aͤußert kaum eine, fuͤhlbare
Wirkung. Wenn die Schwefelsaͤure eine Art von Trichter oder einen kleinen
Krater bildet, so schiebt der Arbeiter mit der Kruͤke ein Stuͤk
essigsaure Soda um das andere in denselben, und die Zersezung geht
allmaͤhlich fort.
Die ersten Ideen zu dem angegebenen Verfahren dankt man dem Erfinder der
Thermo-Lampe, dem Franzosen, Lebon. Der erste
Apparat dieser Art ward zu Havre in der Absicht errichtet, Gas fuͤr den
Leuchtthurm und Theer fuͤr die Flotte zu erhalten. Da aber der Erfolg nicht
vollkommen entspracht mußte Lebon das Unternehmen aufgeben, und er errichtete eine
Holzsaͤure-Fabrik zu Versailles in der Naͤhe der Wasserleitung
von Marly: das entwikelte Gas wird zur Heizung der Gefaͤße gebraucht, die im
Umtriebe stehen. Seit dieser Zeit haben die Gebruͤder Mollerat, die HHn.
Kurz, Payen, Bobée, Lemercier u.a. aͤhnliche Anstalten errichtet, und
große Summen verwendet um bessere Produkte zu erzeugen. Indessen bleibt hier noch
viel zu leisten uͤbrig, und fruͤher oder spaͤter wird man zu
den wohlthaͤtigsten Resultaten gelangenUeber die weitere Verwendung der rohen und gereinigten Holzsaͤure,
erstere als antiseptisches Mittel und zur Erzeugung mehrerer
Praͤparate, leztere zur Erzeugung des essigsauren Blei's (Bleiezuker)
werden wir in der Folge zuruͤkkommen. D..
Hr. Gill theilt in demselben Hefte aus derselben Quelle
(dem Dictionn. Technologique) Baron Gedda's (in Stokholm) Verdichter mit, dessen man sich,
wenn er hinlaͤnglich groß gemacht wird, eben so gut zu diesem Zweke bedienen kann,
als man sich desselben, wegen der Leichtigkeit mit welcher man die Roͤhren
reinigen kann, mit Vortheil zur Bereitung der parfuͤmirten Wasser,
vorzuͤglich des koͤllnischen Wassers u. d. gl., bedient.
Fig. 14 Tab.
VI stellt Baron Gedda's Verdichter dar. Die drei
Roͤhren AB, CD, EF sind walzenfoͤrmig,
ungefaͤhr 3 Fuß 3 Zoll lang, und, wie die Figur zeigt, an einander
geloͤthet; sie stehen in ununterbrochener Verbindung mit einander. Die
roͤhre AB muß etwas weiter seyn, als der
Schnabel der Blase, um denselben aufnehmen, und gehoͤrig verkittet werden zu
koͤnnen. An dem anderen Ende B ist sie mit dem
Ende D der Roͤhre CD zusammengeloͤthet, und diese beiden Theile sind an eine kurze
kupferne Roͤhre G geloͤthet, welche in
eine maͤnnliche Schraube endet. Diese roͤhre wird mit einer Kappe H geschlossen, welche in ihrer Hoͤhlung eine
weibliche Schraube fuͤhrt, die genau auf die maͤnnliche von G paßt, und auf diese Weise die beiden Roͤhren
mit einem Male hermetisch schließt. Auf aͤhnliche Weise sind die
Roͤhren CD und EF mit einander verbunden. Dieser Apparat ist an den Puncten A, G, J, F in das Metall-Gefaͤß L, M geloͤthet, welches an seinem unteren Theile
mit kaltem Wasser gefuͤllt ist, das waͤhrend der Destillation erneut
werden kann. Die Daͤmpfe treten nun in die Roͤhre AB, und verdichten sich in derselben; die
gebildete Fluͤßigkeit zieht langsam in die Roͤhre CD, und von da in die Roͤhre EF. Da sie in steter Beruͤhrung mit kaltem
Wasser ist, so erreicht sie bald die Temperatur der Atmosphaͤre, und fließt
bei der Oeffnung F heraus. Sollte man besorgen, daß
dieser Apparat nicht lang genug ist, die Daͤmpfe gaͤnzlich zu
verdichten, so koͤnnen noch ein paar Roͤhren auf obige Weise
angebracht werden. Es ist nicht noͤthig, daß das Gefaͤß LM sehr groß ist; denn nimmt man die Roͤhre AB zu 3 Zoll im Durchmesser an, so ist, da das
Wasser immer erneut werden kann, dieß Weite genug. Diese Einrichtung der
Roͤhren gewahrt den Vortheil, dieselben mit der hoͤchsten Leichtigkeit
reinigen zu koͤnnen. Man schraubt naͤmlich die Kappen H und J ab, faͤhrt
mit einer Stielbuͤrste durch, laͤßt Wasser in dieselben, und reibt die
innere Flache rein. An einem bequemen Orte ist unten an dem Gefaͤße LM ein Hahn angebracht, um das Wasser zu
entleerenDieser Kuͤhl-Apparat wird auch bei den gewoͤhnlichen
Branntwein-Brennereien mit Vortheil angewendet. A. d. Ueb..
Tafeln