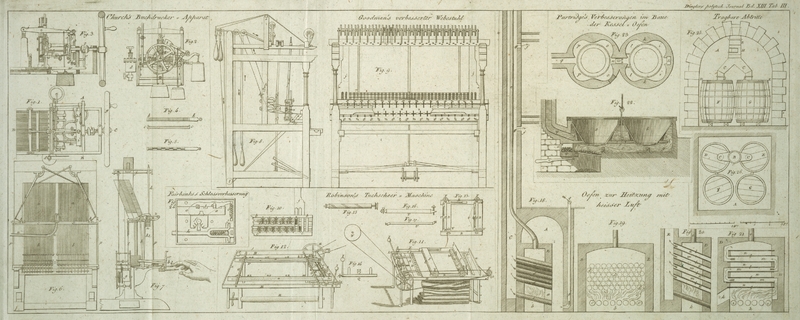| Titel: | Ueber die Anwendung kleiner Kapellen vor dem Löthrohre und einige neue Hülfsmittel zu mineralogischen Analysen. Von Hrn. le Baillif. |
| Fundstelle: | Band 13, Jahrgang 1824, Nr. VI., S. 28 |
| Download: | XML |
VI.
Ueber die Anwendung kleiner Kapellen vor dem
Löthrohre und einige neue Hülfsmittel zu mineralogischen Analysen. Von Hrn. le Baillif.
Aus dem Mercure technologique. Sept. 1823. S.
283. (Im Auszuge).
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Baillif über Anwendung kleiner Kapellen vor dem
Löthrohre.
Die Redaction der Annales de
l'Industrie oder des Mercure technologique
glaubt, daß die hier vorgeschlagenen Handgriffe und Instrumente eines Dilletanten
auch fuͤr Chemiker und Probirer von Profession von Nuzen seyn koͤnnen,
und theilte sie in dieser Absicht mit. Wir heben das Wichtigste aus dieser
Abhandlung fuͤr unsere Leser aus.
Der Zwek des Hrn. Le Baillif ist, die moͤglich
kleinsten Quantitaͤten von Mineralien untersuchen, und ihre Bestandtheile
dadurch mit Bestimmtheit angeben zu koͤnnen, daß er sie aus dem Innersten des
Kuͤgelchens, daß sich vor dem Loͤthrohre bildet, auf die
Oberflaͤche der Kapelle bringt.
Er wendet in dieser Hinsicht sehr weiße Kapellen von 4 Linien im Durchmesser an, die
nur 1/3 Linie dik sind, und wovon 100 nur 103 Gran wiegen. Sie bestehen aus einer
Mischung von gleichen Theilen Porzellan-Erde und dem schoͤnsten weißen
Pfeifen-Thone, und werden bloß mit elfenbeinenen Werkzeugen verfertigt.
Wenn man auf diesen Kapellen ein Oxid oder Metall untersuchen will, so sind 5
Milligramme, oder ein Neunhundertel Gran, mehr als hinreichend. Wenn man Papier,
welches in Metall-Aufloͤsung eingetaucht und verbrannt wurde,
untersucht, so ist Ein Milligramm davon hinreichend. Ein vierekiges Stuͤkchen
Papier z.B., das nur 7 Linien an jeder Seite mißt, und in
Salpeter-Kochsalz- oder schwefelsaure Kupfer-Aufloͤsung
getaucht wurde, gibt auf diesen Kapellen Kupferaͤstchen im schoͤnsten
Metall-Glanze; sehr feines italiaͤnisches Schreibpapier von nur 6
Linien im Gevierte in salpetersaure Kobalt-Aufloͤsung getaucht, das
man kaum wird wiegen koͤnnen, dekt die Kapelle mit einem satten Blau.
Hr. le Baillif bedient sich nur des reinsten
Borax-Glases, das er in einem Platinna-Tiegel schmilzt, und in einem
Achat- oder Porzellan-Moͤrser mit einem aͤhnlichen
Pistille reibt. Hessische Tiegel geben Anfangs immer eisenhaltiges
Borax-Glas.
Die Entdekung des Braunsteines in der Pflanzen-Asche auf nassem Wege ist
bekanntlich sehr schwierig: Hr. le Baillif fand sie
mittelst seiner Kapellen leicht und haͤufig in der Haut der
Reinette-Aepfel, etwas weniger in der Eichenrinde, und traf sie auch noch in
der weißesten Asche einer halbverbrannten Kohle. Er nahm 5 Milligramme von dieser
Asche (ungefaͤhr ein Zehntel Gran); mengte sie in der linken hohlen Hand mit
5 bis 6 Mahl soviel gepulverten und befeuchteten Borax Glas, trug mittelst eines
elfenbeinenen oder Platinna Messerchens die Mischung auf die Kapelle, und brachte
sie vor dem Loͤthrohre in den Fluß, wo sich nur eine sehr lichte gelbliche von dem
Eisen herruͤhrende Farbe zeigte, die bei dem Erkalten verschwand. Er sezte
hierauf einen sehr kleinen Kristall von salpetersaurer Pottasche zu, und brachte die
Mischung neuerdings vor die Flamme des Loͤthrohres: nach dem lebhaften
Aufschaͤumen war die Kapelle weinhefenfarben, oder bloß Rosenfarben. Diese
Untersuchung war in anderthalb Minuten vollendet. Die concave Form der Kapellen ist
fuͤr die Bildung der Farbe hoͤchst wichtig; denn diese ist in der
Mitte oder in der Tiefe immer mehr gesaͤttigt, und gegen den Rand hin mehr
blaß.
Durch diese Versuche uͤberzeugte sich Hr. Le
Baillif, daß es aͤußerst schwer, wo nicht unmoͤglich ist,
Gold und Silber auf den hoͤchsten Grad von Reinheit zu bringen: die Kapellen
werden immer mehr oder minder blaͤulich, außer wenn ersteres von einem
Probier-Roͤllchen und lezteres von Hoͤrnsilber hergenommen ist.
Man nehme 5 Milligramme Kapellen-Silber und behandle es mit
Borax-Glas; das Korn wird kristallisirt mitten in einem Azurbade schimmern.
Man seze demselben 5 Milligramme reines Zinn zu, und leite die Flamme des
Loͤthrohres so, daß das Korn auf der ganzen Kapelle umher laͤuft, so
wird diese, beim Erkalten, eine wehr oder minder lebhaft rothe Farbe annehmen und
behalten, die von Kupfer-Protoxid herruͤhrt. Eben so geht es mit dem
Golde: man wird erstaunen, wenn man die Goldmuͤnzen verschiedener
Laͤnder auf diese Weise untersucht.
Bleiglatte, Mennig, Bleiweiß, mit Borax-Glas und einem Koͤrnchen Zinn
geschmolzen, zeigen durch die Intensitaͤt ihrer Schwaͤrze den Gehalt
der diesen Substanzen beigemengten Metalle an. Kaͤrnthner oder reines Blei
bleibt weiß; alles andere faͤrbt die Kapellen schwarz, in dem
Verhaͤltnisse als andere Metalle beigemengt sind, so daß man durch diesen
Versuch allein, ohne alle Sauren und Reagentien sich von der Reinheit des
kaͤuflichen Bleies uͤberzeugen kann.
Hr. Le Baillif vergleicht die Wirkung der großen von Hrn.
Bréguet, dem Sohne, nach Fresnel's
Grundsaͤzen verfertigten Linse, die außerordentlich stark ist, und viele
Vorsicht braucht, und die Muffel des elliptischen Ofens, die Hr. d'Arcet bei Hrn. Blanc, Journaliste pour la chimie, rue de
l'Arbalete, Nro. 12., fuͤr die Probierer verfertigen ließ, mit dem
Loͤthrohre, und gibt lezterem den Vorzug.
Er verfertigt seine Kapellen auf folgende Weise: Er nimmt, dem Gewichte nach, gleiche
Theile Porzellan- und schone Pfeifende, welche beide sehr fein abgerieben und
vorlaͤufig getroknet wurden, befeuchtet sie mit etwas Wasser, und knetet sie
mit einem Spatel von Elfenbein oder Bein sorgfaͤltig ab, bis der Teig die
gehoͤrige Consistenz erhalten hat, nicht mehr an dem Model anhangt, in
welchem Falle er zu naß seyn wuͤrde, und unter dem Druke des Modelstokes
nicht mehr springt.
Er braucht zur Verfertigung derselben eine 2 Zoll lange, 10 Linien breite, und
hoͤchstens 1/3 Linie dike elfenbeinerne Plane, welche in einer Entfernung von
8 Linien von einem ihrer Enden zwei Loͤcher von 4 Linien im Durchmesser
besizt, die einen etwas schiefabfallenden inneren Rand haben, damit man das in den
selben Enthaltene leichter herausnehmen kann. Auf der weiteren Seite dieser
Oeffnungen macht man mit salpetersaurem Silber ein Zeichen. Man koͤnnte 10
Loͤcher in derselben Platte durchschlagen, um 10 Kapellen auf ein Mahl zu
modeln; allein die Erfahrung lehrte, daß dann die Platte sich leicht wirft, und die
Kapellen nicht gleich dik ausfallen. Siehe Fig. 13.
Fig. 14. ist
ein kleiner Stoͤßel aus Elfenbein, der 7 Linien im Durchmesser haͤlt,
gut polirt und in eine halbkegelfoͤrmige Kappe eingekittet ist, welche sich
an der Basis eines kegelfoͤrmigen, 2 Zoll langen Griffes befindet. Er bildet
die Kapelle zu dem verlangten Kugelausschnitte.
Fig. 15. ein
kleines elfenbeinenes Messerchen in Form eines Krazeisens, um den Teig in den Model
einzudruͤken, und das Ueberfluͤssige wegzunehmen.
Er braucht ferner noch eine Scheibe aus schoͤner weißer Kreide oder aus feinem
Gipse von 4–5 Zoll im Durchmesser und 15 bis 13 Linie Dike, welche die
Feuchtigkeit einsaugt.
Bei Verfertigung dieser Kapellen legt er den elfenbeinernen Model auf die Scheibe von
Kreide oder von Gips, so daß die weitere Oeffnung oben liegt, und druͤkt eine
kleine Kugel des obigen Teiges in jedes Loch mittelst des beschriebenen Messers nach
einander und gleichfoͤrmig ein. Was von dem Teige
uͤberfluͤssig ist, wird weggeschaben. Er faßt den Model mit dem Daumen
und Zeigefinger der rechten Hand, und kehrt ihn auf der linken um; ein leichter
Schlag mit dem Mittelfinger auf jede Kapelle laͤßt sie aus dem Model, fallen.
Er kehrt sie nun so um, daß sie auf jene Seite fallen, welche die Kreide oder das
Gips nicht beruͤhrte, und bringt sie in der hohlen Hand in jene
natuͤrliche Vertiefung, welche sich in der Naͤhe des Daumens an dem
unteren Ende der Schenkel jenes M bildet, das zum
Vorscheine kommt, wenn man die Finger dem Handgelenke naͤhert. Dann nimmt er
den Stoͤssel, faͤhrt damit uͤber die Stirne, um denselben etwas
fettig zu machen, und druͤkt damit sachte auf die Kapelle, die er zugleich
dreht: auf diese Weise wird sie schoͤn glatt ausgedreht. Wo er einmahl
hundert Kapellchen bei einander hat, gluͤht er sie in einem eigens dazu
bestimmten Tiegel: Anfangs werden sie schwarz werden, wenn man sie aber nur 5
Minuten lang in einer starken Weißgluͤhe-Hize haͤlt, so werden
sie milchweiß. Er bewahrt sie in einer verschlossenen Flasche oder in einer gut
schlieft senden Schachtel, und nimmt sie nicht eher heraus, als bis er sie braucht,
damit kein Metallstaub darauf faͤllt.
Das Loͤthrohr, dessen Hr. Le Baillif sich bedient,
speichelt nie, wie er durch mehr als fuͤnfstuͤndige Versuche in
Gegenwart mehrerer Probierer erwies. Die gewoͤhnliche kegelfoͤrmige
Roͤhre reibt sich an seinem Loͤthrohre in eine walzenfoͤrmige
Kammer ein, in deren Mitte eine Roͤhre von 18 Linien eingeloͤthet ist,
deren Schnabel aus Platinna besteht. Das Hintere, weitere, Ende derselben, das drei
Linien weit eindringt, ist unten trompettenfoͤrmig ausgeschweifte An dem
unteren Theile der Kammer ist ein Halsstuͤk angeloͤthet, welches
mittelst eines Stoͤpsels verschlossen wird, der an einem leichten Kettchen
befestigt ist. Wo man, nach langer Anwendung dieses Loͤthrohres, diesen
Stoͤpsel herauszieht, laͤuft alles darin angehaͤufte Wasser
durch den Hals heraus, ohne daß man noͤthig hat das Loͤthrohr
umzukehren, und dasselbe zu schuͤtteln, damit die angehaͤufte
Feuchtigkeit oben heraus laͤuftEs waͤre in dieser Hinsicht wohl besser, der in der Kammer
eingeloͤtheten Roͤhre eine trichterfoͤrmige Gestalt
nach Oben zu geben, die beinahe die ganze Hoͤhlung der Kammer
ausfuͤllt, ohne die Waͤnde zu beruͤhren;
ungefaͤhr so, wie Fig. 35. Tab. I.
wodurch das Blasen nicht so sehr erschwert und die Wirkungstaͤrker
seyn wuͤrde. A. b. Ueb.. Hr. Vincent Chevalier, Optiker, quai de
l'Horloge, N. 69, verfertigt solche Loͤthrohre, wie das hier Fig. 16
abgebildete, und ebenso auch die hier, Fig. 17 abgebildete
Lampe.
Der Koͤrper dieser Lampe besteht aus einer runden Buͤchse von
Eisenblech von 3 Zoll im Durchmesser, und 15 Linien Hoͤhe. Der Dochthalter,
der in einem Schnabel eingerieben wird, besteht aus 4 Cylindern, deren jeder
anderthalb Linien im Durchmesser hat: zwei davon haben eine leichte Ausbeugung, wie
ein V, dessen Spize, wenn man blaͤst, nach der
Kohle sieht. Die Erfahrung hat gelehrt, daß diese Vorrichtung der Dochte eine
staͤrkere Hize gibt, als wenn man alle vier in einem walzenfoͤrmigen
oder laͤnglichen Drahttraͤger vereint.
Zur Rechten des Dockttraͤgers ist eine kupferne Stange aufgeloͤthet,
welche zwei Halsbaͤnder fuͤhrt, die sich schieden lassen; eines
derselben traͤgt einen kleinen glaͤsernen Schornstein, den man
uͤber die Flamme sezt, wenn man aufhoͤrt zu blasen; das andere
traͤgt, noͤthigen Falles, ein Gefaͤß oder eine
Probe-Roͤhre, um augenbliklich die Kapelle in einer Saͤure
abkochen zu koͤnnen, wenn man eine Gegenprobe auf nassem Wege machen zu
muͤssen glaubte. Dem Dochthaͤlter gegenuͤber ist eine
Doppelroͤhre zum Luftzuge angebracht. Das Innere steht mit dem, in der Lampe
enthaltenen Oehle in Verbindung, und haͤlt einen Docht, der nur von der
Groͤße der gewoͤhnlichen Nachtlampen ist: eine Vorrichtung, die sehr
bequem wird, um immerdar Feuer im Laboratorium zu unterhalten. Die innere
Roͤhre traͤgt einen sehr leichten Apparat, um irgend eine
Fluͤssigkeit in den Sud zu bringen, oder abdampfen zu lassen. Auf diese Weise
wird alle Hize benuͤzt, und waͤhrend man blaͤst, geschehen noch
andere Arbeiten ohne Zeitverlust. Eine Feder-Zange zum Richten und Ziehen der
Dochte (denn diejenigen Dochte, die bei der Ausbeugung des V stehen, muͤssen etwas vorwalten) ist unentbehrlich. Wenn man das
Oehl stets auf demselben Niveau haͤlt, wird man nicht den mindesten Rauch
verspuͤren. Hr. Le Baillif bedient sich einer
Mischung aus 3 Theilen
gereinigten Reps-Oehles auf Einen Theil Schoͤpfen Markoͤhl,
welches sich an der Luft und durch das Schlagloch nie verdichtet, wie dieß bei dem
Reps-Oehle, wenn es auch noch so rein ist, gewoͤhnlich geschieht.
Hr. Le Baillif macht bei dieser Gelegenheit eine
interessante Digression uͤber den kuͤnstlichen Avanturino, von welchem
beinahe alle Schriftsteller erzaͤhlen, daß er zu Venedig zu, faͤllig
durch das Hineinfallen einiger Kupferspane in einen Tiegel, in welchem Glas im
Flusse stand, erfunden wurde. Wenn man dieses artige Product unter einem
Vergroͤßerungs-Glase betrachtet, das beinahe zehn Mahl
vergroͤßert, so wird man eine unzaͤhlbare Menge flacher,
undurchsichtiger Krystalle finden, wovon die einen gleichseitig, die anderen
sechsekig sind: leztere entstehen offenbar durch Abstuzung der Spizen der ersteren.
Hr. le Baillif fand bisher nur ein einziges Tetraͤder. Wenn man nun
6–3 Milligramme Avanturino in einer achatnen oder porzellanenen Reibschale zu
dem feinsten Pulver zerreibt, und mit Borax schmilzt, so wird die Kapelle eine Art
von Augenflek darbiethen, dessen Mittelpunkt hell blutroth und dessen Rand
dunkelgruͤn ist. Kocht man diese Kapelle in einer Probe-Roͤhre
mit 4–5 Tropfen Salpetersaͤure, die mit ebensoviel destillirtem Wasser
verduͤnnt ist, sezt man ein Gramm Wasser zu, theilt das Ganze in zwei Theile
in einer Porzellan-Tasse unter fleißigem Ruͤtteln mit blausaurem
Kalke; so wird man ein beinahe schwarzes Blau erhalten, zum Beweise, daß hier das
Eisen sehr vorwaltet. Gießt man in den anderen Theil Ammonium, so wird das Eisen
niedergeschlagen, und wenn man in die filtrirte Fluͤssigkeit blausauren Kalk
gießt, sich Kupfer zeigen. Hier sind also zwei bekannte Metalle, von welchen wir
nicht wissen, wie sie im Glase sich so regelmaͤßig krystallisiren konnten.
Auf diese Welse dient das Kochen der Kapelle als Gegenprobe, wenn sie bei dem
Erkalten die Farbe verliert, die sie unter dem Loͤthrohre erhielt.
Wenn man nur außerordentlich kleine Stuͤkchen zu untersuchen hat, die man zu
verlieren, in Gefahr ist, so nimmt Hr. Le Baillif statt
des Gahn'schen Hakens eine Art von kegelfoͤrmigen Korkzieher aus Platinna
Draht von 1/5 Linie im Durchmesser; das kleine Stuͤkchen legt sich von selbst
in demselben dort hin, wo es nicht mehr durchfallen kann. Um diesen kleinen Apparat
zu verfertigen, windet man einen Platinna-Draht Um einen eisernen Kegel, wie
einen Bindfaden um einen Kreisel, und schiebt dann jede Spirale so weit von der
zunaͤchst stehenden, daß eben soviel Raum leer, als voll bleibt. Es ist aber
weit bequemer, zwei Kegel von verschiedener Dike an den Enden eines kupfernett
Cylinders von 2 1/2 Zoll Laͤnge und 3 Linien im Durchmesser zu drehen (Fig. 18). Die
Mitte ist vierekig zugefeilt oder eingefeilt, damit der Draht waͤhrend des
Umwindens besser haͤlt; man windet nun 8 bis 10 Schraubenwindungen, und
macht, mittelst eines Bohrers, ein kleines Loch durch die Basis eines jeden dieser
Cylinder, um das Ende des Drahtes, den man unter starkem Anziehen windet, zu
befestigen auf diese Weise wird das Instrument in sehr gleichfoͤrmigen
Abstanden von diesem Model herabkommen. Fig. 18 bis. Nachdem das
zu pruͤfende Koͤrperchen sich in diesem Drahte verglaste, kocht man
denselben ist einem Proberoͤhrchen mit der noͤthigen Saͤure
aus, die, da die Platinna nur in zusammen gesezten Sauten aufloͤsbar ist, den
Draht nicht aufloͤst. Wenn dieser Koͤrper verknistern koͤnnte,
und nicht regulinisch ist, bedient Hr. Le Baillif sich
zweier Kegel aus sehr duͤnnen Platinna-Blaͤttchen, wovon einer
dem anderen als Dekel dient, und befestigt sie mittelst eines Drahtes aus demselben
Metalle auf einer zur Haͤlfte ihrer Dike eins geschnittenen Kohle. Fig. 19. Diese
Kegel werden auf folgende Weise verfertigt. Man zeichnet einen Kreis von 15 bis 18
Linien im Durchmesser auf einem Blattchen Platinna, und schneidet ein Segment eines
Viertel-Zirkels, oder die Haͤlfte aus, je nachdem man ihn weiter oder
enger haben will; den Ueberrest wikelt man um einen staͤhlernen Kegel und
klopft ihn mit einem hoͤlzernen Hammer. Wenn die Raͤnder gut
uͤbereinander gelegt sind, so dauern diese Duͤten lang; aber noch
laͤnger, wenn man sie mit Gold loͤthet, wozu nur ein einmahliges
Blasen mit dem Loͤthrohre auf drei mit Borax-Glas bestreute
Goldblaͤttchen noͤthig ist. Fig. 20.
Eben so ist der Boden in dem Platinna Cylinder von einem Zoll Hoͤhe und 2 1/2;
Linien Weite eingeloͤthet. Fig. 21.
Fig. 22 ist
ein Tiegel aus Platinna von 16 Linien Hoͤhe, und 15 Linien Weite oben, und 9
Linien an seiner Basis, mit einem Dekel und einer angenieteten Handhabe aus einem 2
Zoll langen Platinna Drahte, der oben sich hakenfoͤrmig umkruͤmmt; er ist auf Reifen sehr
bequem. Wenn man den Boden mit Beinasche dekt, kann man das thoͤnerne
Naͤpfchen mit einer kleinen Kapelle, die zu einer Probe hergerichtet ist,
oder einen kleinen feuerfesten Tiegel hineinthun.
Wenn man mit Phosphor-Salz arbeitet, so wird das Korn oͤfters schwarz;
die Schriftsteller sagen, man soll es in Faden ziehen. Hr. Le
Baillif raͤth, sie platt zu machen, um sie ganz aufbewahren zu
koͤnnen, und wirft sie, in dieser Hinsicht, noch roch gluͤhend, auf
eine Porzellan-Tasse, und druͤkt sie mit einem Stuͤke Krystall
oder mit dem gestrichenen Theile eines glaͤsernen, an beiden Enden polirten
Stoͤpsels einer Carasine. Fig. 23.
Statt des Federzaͤngelchens, aus welchem das runde Korn, wenn man die
Durchsichtigkeit und Farbe desselben beurtheilen will, so oft ausspringt, bedient
Hr. Le Baillif sich des Pfropf-Wachses, das er an
dem Ende eines Kupferdrahtes kegelfoͤrmig zuformt Fig. 24.
Fig. 26. ist
eine glaͤserne an einem Ende geschlossene Roͤhre. Am Ende eines
kleinen Griffes befestigt man ein Kluͤmpchen Wolle, und uͤberzieht es
mit Handschuh-Leder, so daß es weich genug ist, um sich mit
Joseph-Papier umwinden zu lassen. Hat man irgend etwas, worin man Queksilber
vermuthet, so puͤlvert man es, befeuchtet den Staͤmpel unten ein
wenig, und erwaͤrmt die Roͤhre uͤber einer Kerze. Das
Queksilber stellt sich alsogleich in Gestalt von Kuͤgelchen auf dem
Joseph-Papiere her. Wenn man nun den Staͤmpel herauszieht, und ihn auf
einem Goldstuͤke, das mit etwas Essig befeuchtet wurde, einige Mahle hin und
her reibt, so wird dieses dadurch versilbert erscheinen. Dieser Versuch ist in 2
Minuten gethan.
Fig. 29 ist
eine kleine Platinna-Muffel, die man mitten unter gluͤhende Kohlen
stellt, und mit Beinasche bestreut, um die kleinen Kapellen darauf sezen zu
koͤnnen: man kann auf diese Weise 8 bis 10 Proben auf einmahl ohne Ofen und
gewoͤhnliche Muffeln machen.
Hr. Le Baillif findet das Instrument Fig. 23 sehr bequem, um
eine sehr geringe Menge Queksilber, z.B. ein Gramm, abzumessen. Am Ende einer
6–8 Zoll langen, und hoͤchstens eine Viertel-Linie im
Durchmesser haltenden Roͤhre blaͤst er einen Trichter; das andere Ende wird
in eine Spize ausgezogen und In der Hoͤhe des Trichters abgebrochen: beide
Enden sind unter einem rechten Winkel gebogen. Er wiegt nun ein Gramm Queksilber ab,
gießt es bei dem Trichter ein, haͤlt das Instrument horizontal, und
bezeichnet die Laͤnge dieser Saͤule mit zwei aufgeleimten
Papier-Streifen. Wo man nun genau ein Gramm Queksilber braucht, gießt man
welches bei dem Trichter ein, neigt die Roͤhre, und laͤßt das
Ueberfluͤssige bei dem Haarroͤhrchen ausfließen. Auf diese Weise
erspart man alles WaͤgenEs scheint indessen, daß nicht bloß die Papierstreifen eine gewisse Menge
Queksilbers verbergen, sondern daß selbst Haare, wenn man sie statt der
Papierstreifen brauchen wollte, eine Parallaxe erzeugen und dadurch
Unrichtigkeiten veranlassen koͤnnten. Dann kommt noch die
Schwierigkeit der horizontalen Lage, A. d. Ueb..
Tafeln