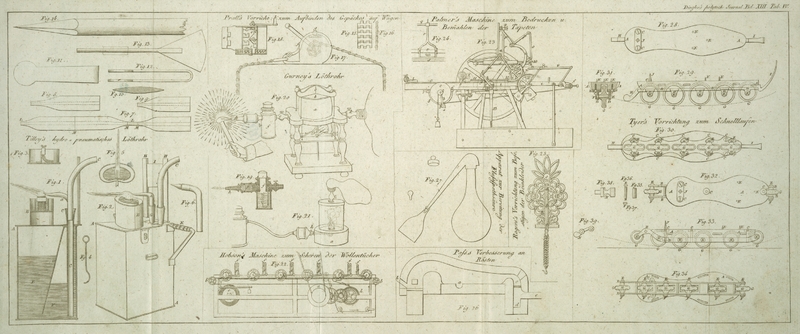| Titel: | Tylley's hydro-pneumatisches Löthrohr zum Gebrauche für Chemiker, Emaillirer, Probirer, Glasblaser etc. Mit Anmerkungen von Hrn. Th. Gill. |
| Fundstelle: | Band 13, Jahrgang 1824, Nr. XX., S. 137 |
| Download: | XML |
XX.
Tylley's
hydro-pneumatisches Löthrohr zum Gebrauche für Chemiker, Emaillirer, Probirer,
Glasblaser etc.Tilley's hydropneumatisches Loͤthrohr haben
wir schon fruͤher in unserm neuen Journal fuͤr die
Indiennen- und Baumwollendrukerei, Bd. 2. S. 332 in der Abhandlung
„Darstellung verschiedener Arten, das
Glas und andere Gegenstaͤnde mit dem Loͤthrohre vor der
Lampe zu bearbeiten u.s.w., von A. F. Pruͤkner und dem
Herausgeber, beschrieben und eine Abbildung davon gegeben. Die
gegenwaͤrtige Beschreibung so wie die Abbildungen davon sind aber weit
vollstaͤndiger, und die beigefuͤgten Bemerkungen und
Verbesserungen des Hrn. Gill, machen nun dieses Loͤthrohr mehr
interessant. D. Mit Anmerkungen von Hrn. Th. Gill.
Aus dem XXXI. Bande der Transactions of the Society for the
Encouragement of Arts Manufactures and Commerce, in Gill's Technical
Repository. November 1823. S. 332.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV. (Im Auszuge).
Tylly's hydro-pneumatisches Löthrohr.
Hr. Tilley, ein reisender
Glas-Blaser, uͤberreichte der Society of
Arts im Jahre 1812 sein Loͤthrohr, und erhielt von derselben 15
Guineen fuͤr seine Erfindung, welche in einem zinnernen oder kupfernen und
verzinnten Gefaͤße besteht, das mit einer von dem oberen Theile bis auf Einen
Zoll ungefaͤhr von dem Boden hinabreichenden Scheidewand versehen, und bis
auf zwei Drittel mit Wasser gefuͤllt ist. Mittelst einer Roͤhre, die
ungefaͤhr bis auf einen halben Zoll von dem Boden hinabreicht, blaͤst
man an dem luftdichten Ende in das Wasser. Die Luft steigt in Blasen durch das
Wasser hinauf, und druͤkt dieses unter der Scheidewand in die andere
Abtheilung hinuͤber, wo dann endlich die Schwere des Wassers auf die
eingeblasene Luft wirkt, und dieselbe durch ein Loͤthrohr in die Flamme einer
Lampe solang treibt,
bis alle Luft verzehrt ist. Damit der Luftstrom immer gleich stark bleibt,
blaͤst man von Zeit zu Zeit neue Luft in das Gefaͤß. Der ganze Apparat
wiegt, mit Lampe und Futteral, nur 3 1/2 Pfund, und kostet, aus verzinntem Kupfer,
nur 2 1/2 Guineen.
Die gewoͤhnliche Vorrichtung zum Blasen kleinerer Glas-Arbeiten besieht
in ein paar Blasebaͤlgen, die unter einem Tische angebracht sind, mit dem
Fuße getreten werden, und von welchen eine Roͤhre auf dem Tische emporragt,
die in die Flamme einer Lampe blaͤst. Hierdurch entsteht nothwendig eine
Unregelmaͤßigkeit in dem Luftstrome, und ein Flattern der Flamme, wodurch die
Hize ungleichfoͤrmig wird. Tilley's
Geblaͤse beseitigt diese NachtheileGerade das Gegentheil, wie wir a. a. O. S. 337. nachgewiesen haben. D.
Fig. 1. stellt
seine Maschine im Durchschnitte dar, und Fig. 2. im Perspektive und
in voller Thaͤtigkeit. AA, ist ein
Gefaͤß aus verzinntem Eisen- oder Kupfer, ungefaͤhr 17 Zoll
hoch, 5 weit, und 9 breit: der Dekel oͤffnet sich in Angeln und traͤgt
die Lampe, B, die mit Talg, statt mit Oehl, unterhalten
wird. C, ist das Blaserohr, durch welches die Luft in
das Gefaͤß geblasen wird, D, in Fig. 1, ist die
schiefgeneigte Scheidewand, welche das Gefaͤß in zwei Kammern, E und F, theilt; da sie aber
nicht ganz bis auf den Boden reicht, so stehen diese beiden Kammern unten mit
einander in Verbindung. Die Kammer, F, ist oben
luftdicht geschlossen; die andere, E, ist bloß mit dem
Dekel des Gefaͤßes bedekt, und kann folglich gegen die aͤußere Luft
als offen betrachtet werden. Die Roͤhre C, Fig. 1, ist
oben bei ihrem Eintritte in die Kammer luftdicht eingeloͤthet, und steigt bis
nahe an den Boden des Gefaͤßes, wenigstens tiefer als die Scheidewand, D, hinab, so daß ihre untere Oeffnung stets unter Wasser
getaucht ist. Der metallne Theil des Loͤthrohres, G, der den Luftstrom in die Flamme der Lampe leitet, ist gleichfalls in
der Deke der Kammer, F, eingeloͤthet, und
haͤlt eine gekruͤmmte Glasroͤhre, a, die sich in eine sehr kleine und zarte Oeffnung endet, und luftdicht in die
zinnerne oder kupferne Roͤhre, g, einreibt. Wenn
man nun in die Roͤhre, C, blaͤst, so wird die Luft
durch dieselbe in Blaͤschen durch das Wasser in dem oberen Theile der Kammer,
F, aufgetrieben; hierdurch wird eine
verhaͤltnißmaͤßige Menge Wassers unter der Scheidewand, D, in die andere Kammer, E,
hinuͤbergedruͤkt, und die Hoͤhe der Wassersaͤule in
derselben in dem Maaße vermehrt, als sie in F vermindert
wird; und da nun das Wasser sich wieder ins Gleichgewicht zu stellen bemuͤht,
so entsteht ein stetiger Druk auf die Luft oben in F,
welche dann durch die Roͤhre, a, in die Flamme
der Lampe hinausfaͤhrt. Es ist daher nicht noͤthig, ununterbrochen mit
dem Munde zu blasen; denn der Druk des Wassers wirkt stetig fort, wenn auch die Luft
in Zwischenraͤumen eingeblasen wird, was nur dann zu geschehen braucht, wenn
die Gewalt des Luftstromes bedeutend nachlaͤßt.
Der metallne Stiefel oder Einsaz, welcher die glaͤserne Roͤhre, a, mit dem Gefaͤße, A, verbindet, ist kegelfoͤrmig; man wikelt zuvoͤrderst einen
Streifen Papier um die Glasroͤhre, und windet dann Baumwollengarn
kegelfoͤrmig auf dieselbe auf, so daß sie genau in den Stiefel paßt, und doch
nach asten Seiten hin gedreht werden kann. Auf eine aͤhnliche Weise ist die
andere gekruͤmmte metallne Roͤhre, C, in
dem unteren Theile der Blaseroͤhre befestigt. HH, sind zwei Leisten eines zinnernen Rahmens, der vorne an diesem
Apparate angebracht ist. Diese Leisten sind innenwendig mit Furchen versehen zur
Aufnahme einer Zinnplatte, I, die auf- und
abwaͤrts geschoben werden kann, und als Schirm dient, welcher das Auge des
Arbeiters vor dem Lichte der Lampe schuͤzt, waͤhrend er uͤber
denselben weg auf seine Arbeit sieht. Dieser Schirm ist so befestigt, daß sein Fuß
zwischen dem Dekel des Gehaͤuses und der oberen Wand der geschlossenen
Kammer, F, zu stehen kommt. K, ist einer der beiden Griffe, auf welche der Arbeiter seine Arme
stuͤzt, waͤhrend er das Glas in die Flamme haͤlt: der andere
Griff befindet sich diesem gegenuͤber auf der anderen Seite. Diese beiden
Griffe werden mit Tuch-Enden oder Leder umwunden, so daß sie eine Art von
Kissen bilden, und das Gefaͤß selbst wird mittelst eines Riemens, der an den
Henkeln an jeder Seite angeschnallt wird, und unter einer Bank oder unter einem
Stuhle durchlaͤuft, auf diesen befestigt.
Die Lampe ist von Zinn, und elliptisch oder vielmehr bohnen- oder
nierenfoͤrmig an einer Seite naͤmlich eingebogen; quer uͤber
den Mittelpunct derselben steht ein metallner Dochthaͤlter, mit einem Ringe
an einet Seite, und an dem Boden der Lampe angeloͤthet: siehe Fig. 3. Durch diesen Ring
wird der Docht von Baumwollengarn gezogen, und wenn er abgeschnitten, und nach
beiden Seiten hin geoͤffnet wurde, wie diese Figur und Figur 5 zeigt, so bildet
er einen Durchgang durch die Mitte, durch welchen der Luftstrom von a aus durchfaͤhrt, (Fig. 1 und 5) und die lang zugespizte
Flamme auf den zu erhizenden Gegenstand hinblaͤst. Die Lampe (Fig. 3 und 5) ist mit Talg
gefuͤllt, der durch die Hize geschmolzen, fluͤssig wird und so gut wie
Oehl brennt, weniger riecht, in der Kaͤlte leichter erstarrt, und dadurch
leichter tragbar wird. Die Lampe wird in ein anderes Gefaͤß, B, Fig. 1, 2, und 5, eingesezt, in welchem
dieselbe auf der gehoͤrigen Hoͤhe gehalten wird: der Raum rings umher
zwischen der Lampe und diesem Gefaͤße dient zur Aufnahme des Talges, wenn
welcher abfaͤllt.
Der lange, flache Baumwollen-Docht der Lampe dient besser als der
gewoͤhnliche runde. Das Ende des glaͤsernen Loͤthrohres, a, muß gerade in die Flamme eintreten, wenn der
ausfahrende Luftstrom einen Flammenkegel nach der entgegengesezten Seite hin bilden
soll: wird der Luftstrom gehoͤrig geleitet, so ist dieser Kegel deutlich und
vollkommen umschrieben, und erstrekt sich auf eine betraͤchtliche
Laͤnge. Man muß wohl Acht geben, daß der Luftstrom nirgendwo auf den Docht
aufschlaͤgt, indem derselbe sonst in Unordnung gebracht, und der Kegel in
mehrere Theile zerspalten werden wuͤrde. (Ein am Ende zugespizter, und, wie
in Fig. 4.
gebogener Draht taugt sehr wohl zum Ebenen des Durchganges des Luftstromes durch den
Docht). Der Luftstrom muß etwas uͤber dem Dochte auffallen, und da, wenn die
Flamme nicht bedeutend stark ist, zu wenig Feuer fuͤr die Wirkung des
Luftstromes uͤbrig bliebe, muß der Docht, wie in Fig. 3., geoͤffnet
werden, damit er eine groͤßere Oberflaͤche, und die moͤglich
groͤßte Flamme darbiethet. Der Luftstrom muß aus dem
Loͤth-Rohre durch den Canal oder durch die Oeffnung des getheilten
Dochtes durchgefuͤhrt werden, wenn er den vollkommensten und
glaͤnzendsten Kegel bilden soll: der Theil des Kegels, der der Lampe zunaͤchst ist, ist
gelblich weiß, der entferntere blau oder purpurfarben.
Der zu hizende Gegenstand wird in die Flamme gehalten, und zwar am Ende des
gelblichweissen Theiles, wo die Hize am groͤßten ist, und wo er nicht vom
Ruße beschmuzt wird, der die weiße Flamme begleitet.
Wenn man Glasroͤhren in diesen Theil der Flamme bringt, so werden sie leicht
biegsam und koͤnnen gebogen, oder in Faden und Spizen gezogen und hermetisch
geschlossen werden; sie koͤnnen, wo man an dem anderen Ende einblaͤst,
in Kugeln oder in verschiedene Formen, die der Operateur zu geben wuͤnscht,
geblasen werden.
Was die Anwendung dieses Loͤthrohres in chemischer, mineralogischer und
technischer Hinsicht betrifft, so ist sie ohnedieß bekannt: nur muß man bemerken,
daß die Kohle, auf welcher man den zu untersuchenden Gegenstand unter die Flamme
bringt, feinkoͤrnig, dicht und gehoͤrig gebrannt ist; denn, wo sie zu
wenig verkohlt waͤre, wuͤrde sie wie ein Stuͤk Holz trennen,
und den Gegenstand verdunkeln, und zu stark gebrant, wuͤrde sie zu leicht
eingeaͤschert werden, so daß der Gegenstand darin verloren gehen
koͤnnte. Die Holzkohle vermehrt durch die zuruͤkschlagende Flamme die
Hize gewaltig, und erhizt auch den Gegenstand auf der gegenuͤberstehenden
Seite, verbreitet also eine ganze Atmosphaͤre von Hize und Flamme um den zu
untersuchenden Koͤrper, die die Hize nicht so schnell entweichen
laͤßt, als wenn man denselben aus dem Flammenkegel herausnimmt, oder in
freier Hand haͤlt etc.
Um zu verhuͤthen, daß man nicht mehr Talg als noͤthig braucht, ist es
gut mehrere Lampen mit Dochten zu haben, z.B. eine mit 2 flachen Dochten (wie bei
den Liverpool-Lampen) von ungefaͤhr 4/5 Zoll Breite; eine mit 4, und
eine dritte mit 6 Dochten, oder fuͤr soviel Garn, als diesen an Umfang gleich
kommt.
Auch die glaͤsernen Loͤthroͤhrchen muͤssen verschiedenen
Durchmesser in ihren Oeffnungen fuͤr die verschiedenen Dochte und Flamme
besizen, damit sie verhaͤltnißmaͤßig Luft ausstroͤmen
koͤnnen, und wenn Glas geblasen werden soll, muß der Schnabel etwas nach
aufwaͤrts gerichtet seyn.
Auch Schweinfett ist eben so gut zur Lampe, wie Talg, wo nicht besser.
Bemerkungen uͤber diesen Apparat und Verbesserungen an
demselben von Hrn. Gill.
Hr. Gill hat sowohl Hrn. Tilley, als den Secretaͤr der Gesellschaft, Hrn. Taglyr sel. Andenkens, bei dem Gebrauche dieses Loͤthrohres
oͤfters beobachtet, und sich daher zu folgenden Bemerkungen veranlaßt
gefunden.
Die groͤßte Unbequemlichkeit bei Anwendung dieses Apparates fand er in dem
haͤufigen Verderben der glaͤsernen Loͤthroͤhren, deren
Spize sehr oft zuschmolz, wenn sie nur einen Augenblik in der Flamme gelassen
wurden, ohne daß Luft aus denselben ausstroͤmte. Er entschloß sich daher zu
einem bequemeren Verfahren bei Verfertigung dieser Roͤhren, als jenes des
Hrn. Tilley war, welcher jedes solche Roͤhrchen
aus einem Theile einer gebogenen Glasroͤhre verfertigte. Er bog eine
Glasroͤhre unter einem bestimmten Winkel, die dann zur Aufnahme aller
uͤbrigen Loͤthroͤhrchen diente, die er leicht dadurch bilden
konnte, daß er bloß bei starker Hize ein Stuͤk einer anderen
Glasroͤhre erweichte, und dann zu gehoͤriger Form und Staͤrke
auszog; dann wieder einen anderen Theil derselben Roͤhre in gehoͤriger
Entfernung erweichte und auszog, u.s.f., bis er eine hinlaͤngliche Anzahl
solcher Theile bearbeitet hatte. Dann schnitt er diese Roͤhre mittelst eines
eigenen Messers in so viele Theile, als er Loͤthroͤhrchen daraus
machen konnte, und erhielt auf diese Weise aus einem Stuf Roͤhre, aus welchem
Hr. Tilley nur ein Loͤthroͤhrchen erhalten haͤtte, fuͤnf
bis sechs solche Roͤhrchen. Fig. 6. zeigt eine solche
gebogene Glasroͤhre mit dem Roͤhrchen in derselben. Fig. 7. ist die
Glasroͤhre, welche durch das Ausziehen bei LL, verengt wurde, und bei MM, und M durchschnitten wird. Fig. 3. und 9. stellt zwei
solche Loͤthroͤhrchen einzeln dar; eines mit einer feineren Spize und
Oeffnung, das andere mit einer groͤberen. Diese Loͤthroͤhrchen
lassen sich leicht in der gekruͤmmten Roͤhre luftdicht befestigen,
wenn man ein Stuͤkchen Silber- oder Seidenpapier um dasselbe windet.
Fig. 10.
zeigt das oben erwaͤhnte Messer zum Schneiden der Glasroͤhren im
Durchschnitte: es ist
ungefaͤhr acht Zoll lang, verschmaͤlert sich in eine Spize, und ist
mit einem hoͤlzernen Hefte versehen. Der Stahl an diesem Messer muß ganz hart
gelassen werden, und es erhaͤlt nur dadurch seine Schneide, daß man es an
beiden Seiten mit einem Schuster-Wezstein (shoe-maker's gritstone
) reibt; eben so wird es auch geschaͤrft, wenn es stumpf geworden ist.
Dieses Messer ist weit besser als die dreiekigen Saͤgefeilen, welche die
Barometer-Macher gewoͤhnlich hierzu brauchen, und selbst besser als
die Lancashirer glatten Feilen, die andere Glas-Blaͤser brauchen. Wenn
die Spize des Loͤthroͤhrchens zu fein ist, so kann man sie leicht
dadurch staͤrker machen, daß man etwas mehr von dem Ende wegschneidet, worauf
man sie bloß auf einem Wezsteine, wie ihn die Zimmerleute brauchen, abreibt.
Fig. 11.
zeigt eine messingene Zange von vorne, und Fig. 12. von der Seite.
Sie ist aus steif gewalztem Messing, ungefaͤhr ein Achtel Zoll dik und 7 Zoll
lang; ihre kreisfoͤrmigen Enden haben ungefaͤhr 2 Zoll im Durchmesser.
Hr. Tilley brauchte sie zum Flachdruͤken der Riechflaͤschchen und
ihrer Stoͤpsel; auch zum Druͤken der rothgluͤhenden Glasenden,
um dieselben zu verdiken, ehe man sie zu Kugeln ausblaͤst.
Figur 13.
zeigt einen anderen Schirm von Zinn, den Hr. Tilley statt des unter Fig. 1. 2. als HI angezeigten Schirmes brauchte, der sein Auge
vor dem Lichte der Lampe schuͤzte, und ihm doch ein deutlicheres Sehen seiner
Gegenstaͤnde erlaubte. Er schiebt sich in einem, an der dem Arbeiter
zugekehrten Seite befindlichen Stiefel auf und nieder.
Fig. 14. ist
ein walzenfoͤrmiger Stab von Messing, ungefaͤhr 5 Zoll lang, und 3/8
Zoll im Durchmesser: ein Ende laͤuft in eine dreiekige Spize zu. Hr. Tilley
bediente sich desselben zur Erweiterung der Muͤndungen der
Glasroͤhren, Flaͤschchen etc. und er ist hierzu sehr bequem.
Es ist der Muͤhe werth zu bemerken, wie Gr. Tilley
den Docht zu seiner Lampe zubereitete. Er wikelte feines Baumwollengarn um die vier
Finger der linken Hand, so daß sie einen flachen Wikel bildet, der stark genug wird
das Auge des Dochthaͤlters auszufuͤllen, der aber nicht zu fest seyn
darf, damit er den Talg nicht hindert zwischen den Faden aufzusteigen. Ehe man den
Wikel von den Fingern abnimmt, muß man einen einen Zwirnsfaden durch denselben ziehen. Wenn hierauf die
Lampe mit Talg, Schweinsfett etc. gefuͤllt ist, wird der Faden durch den Talg
und durch das Auge des Dochthaͤlters gezogen, und eben dieß geschieht auch
mit dem Wikel selbst, den man sorgfaͤltig in dem Auge ausbreitet. Das obere
Ende des Dochtes wird dann angebrennt, und, wie er weiter brennt, mit der
Lichtschere aufgeschnitten, und ein Durchgang durch die Mitte desselben, damit der
Luftstrom durchziehen kann, vorgerichtet. Auf jeder Seite muß der Docht eben
zugestuzt werden: er kann ungefaͤhr einen halben Zoll uͤber das Auge
des Dochthaͤlters emporragen.
Ein auf diese Weise vorgerichteter Docht dauert eine bedeutende Zeit uͤber,
ohne daß es noͤthig waͤre denselben zu puzen, wenn man anders bei dem
Anzuͤnden desselben, wo der Talg fest ist, die Vorsicht braucht, nur jenen
Theil anzuzuͤnden, der dem Loͤthrohre am naͤchsten ist, und ein
Stuͤk Talg oder Schweinfett auf einer Gabel in die Flamme zu halten, damit es
schmilzt, und auf die Vorderseite des Dochtes herabtraͤufelt um diesen zu
speisen, bis der Talg in der Lampe genug geflossen ist, um aufsteigen und die Flamme
unterhalten zu koͤnnen: auf diese Weise wird der Docht vor dem Verkohlen
gesichert. Wenn er jedoch erneuert werden muß, zieht man ihn, sobald der Talg
geschmolzen ist, mit einem Zaͤngelchen empor, und schneidet die verkohlten
Theile mit einer Schere weg, indem man sie der Laͤnge nach zwischen die
Blaͤtter derselben bringt, und nur dasjenige wegnimmt, was leicht weggeht. Da
der Docht dadurch zum Theile geschlossen wird, so muß er wieder geoͤffnet und
geebnet werden, was am bequemsten mit dem gebogenen Drahte, Fig. 4., geschieht. Die
gewoͤhnlichen Glasblaser brauchen noch staͤrkere Dochte; diese fressen
aber mehr Talg und sind ganz unnoͤthig.
Es ist gut einen Streifen geoͤhlten Tastet uͤber das untere Ende des
Blaserohres C zu binden, um das Aufsteigen von Wasser zu
hindern, das sonst leicht Statt haben kann.
Wenn Juweliere diese Maschine zum Loͤthen brauchen, so ist noch ein
Glasroͤhrchen, wie Fig. 6., nochwendig,
dessen Spize aber abwaͤrts, statt aufwaͤrts gebogen seyn muß.
Das Wasser bleibt in dieser Maschine, wenn sie aus verzinntem verzinntem Kupfer ist, Jahre
lang frisch, und braucht nicht erneut zu werden. Es bildet sich jedoch ein
schoͤnes Zinn-Oxid in demselben, das man zum Poliren des Goldes,
Silbers, Spiegelglases etc. sehr gut benuͤzen kann.
Tafeln