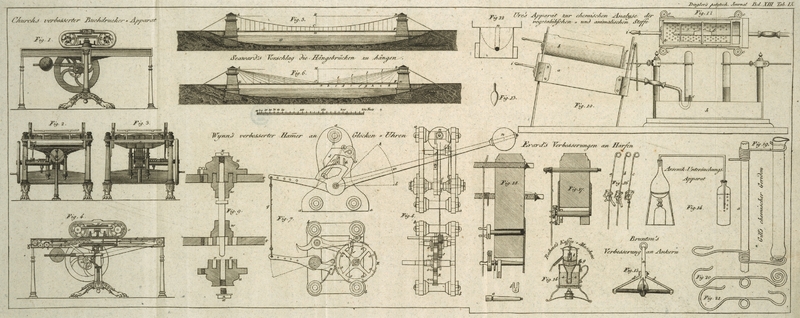| Titel: | Erfindung einer neuen Triebmaschine, worauf Georg Eman. Harper und Benj. Baylis, Mechaniker, beide zu Weedon in Northamptonshire, den 18. März 1823 sich ein Patent ertheilen ließen. |
| Fundstelle: | Band 13, Jahrgang 1824, Nr. XC. LXXXIX. , S. 449 |
| Download: | XML |
XC.
LXXXIX.
Erfindung einer neuen Triebmaschine, worauf
Georg Eman. Harper
und Benj. Baylis,
Mechaniker, beide zu Weedon in Northamptonshire, den 18. März 1823 sich ein Patent ertheilen ließen.
Aus dem London Journal of Arts and Sciences. Februar
1824. S. 62.
Mit Abbildungen auf Tab.
IX.
Harper's und Baylis's neue Triebmaschine.
Dieses Patent beruht auf dem alten falschen Grundsaze, daß ein
oberschlaͤchtiges Wasserrad, wenn es in Gang gebracht wird, Pumpen zu treiben
im Stande ist, welche nicht nur eine hinlaͤngliche Menge Wassers heben
koͤnnen, um das Rad in Thaͤtigkeit zu erhalten, sondern demselben noch
einen hinlaͤnglichen Ueberfluß an Kraft zu ertheilen, um andere Maschinen in
Thaͤtigkeit
zu sezen. Die Erfinder, die wahrscheinlich die bisherigen Maͤngel
aͤhnlicher Plaͤne einsahen, schlagen eine Verstaͤrkung durch
ein Hebelwerk vor, wodurch folglich auch die Kraft der Pumpen mittelst einer
besonderen schuͤttelnden oder schwingenden Bewegung des Stuͤzpunctes
desselben verstaͤrkt werden kann.
Taf. IV. Fig.
6. zeigt die Einrichtung dieser Maschine im Allgemeinen, welche aus mehreren
Sternraͤdern, Triebstoͤken, Hebeln, Flugraͤdern,
Verbindungs-Stangen und Pumpen besteht, wie auch die Art, nach welcher
dieselben durch Umdrehung eines Schoͤpfrades die verlangte mechanische Kraft
hervorbringen. a, ist ein Wasserbehaͤlter von
ungefaͤhr drei Tonnen Inhaltes, einer Menge die nothwendig ist, sobald der
Durchmesser des Schoͤpfrades 20 Fuß betraͤgt. bb, sind zwei Pumpen, deren Stangen, cc, mittelst des oben beschriebenen Mechanismus
bewegt werden. d, ist eine Cisterne zur Aufnahme des
Wassers aus der Pumpe bestimmt, welches durch die kleinen Seitenroͤhren, ee, ablaͤuft. Aus dieser Cisterne
laͤuft das Wasser aus einer am Grunde derselben befindlichen Klappe auf den
Umfang des Schoͤpfrades.
Um diese Maschine in Bewegung zu sezen, muß zuerst der Behaͤlter, a, und die obere Cisterne, d, mit Wasser gefuͤllt werden, und, wenn alles in Bereitschaft ist,
auch die Pumpe. Oeffnet man die Klappe im Grunde der Cisterne d, so fließt das Wasser in die Eimer des Schoͤpfrades auf der
niedersteigenden Seite desselben, und das auf diese Weise auf dieser Seite erhaltene
Uebergewicht des Rades wird dasselbe niedersinken machen, nach der bekannten Theorie
der Schoͤpfraͤder. An der Spindel dieses großen Rades ist ein Zahnrad
f befestigt, welches einen Triebstok, g, treibt; an der Achse dieses Triebstokes ist ein
anderes Zahnrad, h, angebracht, welches in zwei
Triebstoͤke, i, und k, auf den Spindeln der zwei Flugraͤder, l,
und m, eingreift.
Auf diese Weise werden die beiden Flugraͤder mit großer Schnelligkeit
umgetrieben, und bringen Regelmaͤßigkeit in den Gang der Maschine. nn, sind zwei Kehrstangen, wovon die eine mittelst
eines Gelenkes mit dem Flugrade, l, die andere mit dem
Flugrade, m, in Verbindung steht. Die unteren Enden dieser Kehrstangen
stehen mit den Hebeln, oo, in
Gelenk-Verbindung, die sich auf den Stuͤzstiften oder
Stuͤzzapfen, pp, schwingen. An den
entgegengesezten Enden dieser Hebel sind die beiden Hebestangen, qq, jeder mittelst eines Gelenkes angebracht, und
mit ihren oberen Enden gleichfalls mittelst eines Gelenkes mit dem obersten Hebel,
r, verbunden; so daß, durch die Umdrehung des großen
Wasserrades, alle diese Hebel in Bewegung gesezt werden.
Um einen hinlaͤnglichen Zug an der Pumpenstange hervorzubringen, ist es
noͤthig, daß der Hebel, r, nicht bloß traversirt,
sondern sich auch schwingt. Dieß geschieht durch Befestigung des Hebels an der
Walze, s, und dadurch, daß man diese Walze uͤber
ein gekruͤmmtes Lager, t, traversiren
laͤßt. An den Pumpenstangen, cc, sind die
Ketten, uu, befestigt, welche uͤber die
Gegenreibungs-Rollen, ww, und uͤber
die Walze, s, laufen, an welcher ihre Enden
beschraͤnkt sind. Ein Theil der Walze, v, und des
Lagers, t, ist mit Zaͤhnen versehen, damit die
Walze nicht abgleiten kann: ihre Wirkung wird von den Seitenarmen, v, die an ihrer Achse angebracht sind, geleitet. So
werden, durch die Wirkung des Hebels, r, der, wie oben
gesagt, durch die Flugraͤder bewegt wird, die Pumpenstangen abwechselnd
gehoben, und wenn die Schwere der Stangen nicht hinreicht sie wieder hinabzubringen,
so wird der Hebel, der auf ihren kruͤkenfoͤrmigen Kopf
schlaͤgt, sie niederdruͤken.
Tafeln