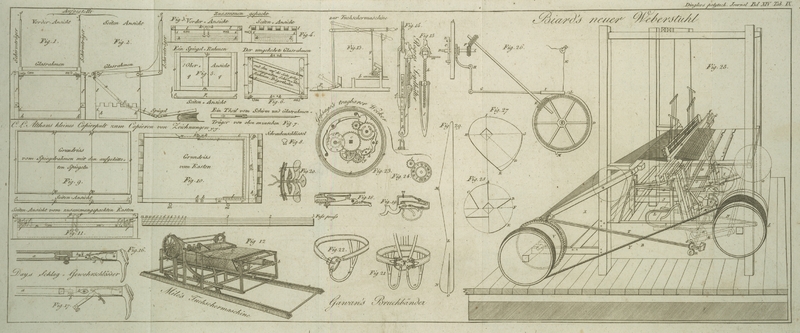| Titel: | Beschreibung des C. L. Althans kleinen transportablen Copierpultes zum schnellen Copieren von Zeichnungen, welches sich in einen kleinen Raum zusammen legen läßt, also auch auf Reisen brauchbar und oft sehr nüzlich ist. |
| Fundstelle: | Band 14, Jahrgang 1824, Nr. XCII., S. 392 |
| Download: | XML |
XCII.
Beschreibung des C. L. Althans kleinen transportablen
Copierpultes zum schnellen Copieren von Zeichnungen, welches sich in einen kleinen Raum
zusammen legen läßt, also auch auf Reisen brauchbar und oft sehr nüzlich
ist.
Mit Abbildungen auf Tab.
IX.
Althan's transportables Copierpult zum schnellen Copieren von
Zeichnungen.
Meinem, in der Beschreibung eines großen stehenden
Copierpultes, vom 7ten vorigen Monats gegebenen Versprechen gemaͤß, gebe ich
hier die Zeichnung und Beschreibung von einem kleinen transportablen Copierpulte,
welches sich in einen kleinen Raum zusammen legen laͤßt und in Betreff der
Wirkung des Lichtes, bei der Probe, zu meiner vollkommenen Zufriedenheit ausgefallen
ist.
Die Figuren 1
und 2 auf Tab.
IX. zeigen das kleine Copierpult zum Gebrauche aufgestellt und die Figuren 3 und 4 dasselbe
zusammengepakt.
Fig. 5 ist
einer von den 3 Spiegelrahmen a, b, c (Fig. 2) jedoch ohne
aufgekittete Spiegel dargestellt, welcher spaͤter noch naͤher
beschrieben wird. Es ist zu bemerken, daß die Vorderansicht in Fig. 1 so dargestellt ist,
als waͤren die Spiegel noch nicht eingehangen. Fig. 6 zeigt den
Glasrahmen von unten angesehen mit den auf die Seite in denselben eingelegten
Theilen des Schirmtraͤgers, wovon ein Theil desselben in Fig. 7 von oben anzusehen
ist. Fig. 3
ist der zugehoͤrige Schraubenschluͤssel. Zwei aͤhnliche
Schrauben, wie e zum Halten des Schirmtraͤgers
halten bei ff den untern Theil vom Glasrahmen,
welcher mit dem obern Theile auf den eben erwaͤhnten angeschraubten
Hoͤlzern des Schirmtraͤgers ruht.
Die ganze Vorrichtung stellt man zum Gebrauche auf einen Tisch, so nahe vor ein
Fenster, als es das Ende des Spiegels c erlaubt, so, daß
das Licht durch's Fenster in die Spiegel faͤllt. Die drei Spiegel werden etwa
im gezeichneten Bogen abc aufgestellt, und durch
ein untergelegtes Buch oder eine andere Unterlage gehalten. Das durch's Fenster
fallende Licht faͤllt theils unmittelbar von jedem Spiegel, theils von einem
Spiegel zum andern, und alles zusammen concentrirt unter die Glastafel des
Glasrahmens, wodurch die aufgelegte zu kopierende Zeichnung von unten erleuchtet
wird. Vom Spiegel o faͤllt wenig Licht
unmittelbar unter die Glastafel und der eigentliche Zwek desselben ist, das von oben
herabfallende hellste Licht noch in die andern Spiegel zu werfen, und die
Erleuchtung unter der Glastafel zu vermehren. Dafuͤr ist jedoch nicht immer
die gezeichnete Lage des Spiegels c die beste,
besonders, wenn die Fenster hoch sind, man nahe vor's Fenster kommen kann, und viel
mehr Licht von oben als in horizontaler Richtung in's Fenster kommen kann, wie es in
engen Strassen etc. oft der Fall ist; fuͤr solche Faͤlle, ja selbst
bei ganz freiem Horizonte vor dem Fenster, wenn der Himmel unten am Horizonte stark
bewoͤlkt und oben hell ist, macht eine durch staͤrkere Unterlage
bewirkte geneigtere Lage des Spiegels c einen bessern
Effect unter der Glastafel als diese gezeichnete.
Die beste Lage dieses Spiegels laͤßt sich fuͤr jeden Fall sehr leicht
durch Versuche ausmitteln, wenn man nur den erwaͤhnten Zwek des Spiegels c dabei beruͤcksichtigt.
Damit das Licht uͤber dem Glasrahmen nicht zu sehr auf das fuͤr die
Copie bestimmte und auf die Zeichnung gelegte Papier falle und die durchscheinende
Zeichnung undeutlich mache ist bekanntlich ein leichter Vorhang oder Schirm
noͤthig, wozu ein großer Bogen Papier etwa von blauer oder einer andern
dunkeln Farbe dienen kann, welcher mit zwei Zipfeln auf die Spizen g des Schirmtraͤgers (Fig. 1 und 2) gehaͤngt
wird.
Was uͤbrigens noch vom Copieren selbst in der Beschreibung des großen
stehenden Copierpultes gesagt worden, gilt auch hier, wobei ich noch bemerke, daß
bei der Construction dieses kleinen Copierpultes keine Ruͤksicht auf das
Aufspannen des Papiers genommen ist, weil die Erfahrungen immer mehr lehren, daß man
sich auf Reisen gewiß nicht mit dem Aufspannen abgeben wird, indem die auf dem
großen Copierpulte dazu vorhandenen Vorrichtungen in den meisten Faͤllen
unbenuzt bleiben. Dagegen erlaube ich mir aber zu erinnern, daß man das zum Zeichnen
bestimmte Papier nicht aufgerollt, sondern etwa zwischen 2 Brettern, gerade gestrekt
aufbewahren muß, damit sich dasselbe nicht widerspenstig von der zu copierenden
Zeichnung aufhebe, und das gute Durchscheinen der unterliegenden Zeichnung
hindere.
Bei troknem Wetter legt man das aufgerollte Papier zuvor einige Stunden in einen
Keller oder an einen andern etwas feuchten Ort, und laͤßt es dann zwischen 2
geraden und beschwerten Brettern wieder austroknen. Zum Gebrauche auf Reisen
wuͤrde ich vom staͤrksten Briefpapier nehmen, welches aber noch in
ganzen Bogen seyn muß. Jeder Briefbogen ist bekanntlich nur die Haͤlfte des
urspruͤnglichen Bogens. Fuͤr solche einfach zusammen gebogene ganze
Papiergroͤße ist der innere Raum dieses Kastens gerade groß genug, so daß
unten in denselben eine, 1/2 Zoll hohe, Lage Papier eingelegt werden kann. Auf diese
werden die z zusammen zu legenden Spiegel a, b, c, wovon jeder Rahmen einen halben Zoll
Hoͤhe einnimmt, gelegt, welche also, inclus.
Papier 2 Zoll Hoͤhe ausmachen, und den untern Kastenraum hh (Fig. 1, 2, 3 und 4) ganz
ausfuͤllen.
Der Glasrahmen, welcher zum kleinsten Durchmesser die ganze aͤußere Breite des
Kastens hat, paßt genau in den Raum ii (Fig. 1, 2, 3 und 4), wie er in
Fig. 3 und
4
dargestellt ist. Und die zwei Wangenstuͤke ll des aufgestellten Pultes (Fig. 1 und 2) lassen sich (wie Fig. 3 und 4), gegen
einander niederlegen, welche alsdann zugleich den Dekel des Kastens bilden.
Wie die Gelenke derselben beschaffen sind, ist in der Zeichnung deutlich zu sehen,
welche aber fleißig und gut gearbeitet werden muͤssen. Auch ist uͤber
diese beiden Dekelklappen (oder Wangenstuͤke) noch zu bemerken, daß die obern
Enden (der aufgestellten Wangenstuͤke nicht rechtwinklich, sondern etwas
weniges schiefwinklich zusammengefuͤgt werden muͤssen, wie Fig. 3 in
zusammengeklappter Lage zeigt; sonst laͤßt sich ein solcher gut und dicht
gearbeiteter Kasten nicht auf- oder zumachen – alsdann wird (nach Fig. 3) die
rechte Dekelklappe zuerst auf- und zulezt zugemacht.
Zum Verschließen des Kastens bedient man sich derselben 4 Schrauben, welche zum
Anschrauben des Glasrahmens bei f und des
Schirmtraͤgers bei e dienen; die des
Schirmtraͤgers muͤssen fuͤr denselben nur auf eine hinreichende
Laͤnge mit angeschnittenem Gewinde versehen seyn.
In der Vorderansicht Fig. 3 sind zwei der Schrauben kk
punctirt dargestellt. Sie werden am besten von gezogenem Messing verfertigt und die
Koͤpfe von geschlagenem Messing aufgeloͤthet (sie koͤnnen
uͤbrigens auch von Eisen seyn), und die eisernen Muttern werden von der
innern Seite in die Kastenwaͤnde eingelassen (versenkt). Auch werden
ebenfalls auf dieselben Schrauben genau passende andere eiserne Muttern in den
Glasrahmen und in die Theile des Schirmtraͤgers, zum Anschrauben derselben,
eingelassen, wie dieses in der Zeichnung durch punctirte Linien angegeben ist. Die
Schraubenkoͤpfe werden in das Holz versenkt, und unter denselben werden gut
eingeklemmte durchlochte Blechscheiben angebracht, auf welche die
Schraubenkoͤpfe sich drehen ohne das Holz tiefer auszureiben.
In Fig. 2 sieht
man die Schraubenkoͤpfe mit ihren Einschnitten, und ein passender
Schrauben-Schluͤssel, etwa in der Form wie Fig. 8, dient sowohl zum
Aufstellen als zum Verschließen des zusammen gelegten kleinen Copierpultes.
Ueber das Zusammenpaken desselben ist nun noch zu bemerken uͤbrig, daß die 2
Theile des Schirmtraͤgers, in den leeren Raum des Glasrahmens unter die
Glastafel mit eingepakt werden koͤnnen, wie dieses in Fig. 6 in herumgekehrter
Lage des Glasrahmens zu sehen ist. Sie muͤssen aber gut eingespannt werden,
damit sie ruhig liegen bleiben und die Glastafel nicht zerschlagen. Zu dem Ende sind
bei rr und rr in
den Theilen des
Schirmtraͤgers Fig. 6 kleine vorstehende
Zapfen befestigt, welche an den Stellen in 4 Loͤcher des Glasrahmens passen,
und die Spizen ss werden seitwaͤrts in
Einschnitte versenkt, welche daselbst so angebracht seyn muͤssen, daß sich
die Enden der Schirmtraͤgerstangen t und t mit dem Einlegen der Spizen in die Einschnitte s und s auch etwas gegen die
Hoͤlzer spannen.
Außer dem schon Gesagten duͤrfte uͤber die Einrichtung der einzelnen
Theile noch Folgendes zu erinnern seyn:
1) Der Kasten als Gestell mit den Dekelklappen als Wangenstuͤke fuͤr's
Gestell, ist so zusammengesezt, daß derselbe im Ganzen zusammen troknen kann, ohne
zu reißen. Es laufen naͤmlich im Boden, Dekel und den langen Seiten des
Kastens die Holzfasern alle den langen Weg, aber in den zwei Kopfstuͤken des
Kastens laufe sie aufrecht, welches ein gemeinschaftliches Zusammentroknen des
ganzen Kastens ungehindert zulaͤßt. Auch der Dekelgelenke halber ist es
nothwendig, daß die Holzfasern der Kopfstuͤke aufrecht gerichtet sind.
Fuͤr gute Ausfuͤhrung duͤrfte es wohl nicht unnuͤz seyn,
noch folgende Bemerkungen beizufuͤgen:
Man nehme zu den zwei Kopfstuͤken und den zwei Dekelklappen (entweder aus
einer oder zwei Brettbreiten) die vier Theile der Reihe nach, von einer
Bretterlaͤnge- und von einer Holzart (z.B. Nußbaum), welche nicht
leicht reißt und fest ist. Auch muß das Brett dazu gut ausgewaͤhlt seyn, daß
es nicht zu nahe vom Kernholze weg, also nicht leicht zum Verwerfen (Verziehen)
geneigt ist.
Aus der einen unbearbeiteten Bretterlaͤnge schneidet man die Stuͤke der
Reihe nach, mit etwas Zugabe fuͤr die Bearbeitung, so ab, daß dieselben
getrennten Enden, beim geschlossenen fertigen Kasten, wieder gegen einander kommen.
Ferner, werden zuerst die Loͤcher fuͤr die durchzustekenden runden
Stangen (von dikem Meßing- oder Eisendraht) der Dekelklappengelenke
durchbohrt – indem dieses zulezt nicht so leicht genau genug zu treffen ist;
dann werden die Brettstuͤke alle genau von gleicher Dike gehobelt, wobei die
Loͤcher genau in der Mitte zu halten sind; hierauf werden uͤber den
Brettstaͤchen hin, genau uͤber der Loͤcher-Mitte, Linien
gerissen, nach welchen die Kanten die Brettstuͤke genau im rechten Winkel
abgerichtet werden,
damit die Loͤcher genau rechtwinklich und in der
Brettstaͤrken-Mitte durchgehen; und zulezt winkelt man genau
uͤber der Loͤcher-Mitte um die Brettstuͤke herum, um von
dieser Mittel-Linie der Gelenke aus die Gelenke selbst auftragen und
ausarbeiten zu koͤnnen. Ist man genoͤthigt, die Dekelklappenbreite aus
zwei Brettbreiten zusammen zu leimen, so schneidet man zuerst aus zwei ganzen
Brettlaͤngen von jeder, wie oben, die einzelnen Stuͤke der Reihe nach
ab, darauf bohrt man, auf dieselbe Weise wie oben, die Loͤcher durch, hobelt
vorlaͤufig die Bretter auf beiden Seiten etwas ab, zieht uͤber den
Loͤchern die Mittel-Linien, nach welchen an jedem Stuͤke die
eine Kante zum Zusammenleimen derselben zuerst im rechten Winkel mit der gedachten
Mittel-Linie abgerichtet werden, hierauf stekt man aber beim Zusammenleimen
die passenden Gelenk-Stangen durch die Loͤcher, damit dieselben genau
in gerader Linie gegen einander kommen. Beim weitern Vollenden dieser Arbeit
verfaͤhrt man, wie oben.
2) Der Glasrahmen ist von ganz einfachen vierkantigen Leisten zusammengesezt, in
welchen eine Glastafel genau mit der Oberflaͤche gleich in einen kleinen salz
eingekittet ist. An der einen (untern) langen Seite dieses Glasrahmens sind die mehr
erwaͤhnten Schraubenmuttern (uu
Fig. 6) von
unten eingelassen, und von den beiden kuͤrzen Seiten her die noͤthigen
Schraubenloͤcher, nach diesen Muttern hin, eingebohrt.
Zum Anhaͤngen der Spiegel sind bei mm (Fig. 1, 2, 3, 4 und 6) zwei
meßingene Knoͤpfchen eingeschraubt, an welche die zwei Lederlaͤppchen
mn
Fig. 2
angehaͤngt (angeknoͤpft) werden. Außerdem hat der Glasrahmen noch
vier, von oben herab durchbohrte Loͤcher, durch welche sich die Schrauben zum
Verschließen des Kastens, wovon zwei bei kk in
Fig. 3 und
alle vier in Fig.
6 bei kkkk zu sehen sind, steken
lassen.
3) Die Spiegelrahmen a, b, c
Fig. 2 werden
zum Anknoͤpfen mit den oben erwaͤhnten zwei Leberlaͤppchen mn versehen, in welchen ein Knopfloch befindlich
ist, und welche mittelst kleinen Holzschraͤubchen und kleinen auf's Leder
gelegten meßingenen Planchen an den obersten Nahmen bei n gut befestiget sind. Die Spiegelrahmen sind mit den langen Seiten gegen einander mit
solchen, jedoch gut gearbeiteten, kleinen Gelenkbaͤndern (sogenannten
Nußbaͤndern) an den Eken verbunden, wie sie bei den zusammen zu legenden
Spieltischen angewendet werden. Kleine, gut angebrachte, aber sehr fein und passend
gearbeitete Charnierbaͤnder zwischen a und b auf der Ruͤkwandflaͤche eingelassen und
angeschraubt; desgleichen zwischen b und c gegen die schmalen Stoßflaͤchen
zwekmaͤßig eingelassen und angeschraubt- und zwar so, daß die Achse
der Charnierbaͤnder hier zwischen b und c
Fig. 2 in die
gehoͤrige Hohe, mit der obern Kante der Verstaͤrkungen opo
Fig. 5 gleich,
zu liegen kommt – duͤrfte noch wohl besser seyn, so bald man so kleine
und gut passende Charnierbaͤnder nebst Schraubchen bekommen kann.
Die zwei untern Spiegel b und c legen sich nach der eingebogenen obern Spielseite, mit den
Spiegelflaͤchen gegen einander, zusammen. Nach derselben Seite hin kann aber
der dritte Spiegel nicht mehr hinklappen. Es muͤssen daher die
Gelenkbaͤnder auf die umgekehrte Weise an den Rahmen a und b angebracht werden, damit dieselben mit
den Ruͤkwaͤnden gegen einander gelegt werden koͤnnen.
Von beiden Stoßkanten der Spiegelrahmen a und b muß, sowohl an den Rahmstuͤken als an den
Gelenkbaͤndern, so viel, vom rechten Winkel abweichend, weggefeilt werden,
daß sich die Gelenke so weit uͤberlegen lassen, daß der Winkel axb bis zum Winkel eines Achtels gebracht werden
kann. Es kommen, der Einrichtung nach, die drei Spiegel in zusammengeklappter Lage
so auf einander, daß a oben und c unten kommt, wobei die Lederlaͤppchen mn in aufrecht gekehrter Stellung oben bleiben und
zugleich zum Ausheben der Spiegel aus dem Kasten dienen koͤnnten, welches
aber zuviel Spielraum zwischen den Spiegel und Kastenwaͤnden und besondere
Vorsicht beim Ausheben und Einlegen der Spiegel erfordern wuͤrde, um
dieselben nicht zu zerbrechen. Daher ist es bequemer zum Ein- und Ausbringen
der Spiegel ein starkes breites Band mitten unter den zusammen geklappten Spiegeln
herzulegen, und mit diesem dieselben in den Kasten einzusenken und wieder
auszuheben.
Die Enden dieses Bandes legt man alsdann beim Verschließen des Kastens, eben
ausgestrekt uͤber die oberste Spiegelflaͤche.
Fig. 5 ist,
wie schon gesagt, ein Spiegelrahmen ohne Spiegel dargestellt. Die Seitenansicht
zeigt deutlich, wie der ganze Rahmen zwischen den beiden vorstehenden Theilen o, o schwaͤcher als einen halben Zoll ist, damit
die auf jedem Rahmen dicht neben einander aufgekitteten 2 Spiegel o und o senkrecht liegen,
und sich beim Einpaken nicht zerdruͤken koͤnnen, indem die
vorstehenden Theile auf einander zu ruhen kommen.
Damit sich die zusammen geklappten Spiegelrahmen beim Anfassen und Einpaken nicht
biegen, und dadurch die Spiegel nicht zerbrochen werden, sind bei pp zwei eben so hohe – Kloͤzchen
aufgeleimt, welche beim Zusammenlegen auf die des andern Rahmens zu ruhen kommen,
und das Biegen der Spiegel rahmen verhindern. Jeder Spiegelrahme., ist, wie Fig. 5 zeigt
zusammengezapft und mit in salzen von unten eingeleimten (etwa 1/8 Zoll)
duͤnnen Fuͤllungen (oder Ruͤkwaͤnden) qq versehen.
In Betreff der Spiegel selbst ist zu bemerken, daß die gewaͤhlte einzelne
Spiegelgroͤße, deren 2 auf einen solchen Rahmen hier gehen, fuͤr
diesen Zwek die beste und wohlfeilste seyn duͤrfte, welche man auch sehr
haͤufig im Handel antrifft. Sie sind zu haben bei Friedr. Schaller in
Fuͤrth bei Nuͤrnberg. Von den langen Seiten des Rahmens muͤssen
sie ein wenig zuruͤkstehen, damit die Spiegel durch das Aneinanderstoßen der
Rahmen, nicht zerbrochen werden. Auch muͤssen an jedem Spiegel die zwei Eken
etwas abgeschnitten werden, welche mit den kleinen Stuͤzkloͤzchen pp in Beruͤhrung kommen. Uebrigens wilden
die Spiegel, ebenfalls wie beim großen Copierpulte mit einer durch
Terpenthinoͤhl weich gemachten Fensterkitte auf den Rahmen befestigt.
Anhang. Beschreibung eines, aus der Einrichtung des
großen stehenden und kleinen transportablen Copierpultes hervorgegangenen großen
transportablen Copierpultes, welches die Bequemlichkeiten zum Aufspannen des Papiers
etc. vom großen stehenden und die des Zusammenlegens etc. des kleinen transportablen
besizt.
Dieses große transportable Copierpult ist in der
Haupteinrichtung dem kleinen ganz aͤhnlich, daher gilt auch hier alles Das,
was uͤber jenes gesagt worden ist, mit einigen wenigen Abweichungen, welche
hier erklaͤrt und durch die Fig. 9, 10 und 11 dargestellt werden
sollen.
Fig. 9 ist ein
Spiegelrahmen mit 6 ausgekitteten Spiegeln dargestellt. Er wird aus 2 langen Leisten
2 Kopf- und 2 Querleisten und 3 zwischen Kopf- und Querleisten
eingezapften Mittel-Leisten zusammen gezapft, zwischen welchen duͤnne
Fuͤllungen oder Ruͤkwaͤnde in salze eingeleimt werden. Auch
sind hier, wie bei denen des kleinen Pultes, die Verstaͤrkungen oopppp zu demselben Zweke angebracht. Es werden
beim Aufstellen des Pultes die Spiegel eben so an zwei meßingenen Knopfchen mm aufgehaͤngt, wie beim kleinen Pulte. Es
sind hier ebenfalls 3 dieser Spiegelrahmen (also zusammen 18 Spiegel zur
Beleuchtung) welche auf dieselbe Weise und unter denselben Verhaͤltnissen
zusammen verbunden und angebracht werden. Es duͤrfte hierbei wohl besser
seyn, keine sogenannten Nußbaͤnder, sondern fuͤr jedes Spiegelgelenk 3
Charnierbaͤnder, aus die fruͤher (in der Beschreibung des kleinen
Pultes) empfohlene Weise anzubringen, wodurch diese langen Spiegelrahmen sicherer
gehalten werden.
Der Kasten Fig.
10 und 11 ist gerade so eingerichtet, als der zum kleinen Pulte, und ist in der
gehoͤrigen Groͤße und mit den noͤthigen Holzstuͤken in
der Zeichnung angegeben. Es ist nur dabei zu bemerken, daß hier unten im Kasten kein
Papierraum uͤbrig, sondern nur fuͤr die 3 zusammengelegten Spiegel ein Raum von 2 5/8 Zoll
preußisch undundr heinlaͤndisch Maaß Hoͤhe und der Boden 5/8 Zoll dik ist; daß
ferner hier der Raum zwischen Spiegel und Dekel fuͤr drei in und auf einander
geschlossene Rahmen von 2 1/2 Zoll Hoͤhe und der Dekel 1 1/4 Zoll stark oder
hoch ist; also die ganze Hoͤhe des geschlossenen Kastens 7 Zoll
betraͤgt.
Die drei in und auf einander schließenden Rahmen sind genau in denselben
Holzstaͤrken wie die beim stehenden Copierpulte und fast ganz auf dieselbe
Weise verfertigt, und sind nur in der Breite und in den Kopfstuͤken des
Gestellrahmens verschieden, wie die Zeichnung Fig. 10 und 11 angibt. Es
ist nn
Fig. 10 und
11 der
Gestellrahmen mit einer salz an der obern innern Kante, in welche der bekannte
Glasrahmen ll (in Fig. 11 nur punctirt
angegeben) gerade so, wie er beim stehenden Copierpulte beschrieben, eingelegt ist.
Dieser wird umgeben mit dem ebenfalls bekannten Papierrahmen ee.
Am kleinen Copierpulte wird bekanntlich der Glasrahmen an den 2 untern Eken
unmittelbar zwischen die Wangenstuͤke des Gestells mit 2 Schrauben befestigt,
und mit den obern Eken auf die Hoͤlzer des Schirm- und
Glasrahmen-Traͤgers gelegt. Dasselbe geschieht hier auf eine
aͤhnliche Weise mit dem Gestellrahmen. Damit man den Glasrahmen nach Belieben
mit einem andern mit kleinerer Glastafel (wie er beim stehenden Pulte beschrieben
ist) austauschen kann. Auch ist hier noch Ruͤksicht genommen auf
groͤßere Papierrahmen, wie ee ist, welche
sich nach Bedarf mit der zu kopierenden Zeichnung uͤber der Glastafel
verschieben lassen und auf Leisten ruhen, die an der obern und untern Kante des
geneigten Gestellrahmens angeschraubt werden, und in hinreichender Laͤnge an
beiden Seiten des Copierpultes vorstehen, wie dieses beim stehenden Pulte
umstaͤndlicher beschrieben ist. Zum Anschrauben dieser Leisten dienen die bei
f und f vorn (eben so
hinten) von unten eingelassenen Muttern, in welche die Schrauben gg (deren noch 2 an der hintern Seite fuͤr
die Hintere Leisten dienend) passen muͤssen, und beim Verschließen des
Kastens in die eingelassenen Muttern kkkk
Fig. 10
eingeschraubt werden.
Zu dem Ende muͤssen die Muttern so weit von der aͤußern Rahmenkante
zuruͤk liegend eingelassen werden, daß die Schrauben um eine 5/4 Zoll starke
anzuschraubende Leistendike mit den Koͤpfen aus dem Gestellrahmen hervorstehen, um mit
denselben die zwei Lagerleisten von 5/4 Zoll Staͤrke im erforderlichen Falle
anschrauben zu koͤnnen. Zum Anschrauben des Gestellrahmens zwischen die
Wangenstuͤke des Gestells werden hier besondere, zwar aͤhnliche, aber
kuͤrzere Schrauben genommen, wofuͤr bis i
und i (Fig. 11) die eingebohrten
Loͤcher und die eingelassenen Muttern h und h punctirt angegeben sind.
Zwei noch etwas kuͤrzere aͤhnliche Schrauben werden noch zum
Anschrauben der Schirm- und Gestellrahmen-Traͤger nothwendig.
Diese Traͤger koͤnnen hier nicht wie im kleinen Pulte unter der
Glastafel im Rahmenraume eingepakt werden, weil unter dieser groͤßern
Glastafel die bekannten schmalen Unter, stuͤzungsleisten, eben so wie beim
stehenden Pulte, im Wege sind. Sie finden aber hier zu beiden Seiten neben dem
Papierrahmen einen zwekmaͤßigen Plaz.
Es ist in Fig.
10 einer von diesen Traͤgern dabc, und in Fig. 11 sind beide ab, bc in
eingepakter Lage abgebildet, d ist der Drehungspunct
einer Zunge dc mit Spize, welche sich um den Punct
d drehen, und gerade so aufstellen laͤßt, wie
der Schirmtraͤger des kleinen Pultes.
Bei b ist ein nach unten gekehrtes Zaͤpfchen in demselbendemseben befestigt, welches sich in eine im unterliegenden Gestellrahmen
befindliche Vertiefung einsenkt, und das Verschieben desselben verhindert. Auch
dient zugleich dieses Zaͤpfchen zum Einsteken in eine aͤhnliche
Vertiefung des Wangenstuͤks, an welches diese Leiste (Traͤger) zum
Tragen des Gestellrahmens etc. angeschraubt wird, damit sich dieser Traͤger
nicht drehen kann, und gleich seine gehoͤrige Neigung bekommt – (beim
kleinern Pulte ist diese Vorsorge nicht nochwendig).
Die punctirte, bei a
Fig. 10
eingelassene Schraubenmutter dient zum Anschrauben des Traͤgers. NB. Er wird so angeschraubt, daß die breitere Seite
neben der Mutter beim Anschrauben nach oben gekehrt werden muß, wodurch eine
Hinreichend geneigte Lage saͤmmtlicher Rahmen hervorgebracht wird.
Uebrigens wird alles Andere ganz deutlich werden, wenn man sich nur der beiden vorher
beschriebenen Einrichtungen vollstaͤndig erinnert.
Saynerhuͤtte den 4. Januar 1824.
C. L. A.
Tafeln