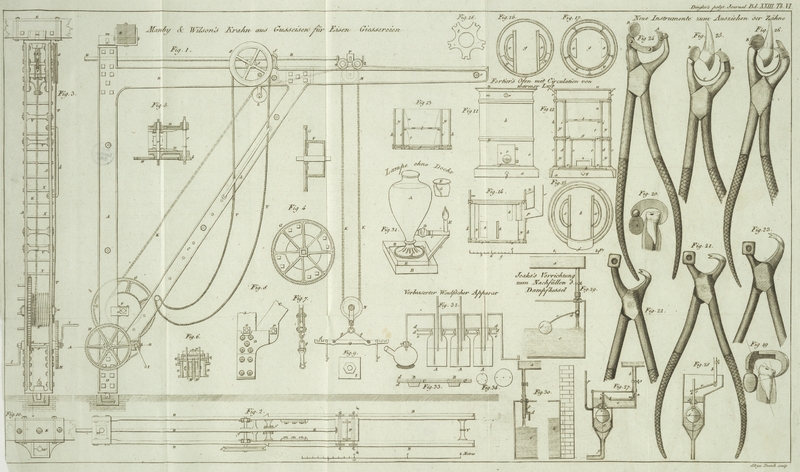| Titel: | Beschreibung eines Krahnes aus Gußeisen in der Werkstätte der HHrn. Manby und Wilson zu Charenton. |
| Fundstelle: | Band 23, Jahrgang 1827, Nr. LXVI., S. 297 |
| Download: | XML |
LXVI.
Beschreibung eines Krahnes aus Gußeisen in der
Werkstaͤtte der HHrn. Manby und Wilson zu Charenton.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement. N. 268. October. 1826. S. 295.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Manby's und Wilson's, Beschreibung eines Krahnes aus
Gußeisen.
Die Krahne haben seit einiger Zeit bedeutende Verbesserungen
erhalten, deren Zwek vorzuͤglich ist: 1) denselben die moͤglich
groͤßte Staͤrke zu geben, und doch die Groͤße der
Stuͤke, aus welchen sie bestehen, zu vermindern. 2) zu machen, daß sie
weniger Raum einnehmen. 3) statt des Holzes Gußeisen anzuwenden, das, bei geringerem
Umfange, staͤrker und dauerhafter ist. 4) sie leichter anwendbar zu machen,
und den Mechanismus derselben so einzurichten, daß sie bei geringem Kraftaufwands
große Wirkung hervorbringen; 5) sie so einzurichten, daß sie in der moͤglich
kuͤrzesten Zeit die Last heben, und dieselbe auf jedem Puncte des Kreises
niederlassen, den sie beschreiben, wenn sie sich um ihre Achse drehen; 6) endlich
sie so zu bauen, daß sie wenig Kosten, und nicht viel Ausbesserung
beduͤrfen.
Die meisten englischen Krahne erfuͤllen diese Bedingungen. Wir haben im
Bulletin des Jahres 1819, S. 46. einen derselben zum Aus- und Einladen der
Guͤter auf Schiffen beschrieben. Gegenwaͤrtiger Krahn dient zum Heben
des Kessels, in welchem in dem Gußwerke der HHrn. Manby
und Wilson das Eisen, wie es aus dem Ofen kommt,
aufgefangen, und dann zu den Modeln gebracht wird. Was diesen Krahn auszeichnet,
ist, daß er nicht bloß die Last mittelst seines horizontalen Armes einen
vollkommenen Kreis beschreiben laͤßt, sondern daß dieselbe auch auf jedem
Puncte dieses Armes, naͤher oder ferner von der senkrechten Achse desselben,
angebracht werden kann.Eines aͤhnlichen Krahnes bedient man sich zu gleichem Zweke in der
beruͤhmten k. Eisengießerei zu Berlin. A. d. R.
Dieser Krahn aus Gußeisen ist auf Tab. VI. von
verschiedenen Seiten dargestellt. Er besteht aus zwei Baken, A, A, die die senkrechte sich drehende Achse bilden; aus einem
horizontalen Arme, B, der senkrecht auf der Achse steht,
und aus einem Strebebalken, C, der beide unter einander
verbindet und stuͤzt. Dieses ganze System dreht sich um einen Zapfen, i, in der Pfanne, l; der
obere Zapfen wird von einem Halsbande aufgenommen, welches an einem Querbalken, der
oben uͤber die Gießerei laͤuft, befestigt ist. Die Kette, K, an welcher der mit dem geschmolzenen Eisen
gefuͤllte Kessel haͤngt, rollt sich auf einer Trommel oder Winde, F, auf, in deren Oberflaͤche eine
spiralfoͤrmige Furche so eingeschnitten ist, daß die Kette sich in dieselbe
einlegen kann, ohne sich in ihren Windungen zu beruͤhren. Auf der Achse
dieser Trommel oder Winde ist ein großes Rad, G, mit 115
Zaͤhnen befestigt, in welches ein Triebstok, a,
von zehn Zaͤhnen eingreift, der auf der Achse, r,
eines anderen Rades, H, von 70 Zaͤhnen aufgezogen
ist. Dieses Rad wird von einem Triebstoke, b,
gefuͤhrt, der gleichfalls zehn Zaͤhne hat, und auf der Achse der
Kurbel, I, stekt. Eine zweite Kurbel findet sich auf der
anderen Seite der Achse des Triebstokes, a.
Die an dem Puncte, e, des Armes, B, befestigte Kette laͤuft zuerst uͤber eine Rolle des
Flaschenzuges, M, und steigt dann hinab zu einer Rolle,
N, an welcher der Kessel haͤngt;
laͤuft dann wieder hinauf zur zweiten Rolle des Flaschenzuges, M, und rollt sich endlich auf der Trommel auf,
gestuͤzt von der Laufrolle, L. Der Kessel
haͤngt mittelst zwei Haken, c, an einer
Querstange, O, die mit Einschnitten, d, versehen ist, um die Haken zu naͤhern oder zu
entfernen, nach den verschiedenen Durchmessern der Kessel.
Es ist offenbar, daß zwei Maͤnner an den Kurbeln, I,
I, die die Trommel oder Winde drehen, den Kessel ohne große Anstrengung
hebelt koͤnnen; sie koͤnnen aber nicht auch den Krahn zugleich drehen,
da keine Vorrichtung hierzu vorhanden ist. Die Arbeiter begnuͤgen sich den
Kessel zu ziehen, und bringen ihn so leicht zu den vom Ofen entferntesten Modeln. Um die
zunaͤchst stehenden Model zu fuͤllen, bedient man sich folgender
Vorrichtung.
Der Flaschenzug, M, wird an einem Wagen, P, mit vier Raͤdchen, Q,
Q, angehaͤngt, der in Furchen laͤngs dem Arme, B, laͤuft. An diesem Wagen ist ein langer
Zahnstok, R, befestigt, der in seinem Laufe durch eine
kleine Reibungsrolle, f, geleitet, und in staͤtem
Eingreifen erhalten wird. Dieser Zahnstok erhaͤlt seine Bewegung hin und her
durch einen Triebstok, g, von 15 Zahnen, der auf der
Achse der Rolle, S, aufgezogen ist, um welche die Schnur
ohne Ende, T, laͤuft. Wenn der Model nicht
unmittelbar unter dem Kessel ist, dreht man die Rolle, S, indem man die Schnur, T anzieht; der Triebstok,
g, macht dann den Zahnstok, und mit diesem zugleich
den Wagen, P, und den Kessel, vorwaͤrts oder
ruͤkwaͤrts laufen. Waͤhrend dieser Arbeit muͤssen die
beiden Maͤnner an der Winde bleiben, um die Kette im Verhaͤltnisse,
als der Wagen weit laufen muß, abzurollen oder aufzuwinden, so daß sie immer
gespannt bleibt, und den Kessel in derselben Hoͤhe erhaͤlt. Auf diese
Weise gießt man in kurzer Zeit eine Menge Stuͤke, deren Model auf
verschiedenen Puncten der Werkstaͤtte zerstreut stehen, ohne allen Verlust an
Material.
Dieser einfache, starke und zwekmaͤßige Krahn hebt sehr leicht 6000 Kilogramm,
nimmt wenig Raum ein, und braucht wenig Ausbesserung.
Beschreibung der Figuren.
Fig. 1. Aufriß
des Krahnes zu Charenton von der Seite.
Fig. 2.
Ansicht von oben.
Fig. 3. Aufriß
von hinten.
Fig. 4. Die
Trommel oder Winde mit ihrem Zahnrade von vorne und im Durchschnitte.
Fig. 5.
Durchschnitt des Triebstokes der Kurbel und des kleinen eingreifenden Rades nach der
Linie, A, B, in Fig. 1.
Fig. 6.
Durchschnitt des Wagens, der den Flaschenzug fuͤhrt, nach der Linie, E, F, Fig. 2.
Fig. 7.
Seiten-Ansicht der Rolle, an welcher die Aufhaͤnge-Stange des
Kessels eingehaͤngt wird.
Fig. 8.
Durchschnitt des unteren Theiles des Krahnes, der die Achsen der Triebstoͤke
und Kurbeln aufnimmt, nach der Linie, C, D, in Fig. 3.
Fig. 9.
Grundriß des Zapfenlagers.
Fig. 10.
Stuͤk des Querbalkens, welches den oberen Zapfen der sich drehenden Achse des
Krahnes aufnimmt.
Dieselben Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstaͤnde.
A, A, Baken aus Gußeisen, die die senkrechte Achse
bilden; B, horizontaler Arm des Krahnes; C, Strebebalken zur Befestigung von, A, und, B: D, unterer Theil
der senkrechten Achse, der den Haspel und das Getriebe fuͤhrt; E, Querbalken, der den oberen Zapfen aufnimmt; F, Winde; G, eingreifendes
Rad auf der Winde; H, ein anderes Zahnrad auf der Achse
einer der Kurbeln; I, I, Kurbeln; K, Kette; L, Laufrolle, uͤber welche
die Kette laͤuft; M, Flaschenzug; N, einfache Rolle, an welcher die
Aufhaͤnge-Stange, O, eingehaͤngt
wird; P, Wagen, der den Flaschenzug, M, fuͤhrt; Q, Q,
Raͤderchen dieses Wagens, der in Furchen oben auf dem Arme, B, laͤuft; R,
Zahnstok; S, Rolle, die den Zahnstok hin und her bewegt;
T, Schnur, die uͤber die Rolle, S, laͤuft, V,
Stuͤke, die die Baken des Krahnes verbinden; X,
X, Stufen, durch die man auf den Krahn steigen kann.
a, Triebstok, der in das große Rad, G, eingreift; b, ein anderer
Triebstok auf der Achse der Kurbel, I, der das Rad, H, fuͤhrt; c, Haken
zum Aufhaͤngen des Kessels; d, Einschnitte auf
der Aufhaͤnge-Stange, O: e, Punct, an
welchem die Kette, K, befestigt ist; f, kleine Reibungs-Rolle, die den Zahnstok
fuͤhrt, und denselben immer im Eingriffe mit dem Triebstoke, g, erhaͤlt; h,
Stange, unter welcher die Schnur, T, durchlaͤuft;
I, Zapfenlager; m,
Halsband des oberen Zapfens; n, Lager der Achse der
Winde; o, Lager der Achse des Rades, H: p, Lager der Achse der Kurbel; q, q, lang gezogene Ringe, die die Aufhaͤnge-Stange tragen;
r, Achse des Rades, H:
s, Achse des Triebstokes, b.
Tafeln