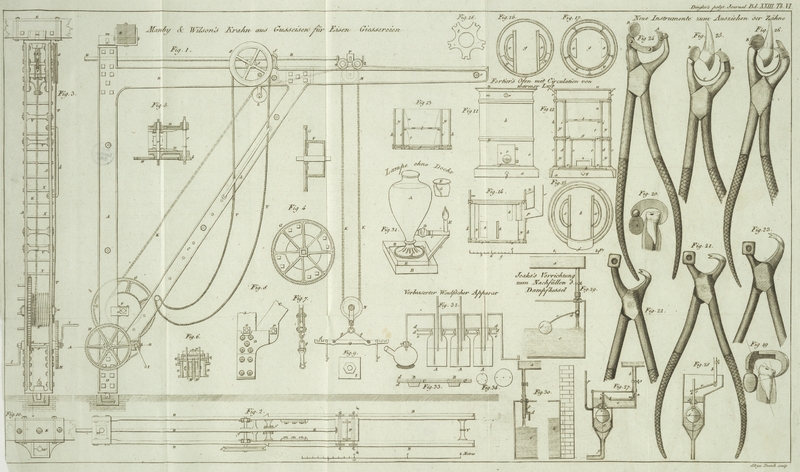| Titel: | Hrn. Bouriat's Bericht, im Namen des Ausschusses für ökonomische Künste, über einen Ofen aus Gußeisen mit circulirender warmer Luft, von Hrn. Fortier, Mechaniker zu Paris, rue de la Pépinière, N. 23, zu Paris. |
| Fundstelle: | Band 23, Jahrgang 1827, Nr. LXVII., S. 301 |
| Download: | XML |
LXVII.
Hrn. Bouriat's Bericht, im Namen des Ausschusses
fuͤr oͤkonomische Kuͤnste, uͤber einen Ofen aus Gußeisen mit
circulirender warmer Luft, von Hrn. Fortier, Mechaniker zu
Paris, rue de la
Pépinière, N. 23, zu Paris.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement. October. 1826 S. 305.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Bouriat's, Bericht uͤber einen Ofen aus Gußeisen mit
circulirender warmer Luft.
Man sollte glauben, daß die hundertfaͤltigen Formen,
die man seit zwanzig Jahren den Oefen gegeben hat, alle Kunst des Ofenbaues
erschoͤpft haͤtten. Hr. Fortier lieferte
indessen noch einen neuen Ofen, der Brennmaterial spart, schnell heizt, und
trefflich kocht.
Tab. VI. stellt diesen Ofen von verschiedenen Seiten
dar. Er ist rund, wie. die Oefen aus Faïance, und besteht außen aus zwei auf
einander aufgesezten Stuͤken, c, h, und aus einem
Fußgestelle, a, einer Abtheilung zum Kochen
(Laboratorium), aus drei Stuͤken, aus einem Dekel, n, aus einem Thuͤrchen zum Herde, o,
und einem halbkreisfoͤrmigen Schieber (Register), um den Zutritt der Luft zu
reguliren. Das Innere des Ofens besteht aus zwei Platten von Gußeisen, b, g, von gleichem Durchmesser mit dem Ofen, deren jede
am Umfange mit einer doppelten Kehle versehen ist, in welche die Stuͤke der
zum Kochen bestimmten Abtheilung, und des Fußgestelles passen. Eine dieser Platten,
b, bildet die Basis des Herdes; die andere, g, den oberen Theil. Zwei andere Platten, d, d, die senkrecht und 6 Zoll weit von einander
aufgestellt sind, vollenden den Herd, der 7 Zoll Hoͤhe, 6 Zoll Breite und 15
Zoll Tiefe hat. An den beiden horizontalen Hauptplatten sind zwei Oeffnungen, x, x, durch welche die unter dem Ofen aufgefaßte Luft
durchzieht, und sich laͤngs den Wanden des Herdes erhizt, ohne mit dem
Inneren desselben in Verbindung zu kommen. Eine Art von Kiste ohne Boden, oder ein
hohler Cylinder, i, i, der um drei Zoll schmaͤler
ist, als der Durchmesser des Ofens, ruht in den Furchen auf der oberen Platte, g, des Herdes. Diese Kiste laͤßt zwischen sich
und dem Koͤrper des Ofens einen leeren Raum, y,
y, von beinahe zwei
Zoll. Diesen Raum durchzieht aller Rauch, der sich entwikelt, mittelst der kleinen
Scheidewaͤnde, k, Fig. 4. die in die Furchen
eingefalzt sind, und den Rauch noͤthigen, den ihm vorgezeichneten Weg zu
nehmen, um in der Folge bei der oberen Oeffnung auszutreten, wo sich eine
Roͤhre aus Blech, p, befindet, die ihm den
Ausgang bahnt. An diesem Ofen sind keine Reife noͤthig, um die Stuͤke
zusammenzuhalten, aus welchen er besteht; jedes Stuͤk paßt in Falze, die es
sehr genau vereinigen und befestigen, so daß man kaum des Thones bedarf, um die
Zwischenraͤume zu verstreichen. Ein solcher Ofen laͤßt sich leicht
aufsezen und abnehmen, was vorzuͤglich fuͤr Familien, die ihre
Wohnungen oͤfters veraͤndern muͤssen, sehr vortheilhaft
ist.
Wir sahen den Ofen im Gange mit klein gesplissenem Holze von ungefaͤhr 7 Zoll
Laͤnge. In der Abtheilung zum Kochen war ein Kessel mit 2 1/2 Pfund Fleisch
und ungefaͤhr 3 Pinten Wasser, und uͤber demselben in einer Casserole
aus verzinntem Eisenbleche war Kalbfleisch mit Gemuͤse. Dieses leztere
Gefaͤß ruhte auf einer Art von Trapez aus Gußeisen, l, das auf drei Vorspruͤngen an der Kiste gelagert war. Alles ward
von dem Hute des Ofens, n, bedekt, und das
angezuͤndete Feuer erhizte sehr bald die Waͤnde des ganzen Apparates.
Ein Réaumuͤrsches Thermometer, welches man durch eines der, unter dem
Dekel angebrachten, Hizloͤcher einsenkte, zeigte, binnen 35 Minuten,
75°, und stieg in einer Stunde bis auf 85°; nach anderthalb Stunden
war das Fleisch beinahe vollkommen gesotten. Die Waͤrme der Luft im Zimmer
stieg auf 17 Grade, waͤhrend die der aͤußeren Luft 8 Grade war.
Waͤhrend dieser Zeit wurden sechs und ein halbes Pfund Holz verbrannt; man
verminderte hierauf die Staͤrke des Feuers, und das Fleisch wurde bei einer
schwaͤcheren Hize gar gekocht. Wir haben die Oberflaͤche berechnet,
welche die Wachen dieses Ofens, sowohl, die inneren, als die aͤußeren, der
kalten Luft darbothen, um ihr den Waͤrmestoff mitzutheilen, und fanden sie
ungefaͤhr 4 Metern gleich.
Wir haben bloß deßwegen 3 Kilogramm, und ein Viertel Holz in anderthalb Stunden
verbrannt (was fuͤr 12 Stunden 24 Kilogramm gaͤbe), weil Hr. Fortier zeigen wollte, wie schnell man in einem solchem
Ofen Fleisch kochen kann: mit der Haͤlfte Holzes haͤtte man in drei
Stunden uͤbrigens dasselbe leisten koͤnnen.
Wir bemerkten Hrn. Fortier, daß er seinen Ofen noch
dadurch verbessern koͤnnte, wenn er, 1) eine oder zwei Oeffnungen an der
Basis machte, statt daß er dieselbe auf Kloͤzchen ruhen laͤßt, um der
Luft Zutritt zu verschaffen; 2) unter dem Dekel eine Leitungsroͤhre
anbrachte, die mit der blechernen Roͤhre, in Verbindung steht, um die
Daͤmpfe der Speisen waͤhrend des Kochens entweichen zu lassen, da sie
sonst in das Zimmer treten: diese Daͤmpfe wuͤrden dadurch vollkommen
abziehen, wenn man zugleich die Hizloͤcher verstopfte. Allerdings
wuͤrde dadurch etwas Waͤrmestoff waͤhrend der Bereitung der
Speisen verloren gehen; allein, nach dem Kochen koͤnnte man diese
Roͤhre mittelst eines Schiebers schließen, und die Hizloͤcher wieder
oͤffnen. 3) an der blechernen Roͤhre, durch welche der Rauch abzieht,
ein kleines Thuͤrchen einsezte, durch welches man, mittelst einer Kerze oder
eines Stuͤkes brennenden Papieres, die Luft aus dem Inneren des Ofens anloken
koͤnnte, die, ohne diese Vorsicht, zuweilen in das Zinnner
zuruͤkfahren wuͤrde, wann das Feuer angezuͤndet wird. 4) zwei
gekruͤmmte Griffe an dem Dekel anbraͤchte, die der Form des Ofens
nicht schaden wuͤrden beim Auf- und Abheben des Dekels aber viel
Erleichterung gewaͤhren wuͤrden. Hr. Fortier hat diese Bemerkungen benuͤzt und befolgt.
Der Ofen des Hrn. Fortier hat ferner bei seiner
Ausfuͤhrung mehrere Schwierigkeiten dargebothen, die nur durch einen sehr
geschikten Modellirer beim Guße beseitigt werden konnten. Die Doppelkehlen auf
entgegengesezten Flaͤchen, senkrechte Furchen in Hohlcylindern u. d. gl.
forderten ganz besondere Sorgfalt und Mittel, die Hr. Fortier gehoͤrig zu benuͤzen wußte. Dieser Ofen ist, in
mancher Hinsicht, ein Muster fuͤr Kuͤnstler, die sich mit der
Heizkunst (Pyrotechnik) beschaͤftigen. Er wird ihnen beweisen, daß man
Stuͤke gießen kann, die ohne die gewoͤhnlichen Mittelstuͤke,
genau in einander passen: und deßwegen empfiehlt der Ausschuß vorzuͤglich die
Bekanntmachung dieses Ofens: Hr. Fortier hat die dabei
befolgte Methode nicht genau bekannt gemacht, er wird aber noch Nachtraͤge
hierzu liefern.
In Hinsicht auf Holzersparung ist es offenbar, daß dieser Ofen weniger Holz braucht,
und doch gut und viel schneller heizt, und daß diejenigen, die keine Gußoͤfen
scheuen, auch darin kochen koͤnnen, ohne bedeutend mehr Holz zu brauchen.
Erklaͤrung der Figuren.
Fig. 11.
Aufriß des Ofens des Hrn. Fortier aus Gußeisen mit
circulirender warmer Luft, von vorne.
Fig. 12.
Durchschnitt durch die Mitte.
Fig. 13.
Durchschnitt des oberen Theiles desselben.
Fig. 14.
Durchschnitt desselben mit den Laͤngenstuͤken und mit der
Roͤhre.
Fig. 15.
Platte des Herdes.
Fig. 16.
Platte am unteren Theile des Doppelkoͤrpers, von unten gesehen.
Fig. 17.
Dieselbe von oben gesehen.
Fig. 18.
Trapez, auf welchem die Casserole ruht.
a, Fußgestell; b, Platte des
Herdes; c, unterer Theil oder Koͤrper des Ofens;
d, d, gerade Seitentheile des unteren Theiles des
Ofens; e, gewoͤlbte Scheidewaͤnde zum
Durchzuge der Luft in dem unteren Theile des Ofens; f,
kleine Platte (bavette) auf der Herdplatte; g, Platte, die den unteren Theil oder Koͤrper des
Ofens bedekt; h, oberer Theil oder Koͤrper des
Ofens; i, Kiste oder Hohlcylinder der inneren Abtheilung
zum Kochen: k, k. Laͤngenstreifen zur Circulation
des Rauches; l, Trapez, auf welches man die Casserole
stellt; m, Reif auf dem oberen Koͤrper oder
Theile des Ofens; n, Dekel; o, Thuͤrchen zum Herde; p,
Roͤhre; q, Oeffnung, die durch das Fußgestell
laͤuft, um die Luft durchzulassen; r,
Hizloͤcher; s, kleines Thuͤrchen, oder
Sauger der Roͤhre, p: t, Kessel; u, Casserole aus verzinntem Eisenbleche; v, kleine Roͤhre, um die Daͤmpfe der
Speisen entweichen zu lassen; x, Oeffnungen zum
Durchgange der Luft; y, Raum, in welchem die Luft
circulirt; z, Bok, auf welchen man das Holz legt.
Tafeln