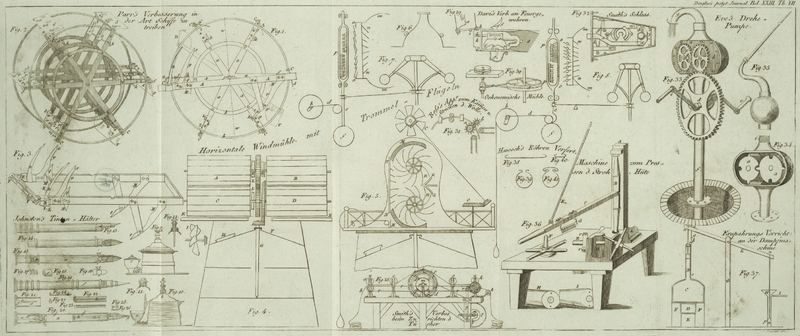| Titel: | Verbesserungen an Tinten-Hältern, worauf Wilh. Johnston, Juwelier in Caroline-Street, Bedford-Square, Middlesex, sich am 24. Julius 1826 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 23, Jahrgang 1827, Nr. XCV., S. 444 |
| Download: | XML |
XCV.
Verbesserungen an Tinten-Haͤltern,
worauf Wilh. Johnston,
Juwelier in Caroline-Street, Bedford-Square,
Middlesex, sich am 24. Julius 1826 ein Patent
ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. December 1826. S.
246.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Johnston, Verbesserungen an
Tinten-Haͤltern.
Diese Erfindung besteht in einer besonderen Vorrichtung an
Tinten-Faͤssern und an den sogenannten Quell-Federn (fountain-pens.)
Fig. 9. zeigt
ein feststehendes Tinten-Faß von außen, in welchem die Tinte gegen den
Einfluß der Luft geschuͤzt ist. Fig. 10. zeigt dasselbe
im Durchschnitte. Wenn man das obere Stuͤk, a,
einfuͤhrt, kann die Tinte in das Innere des Tinten-Fasses eingelassen
werden, und wenn dieses Stuͤk niedergeschraubt wird, wird die Kammer, b, luftdicht, c, ist ein
Becher, der mit der Kammer, b, mittelst eines kleinen
Canales, d, in Verbindung steht, in welchem sich ein
Sperrhahn, e, befindet. Wenn man nun Tinte braucht, wird
der Hahn, e, durch das Drehen des kleinen Hebels
geoͤffnet, oder auf irgend eine andere bequeme Weise, wodurch dann Tinte aus
der Kammer, b, in den Becher, c, gelangen wird. Zuweilen wird es indessen, damit dieß geschehen
koͤnne, nothwendig seyn, Luft in die Kammer eindringen zu lassen, was durch
das Drehen des Rosenknopfes an dem oberen Sperrhahne, f,f fehlt im Originale. A. d. Ueb. bewirkt wird, indem dieser so lang gedreht wird, bis die Oeffnung eines
kleinen Canales, der durch die Mitte dieses Sperrhahnes laͤuft, einem kleinen
Loche an dem Stuͤke, a, gegenuͤber kommt,
wodurch dann Luft in die Kammer eintritt, Die Luft kann indessen auch ohne einen
solchen Sperrhahn eingelassen werden, naͤmlich durch eine kleine Oeffnung,
die in dem oberen Stuͤke, a, eine kurze Streke
nach aufwaͤrts laͤuft, und sich dann herum dreht, wie die einzelne
Figur 11.
zeigt, wo man nur das obere Stuͤk so lange zuruͤkschrauben darf, bis
sich dieser Luftgang unter dem Halsstuͤke oͤffnet. Um die Tinte aus
dem Becher, c, wieder in die Kammer zuruͤk zu
bringen, laͤßt man den Canal, e, offen, und neigt das Tintenfaß auf
die Seite, wo dann alle Tinte durch den Canal zuruͤkfließen wird. Wenn nun
die Sperrhaͤhne, e, und, f, geschlossen werden, wird die Tinte wieder in der Kammer
zuruͤkgehalten, und gegen Verduͤnstung und Einwirkung der Luft
gesichert. Die Tinte kann auch aus dem Becher mittels eines
Sauge-Staͤmpels in die obere Kammer zuruͤkgezogen werden, der
luftdicht paßt, und durch sein Zuruͤkziehen einen leeren Raum in der Kammer
erzeugt, wodurch dann die Tinte in die Kammer zuruͤktritt. Durch eine
Seitenbewegung des Staͤmpels kommt dann wieder Luft in die Kammer, und treibt
die Tinte in der Folge in den Becher, wie die einzelne Figur 12. zeigt.
Das Tintenfaß kann aus Metall, oder aus irgend einem anderen schiklichen Materiale
seyn: wenn aber die Tinte auf dasselbe wirken sollte, muß es innenwendig glasirt
oder lakirt, oder mit irgend etwas uͤberzogen oder ausgefuͤttert seyn,
worauf die Tinte nicht chemisch einwirkt.
Fig. 13 und
14. zeigt
eine sogenannte Quell-Feder, mit dem verbesserten
Tinten-Haͤlter von außen in verschiedenen Lagen. Fig. 15. ist dieselbe im
Durchschnitte, a, ist die Roͤhre, in welcher die
Tinte enthalten ist. Sie ist oben mittelst des Pfropfens, b, geschlossen, und das Ende ist mit einer Kappe, c,c und d fehlt im
Originale. A. d. Ueb. bedekt. An dem unteren Ende ist der Federn-Haͤlter, d, zur Aufnahme eines geschnittenen Federkieles, oder
einer anderen Schreibfeder auf die gewoͤhnliche Art angebracht, so daß Tinte
mittelst des Fingers des Schreibers (nach Umstaͤnden), nachgelassen werden
kann, indem man den kleinen Hebel an dem Sperrhahne, e,
dreht, der, wenn er geoͤffnet wird, die Tinte durch einen engen Canal in die
Spize der Feder fließen laͤßt. Um die gehoͤrige Menge Luft in die
Roͤhre oder Kammer, a, zu lassen, ist ein sehr
kleines Loch in der Kappe und in dem Pfropfen angebracht, wie man in Fig. 15. sieht. Der
Sperrhahn ist einzeln in Fig. 16. gezeichnet; der
Pfropfen in Fig.
17. und die Kappe in Fig. 18.
Fig. 19.
stellt den obigen Tinten-Haͤlter in Verbindung mit einem
Bleistift-Haͤlter vor. Fig. 20. zeigt Fig. 19. im
Durchschnitte, a, ist die Tinten-Kammer; b, der Canal, um die Tinte in die Federspize zu
fuͤhren, wenn der Sperrhahn,
c, auf obige Weise geoͤffnet wurde. d, ist das Ende der Kappe, von welcher die Spize der
Feder umgeben ist, wenn man sie nicht braucht. Fig. 21. zeigt diese
Kappe im Durchschnitte und abgenommen. e, ist ein
Pfropfen oder eine Spize, der in den Canal, b, paßt, und
das zufaͤllige Entweichen der Tinte aus demselben hindert, so wie auch das
Verkleben desselben durch das Vertroknen und Erhaͤrten der Tinte.
An dem entgegengesezten Ende des Tinten-Haͤlters verlaͤngert
sich die walzenfoͤrmige Roͤhre, a, in
einen Bleistift-Haͤlter. f, f, ist das
aͤußere Gehaͤuse; g, der
kegelfoͤrmige Spizenfuͤhrer nach der gewoͤhnlichen Art.
Innerhalb des walzenfoͤrmigen Gehaͤuses ist eine Roͤhre, h, die in Fig. 22. einzeln und
abgenommen dargestellt ist, mit einem der ganzen Laͤnge nach hinlaufenden
Spalte, und in dieser Roͤhre ist eine andere Rohre, i, die gleichfalls von einem Ende bis zu dem anderen gespalten, und außen
schraubenfoͤrmig eingeschnitten ist, wie man in Fig. 23. sieht. Ein
Staͤngelchen aus Stahl, k, (Figur 24.) laͤuft
innenwendig durch die Roͤhre, i, und ist so
gekehrt, daß sein Ansaz durch den Spalt hervorragt, und den Bleistift
vorwaͤrts schiebt, der auf die gewoͤhnliche Weise durch eine
Federklammer gehalten wird. Diese Federklammern sind in Fig. 25 und 26.
dargestellt. Außen auf der Roͤhre, i, schrauben
zwei Halsbaͤnder, wie Fig. 27. sich
vorwaͤrts und ruͤkwaͤrts, und umfassen das emporstehende Ende
des Schiebers, wie man in Fig. 20. sieht. Ein
kleines vierekiges, zu jeder Seite des Halsbandes hervorstehendes, Stuͤk paßt
in den Spalt der Roͤhre, h, in welche nun die
Roͤhre, i, und der Schieber, k, und die Halsbaͤnder eingefuͤgt werden,
wie man in Fig.
19. sieht.
Wenn man jezt den kegelfoͤrmigen Fuͤhrer der Spize mittelst des Fingers
und des Daumens dreht, (waͤhrend das aͤussere Gehaͤuse
feststeht), so wird die Roͤhre, i, umher
gefuͤhrt, und die an der aͤußeren Oberflaͤche derselben
befindlichen Schraubengaͤnge, die in die Halsbaͤnder eingreifen,
waͤhrend die vierekigen Theile sich in dem Laͤngenspalte der
Roͤhre, h, schieben, und da das nach
aufwaͤrts gekehrte Ende von, k, eingeschlossen
ist, bringen sie auch dieses und den durch die Federklammern damit in Verbindung
stehenden Bleistift vorwaͤrts oder zuruͤk.
Tafeln