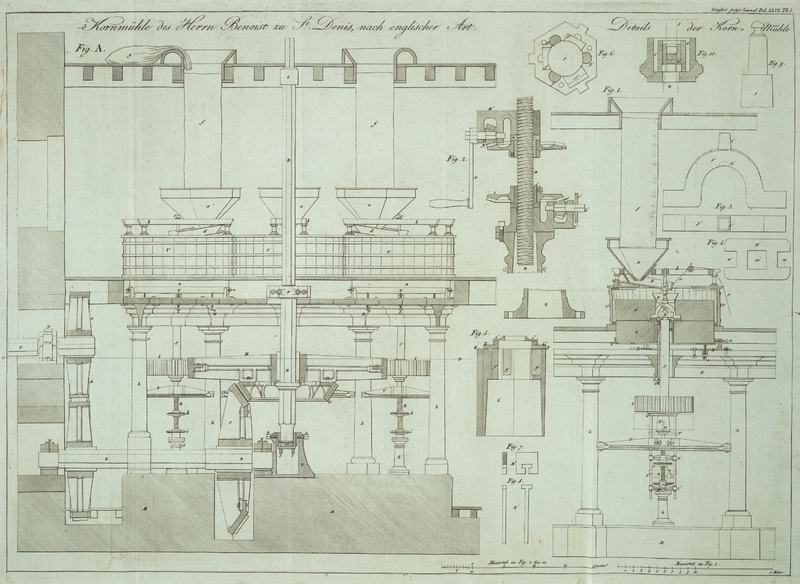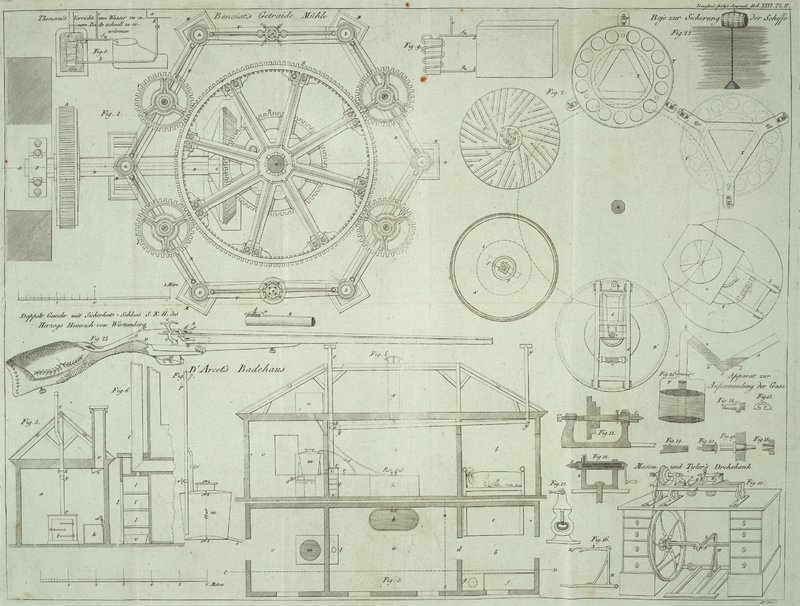| Titel: | Kornmühlen nach sogenannter englischer Art, wie Hr. Benoist sie auf seinem Mahlwerke zu St. Denis bei Paris vorgerichtet hat. |
| Fundstelle: | Band 26, Jahrgang 1827, Nr. I., S. 1 |
| Download: | XML |
I.
Kornmuͤhlen nach sogenannter englischer
Art, wie Hr. Benoist sie auf
seinem Mahlwerke zu St. Denis bei Paris vorgerichtet hat.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement. N. 274. S. 101.
Mit Abbildungen auf Tab.
I. u. II.
Benoist, uͤber Kornmuͤhlen.
Die sogenannte englische
Mahl-Methode (mouture dite à
l'anglaise) ist amerikanischen Ursprunges, und wurde nur in England
vervollkommnet. Sie verbreitet sich jezt in Frankreich, und ist in mehreren großen
Muͤhlen daselbst bereits eingefuͤhrt. Die Hauptvortheile, die man
durch diese Methode erhaͤlt, sind: 1) daß man weniger Zeit zum Mahlen
braucht, als bei der gewoͤhnlichen Art von Muͤhlen; 2) daß das Mehl
nicht angebrannt, nicht verdorben wird, da es sich hier weniger erhizt; 3) daß man
mehr und besseres Mehl durch diese neue Methode erhaͤlt; 4) daß das Mehl,
besser zertheilt, auch ein schmakhafteres und besseres Brod gibt.
Die Muͤhlsteine haben an diesem neuen Muͤhlwerke 45 Zoll, und arbeiten
mit 22 Zoll; sie laufen 120 Mahl in Einer Minute umher, und sind weder convex noch
concav. Das Richten derselben besteht nur darin, daß man sie immer vollkommen
horizontal stellt, und daß man ihre Furchen, die von dem Auge nach dem Umfange
hinlaufen. Einen Zoll breit, drei Viertel Zoll tief, und zwei Zoll weit von einander
entfernt sind, immer vollkommen gerade haͤlt. Die Entfernung der Furchen ist
nach Art des Kornes, das man mahlen will, verschieden, und vorzuͤglich auch
nach der verschiedenen Harte der Steine. Das Mehl kommt, wie bei dem
gewoͤhnlichen Grobmahlen, aus den Steinen heraus, faͤllt in einen
Kasten, und wird eingesakt; man laͤßt es in den Saͤlen zehn bis
zwoͤlf Tage lang sich erfrischen, und bringt es dann in eine
walzenfoͤrmige Beutel-Maschine aus Drahtgewebe, die innenwendig mit
Buͤrsten. versehen, und in drei Faͤcher getheilt ist, in welche die
drei verschiedenen Mehlsorten fallen.
In Amerika, wo Menschen-Arme seltener sind, sucht man den Menschen so viel
moͤglich durch Maschinen zu ersezen. Man schoͤpft dort das Korn durch
ein Trograd in die obere Abtheilung der Muͤhle hinauf, oder durch
Roͤhren von der Form der archimedischen Schraube, und reinigt dasselbe
zugleich bei dieser Arbeit. Das Mehl kommt, beim Austritte aus den Steinen, in eine
Maschine, die es zerstaͤubt und zertheilt, und erst aus dieser in die
walzenfoͤrmigen Beutel, von welchen weg es alsogleich in Faͤsser
geschlagen wird. Oliver Evans, der dieses Mahl-System in seinem ganzen Detail
beschrieben hat, versichert, daß eine Muͤhle, die taͤglich 40 Tonnen
Mehl mahlt, nur zwei Menschen braucht; ehe brauchte man vier Menschen dazu. Als
Muster von Muͤhlen dieser Art kann man die Muͤhle, die Hr. Ellicot am Occoquam-Flusse in Virginien erbaute,
anfuͤhren. Sie ist im IX. Bd. der Annales des Arts et
Manufactures S. 103 beschrieben.
Die englischen Muͤhlen zeichnen sich vor den amerikanischen durch ihre
Festigkeit aus; sie sind beinahe ganz aus Eisen, nehmen sehr wenig Raum ein, sind
aber in mechanischer Hinsicht vortrefflich gedacht, und in allen ihren Theilen
herrlich ausgefuͤhrt.
Die erste Sorgfalt des englischen Muͤllers ist darauf gerichtet, das Korn so
sorgfaͤltig als moͤglich von allen demselben beigemengten
Unreinigkeiten zu reinigen. Hierzu hat er Maschinen, die eben so schnell als genau
arbeiten. Eine der gewoͤhnlichsten Maschinen zu diesem Zweke ist ein
walzenfoͤrmiges Sieb aus starkem Metall-Gewebe, das schief geneigt und
innenwendig mit Buͤrsten versehen ist, und mit Krazern, die wie Reibeisen
durchloͤchert sind, und in Einer Minute sich 170 Mahl drehen. Das Korn
faͤllt oben in diese Maschine, wird mit einer außerordentlichen
Geschwindigkeit in derselben umhergedreht, und durch die Reibung, die es zwischen
den Waͤnden dieser Trommel erleidet, faͤllt es gereinigt durch.
Waͤhrend es durchfaͤllt, wirkt noch ein Faͤcher mit vier
Fluͤgeln auf dasselbe, der den Staub und alle fremden Theile davon jagt.
Obschon England mehrere Muͤhlsteinbruͤche besizt, bedient man sich doch
daselbst der franzoͤsischen, die alle erforderlichen Eigenschaften in sich
vereinigen. Da indessen diese Steine selten durchaus von gleicher Harte in ihrer
Masse sind, so waͤhlen die Englaͤnder Bruchstuͤke derselben,
die von gleicher Haͤrte sind, behauen sie in gehoͤriger Form,
fuͤgen und kitten sie mittelst Gyps zusammen, und bilden daraus einen Muͤhlstein,
den sie mit Reifen von Eisen befestigen. Die nicht mahlenden Flaͤchen dieser
Muͤhlsteine werden nicht geschaͤrft, sondern bloß mit Bruch-
oder Ziegel-Steinen, und mit Gyps ausgegossen. Die eigentliche
Schaͤrfung oder Zurichtung geschieht mittelst schieflaufender Halbmesser von
der gewoͤhnlichen Tiefe, die zwei bis zwei und einen halben Zoll weit von
einander entfernt sind. Der liegende Muͤhlstein ist in der Mitte mit einem
vierekigen oder sechsekigen Loche versehen zur Aufnahme der Buͤchse aus
Gußeisen, durch welche das Eisen laͤuft. Sie ist mit Widerlagen aus Kupfer
versehen, die durch Keile eingetrieben werden.
Das Eisen verbindet sich mit dem laufenden Muͤhlsteine mittelst der
Kruͤke (l'anile): diese bildet ein
gewoͤlbtes, in den Muͤhlstein eingelassenes, Stuͤk Eisen, in
dessen Mitte sich eine Hoͤhlung befindet, welche das zugerundete Ende des
Eisens aufnimmt. Auf diese Weise wird der Muͤhlstein in seinem Mittelpuncte
vollkommen im Gleichgewichte erhalten, und erlangt die Faͤhigkeit nach allen
Seiten hinzuschwanken, und sich etwas zu heben, wo er zu großen Widerstand
findet.
Das ermuͤdende Abheben des laufenden Muͤhlsteines, das Kehren und
Wiederaufsezen desselben, geschieht in England mittelst eines leichten eisernen
Krahnes, den man mit Leichtigkeit stellen, und den ein einzelner Mann regieren kann.
Er besteht aus einer großen senkrechten Schraube, die an ihrem unteren Ende zwei
gewoͤlbte eiserne Arme fuͤhrt, welche den Muͤhlstein umfassen,
und durch Bolzen an demselben festgehalten werden, die in Loͤcher an dem
Umfange desselben eintreten. Auf dieser Schraube ist ein mit einer weiblichen
Schraube versehenes Winkelrad aufgezogen, welches von einem Triebstoke getrieben
wird, dessen Achse von einer Kurbel in Bewegung gesezt wird. Wenn man nun den
laufenden Muͤhlstein abheben will, faͤngt man damit an, daß man den
Reiber und die uͤbrigen Theile auf demselben los macht, die gewoͤlbten
Arme mittelst der Zapfen darauf anpaßt, und nun die Kurbel spielen laͤßt. Die
Schraubenspindel dreht sich dann in ihrer Schraubenmutter, und hebt sich, und der
Muͤhlstein laͤßt sich, sobald er dadurch in die gehoͤrige
Hoͤhe gehoben wurde, leicht kehren und schaͤrfen, und durch
entgegengeseztes Drehen der Kurbel wieder auf seinen Plaz
zuruͤkfuͤhren.
Bei dieser neuen Art zu mahlen erhizt das Mehl sich nur sehr wenig zwischen den
Muͤhlsteinen: indessen hat man doch die Vorsicht, dasselbe vor dem
Durchbeuteln aufzufrischen. In England geschieht Lezteres in Kisten, die zu ebener
Erde hingestellt sind; in America bedient man sich hierzu einer sehr sinnreichen
Maschine, durch welche man Zeit und Arbeit zugleich erspart.
Diese Maschine, die man den Frischer (rafraichisseur) nennt, besteht aus einem großen Rade von
10 bis 15) Fuß im Durchmesser, welches in Einer Minute ungefaͤhr vier Mahl
umlauft, und dessen Speichen und Felgen mit Kaͤmmen versehen sind, die
breiter als dik sind: die einen derselben Haufen das Mehl gegen den Mittelpunkt der
Welle hin an, die anderen schuͤtten es in den Rumpf der
Beutel-Maschine. Dieser Mechanismus ist so vorgerichtet, daß das heiße Mehl
immer gegen den Mittelpunct geschafft, und nur das abgekuͤhlte gegen den
Umfang geworfen wird, wo es durch Oeffnungen in dem Boden in die Ruͤmpfe der
Beutel-Maschine durchfaͤllt. Das Mehl wird mittelst einer Laufkette,
die mit Troͤgen versehen ist, welche dasselbe in dem Mehlkasten
schoͤpfen, zu dem Erfrischer hingeschafft.
Das Absondern der Kleie von dem Mehle geschieht in England durch eine andere
Beutel-Vorrichtung, als bei uns; man bedient sich hierzu bedekter Trommeln
aus Metall-Geweben von verschiedener Feinheit, nach den verschiedenen
Mehlsorten, dieman bereiten will. Diese Beutel-Trommeln sind schief geneigt,
und statt daß sie selbst sich drehen, dreht sich innerhalb derselben ein
Buͤrsten-System, das sich an dem Siebe reibt, und die Kleien
absondert. Der Theil des Metall-Gewebes, welcher oben an der Trommel zu
liegen kommt, ist der groͤbste; das zunaͤchst nach unten gelegene
daran anstoßende Metall-Gewebe ist feiner u.s.f.
Das Mahlwerk des Hrn. Benoist zu St. Denis bei Paris ist
eines der schoͤnsten und besteingerichtetesten in ganz Frankreich. Es hat 10
Gaͤnge oder Muͤhlstein-Paare, wovon vier nach
franzoͤsischer Art von 5 Fuß 5 Zoll bis 5 Fuß 10 Zoll im Durchmesser, die von
zwei Wasserraͤdern getrieben werden, und sechs nach englischer Art, von 4 Fuß
im Durchmesser, die auf einem eisernen Gestelle im Kreise angebracht sind, und von
einer Dampf-Maschine mit der Kraft von 20 Pferden getrieben werden. Diese Maschine wurde
sammt allem Zugehoͤre von den Mechanikern, HHrn. Aitken und Steele, gebaut, deren Talente die
Société d'Encouragement mit der
goldenen Medaille belohnte.
Wir sprechen hier nur von dem Mahlwerke nach englischer Art, da das
franzoͤsische die uͤberall bei uns gebraͤuchliche Einrichtung
hat.
Man sieht auf Tab. I. den senkrechten Durchschnitt,
und auf Tab. II. den Grundriß der englischen
Muͤhle mit dem Mechanismus, der die Muͤhlsteine in Bewegung sezt, die
im Kreise auf einem Gestelle aus Gußeisen, K, angebracht
sind, welches von Saͤulen, L, aus demselben
Metalle getragen wird. Diese Saͤulen ruhen auf einer festen Grundlage, M, von Steinen, die mit einem starken Bandwerke von
Gußeisen umgeben ist, auf welchem die Sokel der Saͤulen ruhen. Den
Mittelpunct nimmt ein großes Kammrad, H, ein, dessen
Zapfen aus hartem Holze sind. Es ist auf einer sechsekigen Welle aus Gußeisen, E, aufgezogen, die sich in einer Pfanne, S, dreht, und im ersten Stoke in einem Halsbande, F, laͤuft. Im zweiten Stoke tritt sie in einen
Muff, G, der ihr oberes Ende mit dem unteren Ende ihrer
Verlaͤngerung nach oben verbindet. Auf eben dieser Welle ist unter dem
Kammrade ein Winkelrad, D, befestigt, welches von dem
Zahnrade, D', getrieben wird, das auf der
Haupt-Triebwelle, B, aufgezogen ist. Leztere
steht mit der Dampfmaschine durch zwei Zahnraͤder, A, und, O, und eine Achse, P, in Verbindung. Beide drehen sich auf gegossenen
Lagern, N, die mit kupfernen Muscheln besezt sind.
Jedes Muͤhlstein-Paar besteht aus Steinen, die auf das
Sorgfaͤlligste ausgewaͤhlt, mit Gyps zusammengefuͤgt, und mit
starken eisernen Reifen umgeben sind. Der obere Muͤhlstein wird durch einen
Triebstok, I, welcher von dem Kammrade, H, getrieben wird, in Bewegung gesezt. Das Ende des
Eisens, J, der Muͤhlsteine dreht sich in einer
Pfanne, D', deren Lage durch die Drukschrauben, s, s, regulirt wird. Man hebt das Eisen durch einen
Mechanismus, von welchem wir weiter unten sprechen, und mit welchem, unter der
genauesten Beibehaltung des nothwendigen Parallelismus der beiden reibenden
Flaͤchen, leztere, so wie die Arbeit es fordert, einander naͤher
gebracht, und von einander entfernt werden koͤnnen.
Der untere unbewegliche Muͤhlstein, Z, liegt in
einer Schale,
Y, die, damit sie leichter wird, ausgeraͤumt
wird, und auf einem dreiekigen Geruͤste, X, ruht.
Drukschrauben, n, n, druͤken auf die
Raͤnder des Muͤhlsteines, um zu hindern, daß er nicht in seiner Schale
wankt. Andere Schrauben, o, o, Fig. 1. Tab. I. dienen zur
vollkommenen Horizontal-Stellung desselben mittelst einer Wasserwage, die man
zu diesem Ende auf den Muͤhlstein legt.
Wir haben schon oben von dem Unterschiede gesprochen, der hinsichtlich des Zurichtens
oder Schaͤrfens der englischen und der gewoͤhnlichen
Muͤhlsteine Statt hat. Wir bemerken hier bloß, daß, nachdem man die
Oberflaͤche des liegenden Muͤhlsteines gehoͤrig gestellt hat,
man die Furchen in schiefer Richtung auf die Halbmesser ein Haut. Die Richtung der
groͤßten Furchen wird durch einen Kreis von 9 Zoll im Durchmesser bestimmt,
den man von dem Mittelpuncte aus beschreibt: ihre Verlaͤngerungen werden
Tangenten auf einen Kreis von 4 Zoll im Durchmesser, und die uͤbrigen Furchen
laufen parallel mit den ersten. Der laufende Muͤhlstein wird auf dieselbe
Weise geschaͤrft. Die Form der Furchen ist dreiekig und so vorgerichtet, daß,
wenn die Muͤhlsteine auf einander liegen, diese Furchen eine Art von
Parallelogramm bilden, und sich kreuzen. Der Zwischenraum zwischen zwei und zwei
Furchen wird mit einem eigenen Hammer behauen, um die Oberflaͤche der
Muͤhlsteine gehoͤrig rauh zu halten. Die Vertiefungen, die man dadurch
erzeugt, muͤssen sehr fein und zugleich sehr regelmaͤßig seyn: man
rechnet deren gewoͤhnlich 24 auf den Zoll, so daß sich deren 60 zwischen
jedem Furchenpaare befinden. Es gibt geschikte Arbeiter, die sogar 48 solche
parallele Vertiefungen mit außerordentlicher Regelmaͤßigkeit in Einem Zolle
einhauen koͤnnen. Durch diese Zurichtung des Steines wird das Korn, das auf
den Mittelpunct der Steine faͤllt, nicht bloß durch die
Centrifugal-Kraft gegen den Umfang derselben getrieben, sondern zugleich auch
durch die schiefe Richtung der Furchen dahin gezogen. Der Hauptvortheil bei dieser
Zurichtung der Muͤhlsteine nach englischer Art, die von der unsrigen ganz
verschieden ist, besteht darin, daß man ein feineres Mehl und groͤßere Kleie
erhaͤlt, die sich dann durch das Beuteln leichter absondern laͤßt.
Das Eisen, J, des laufenden Muͤhlsteines wird in
der Mitte des liegenden Muͤhlsteines durch ein Stuͤk Gußeisen
festgehalten, das man die Buͤchse (boitard)
nennt, und auf Tab. I.
Fig. 5 und
6. im
Grundrisse und im Aufrisse sieht. Dieses sechsekige Stuͤk ist in die Dike des
Muͤhlsteines eingelassen, und wird darin mittelst hoͤlzerner Keile von
weißem Holze festgehalten, so daß sie Einen Zoll unter der Oberflaͤche
desselben steht. Sie ist, mit drei kupfernen Widerlagen, f',
f' versehen, die, statt durch Schrauben angezogen zu werden, durch den
Keil, M', getrieben werden, den man in Fig. 7. besonders
dargestellt sieht. In diesen Keil paßt ein kruͤkenfoͤrmiger Bolzen,
N', Fig. 8., der an seinem
Ende eine Schraubenspindel bildet, und eine weibliche Schraube, oder ein Niet, V, aufnimmt. Wenn man diese Schraube dreht, so steigt
der Bolzen nieder, und zieht den Keil, M', der die
Widerlage als Unterlage befestigt. Die Zwischenraͤume zwischen den Widerlagen
sind mit geoͤhltem Werke, g', ausgefuͤllt,
wodurch das Eisen geoͤhlt wird. Die Buͤchse ist mit einem
kreisfoͤrmigen Stuͤke, h', bedekt, welches
mittelst Schrauben festgehalten wird, und mit einem Hute, i', der auf den vierekigen Theil des Eisens aufgestekt wird, um mit
demselben zu laufen. Dieser Hut hat einen Rand, der den hervorspringenden Theil des
Stuͤkes, h', bedekt, damit kein Staub in die
Buͤchse gelangen kann. (Siehe Fig. 2. Tab. II.)
Man sieht in Fig.
3. Tab. I., die Kruͤke oder Krone, die den oberen Muͤhlstein
haͤlt, und mit sich fortdreht, und demselben zugleich in horizontaler, und
mit dem unteren Muͤhlsteine paralleler Lage zu bleiben gestattet. Sie ist aus
Gußeisen, gewoͤlbt, und an ihren beiden Armen mittelst Blei quer uͤber
das Auge eingelassen. Eine, im Mittelpunkte, k',
angebrachte Hoͤhlung nimmt das obere Ende des Eisens, J, von derselben Form auf, und ein vierekiger Zapfen, l', der unten vorgerichtet ist, nimmt den Reiber, O', auf. Das Eisen laͤuft vierekig durch eine
Gabel, K', Fig. 4. aus Gußeisen, die
in den Einschnitten, n', n', den unteren und den hohlen
Theil der Kruͤke aufnimmt, so daß, zu derselben Zeit, wo der obere
Muͤhlstein in seinem Mittelpunkte der Schwere oben auf dem Eisen, J, gehalten wird, dieses denselben in seiner drehenden
Bewegung mittelst der Gabel, K', fortreißt. Die Stellung
dieser Stuͤke muß das nothwendige Spiel unterhalten, damit der seiner eigenen
Schwere uͤberlassene Muͤhlstein immer im Gleichgewichte bleibt, und
frei nach allen Richtungen auf dem Gipfel des Eisens, J,
sich schwingen kann.
Diese Verbindung des Eisens mit der Kruͤke oder mit der Krone findet Hr. Benoist an seiner Muͤhle noch mangelhaft. Er
findet es schwierig, das Eisen in dem vierekigen Loche der Gabel, K', genau zu stellen, so daß es nicht wankt, und da,
zweitens, das Eisen zu tief unten gefaßt wird, so muß, bei dem mindesten Fehler im
Gleichgewichte, der Muͤhlstein auf der einen Seite sich mehr reiben, als auf
der anderen, wodurch er schnell abgenuͤzt wird, das Mehl sich erhizt, und die
Arbeit oft unterbrochen werden muß; zugleich werden dadurch auch kostbare
Reparaturen veranlaßt.
Hr. Benoist hat, um diesen Maͤngeln abzuhelfen,
folgende Verbesserung vorgeschlagen, die er nach und nach an allen seinen
Muͤhlen vorzunehmen gedenkt.
Das obere Ende des Eisens, J, ist mit drei
staͤhlernen Zungen versehen, die in correspondirende Furchen eingreifen,
welche in einem Muffe aus Gußeisen eingegraben sind, der genau auf das Eisen paßt.
Dieser Muff hat einen tieferen Quer-Einschnitt, in welchen der
gewoͤlbte Theil der Kruͤke sich einlegt. Durch diese einfache
Vorrichtung, die viele Aehnlichkeit mit der Muͤhle zu Maudsley hat, die Hr.
Leblanc beschrieb, zieht das Eisen, welches seine
runde Form in seiner ganzen Laͤnge behaͤlt, den Muff mit sich fort, so
wie dieser die Kruͤke, und leztere den Muͤhlstein. Man hat nun weder
ein Wanken, noch ein Brechen mehr zu besorgen, und, da die Fassung hoͤher
hinaufgeruͤkt wurde, so ist das Gleichgewicht des Muͤhlsteines
vollkommen sicher gestellt, und es wird auch weniger Kraft erfordert, um den
Muͤhlstein zu drehen.
Der sich drehende Muͤhlstein wird in Hrn. Benoist's
Mahlwerke mittelst eines Flaschenzuges gehoben. Zwei Menschen reichen zu dieser
Arbeit hin, und arbeiten sich eben so leicht und sicher, als mittelst eines
Krahnes.
Die Muͤhlsteine sind, wie gewoͤhnlich, mit dem hoͤlzernen
Aufsaze (dem Muͤhlbottiche) versehen, U, und
haben ihren Rumpf, a, in welchen das Getreide durch
einen Schlauch aus Leinwand gelangt, f; dieß
faͤllt dann in den Schuh am Rumpfe, d, der durch
den Reiber, O', eine Art zitternde Bewegung
erhaͤlt. O', ist naͤmlich mit einem
Triebstoke, e, versehen, der, waͤhrend er sich
dreht, immer an den Boden des Schuhes, der mit hartem Holze eingefaßt ist,
anschlaͤgt; das harte Holzerlaubt staͤrkere Schlaͤge, und gibt
zugleich groͤßere Dauerhaftigkeit. Die Lade-Schnur, t, dient zur Regulirung der Menge des Getreides, die durch
den Schuh geliefert werden soll: sie greift daher in eine Reihe von Einschnitten
oder Kerben ein, die auf der Walze, c, angebracht sind.
Um den Schuh mehr oder minder gegen den Triebstok, e,
anzulegen, bringt man die Schnur in eine von der senkrechten Flaͤche des
Schuhes mehr oder minder entfernte Kerbe. Sie ist unten, bei dem Mehlkasten, auf
einer mit einem Zahnrade versehenen Walze befestigt, so daß man sie immer in
gleicher Spannung erhalten kann.
Durch folgenden Mechanismus werden die Muͤhlsteine von einander entfernt, und
wird die Muͤhle, gestellt.
Wenn man eine große Menge Mehles zu mahlen hat, laufen alle sechs Gange zugleich; es
gibt jedoch Umstaͤnde, unter welchen es nochwendig wird, einen Gang oder
mehrere Gaͤnge außer Umlauf zu sezen. In diesem Falle muß die Verbindung mit
dem Kammrade unterbrochen werden, was auf folgende Weise geschieht.
Der Triebstok, I, greift frei in den
kegelfoͤrmigen Theil, E', des Eisens, J, wo er durch Zungen, u,
festgehalten wird, die in correspondirende Furchen in dem Mittelpuncte des Rades
einfallen. In dieser Lage, die in Fig. 1. Tab. I. durch
punctirte Linien angedeutet ist, wird der Triebstok von dem Eisen fortgerissen. Wenn
man ihn nun aus der Flaͤche des Kammrades, das ihn fuͤhrt,
herausbringen will, so dreht man die Kurbel, x, Fig. 2., auf
deren Achse sich ein Triebstok, y, befindet, der in ein
Winkelrad, h, eingreift. Dieses Rad ist auf einer
weiblichen Schraube, Z, befestigt, die laͤngs der
großen maͤnnlichen Schraube, R, auf- und
niedersteigt, und ein Querstuͤk, H', mit sich
zieht, welches mit dem Buͤgel, F'. Ein
Stuͤk bildet, dessen Arme frei durch das Stuͤk, l', laufen. Man begreift, daß, wenn man die Kurbel dreht, die weibliche
Schraube laͤngs der maͤnnlichen Schraube, R, aufsteigen, und das Querstuͤk, H',
mit sich ziehen muß, welches auch die Arme des Buͤgels, F', mit sich fuͤhrt, an welchen es befestigt ist.
Dann stoͤßt nun die Krone, G', die auf dem
Buͤgel sizt, den Triebstok, l, und macht ihn
uͤber den Kegel, E', heraustreten, und hebt ihn
folglich aus dem Kammrad, H, aus.
Wenn man die Muͤhlsteine von einander entfernen will, laͤßt man die
Schraube, R, in die Hoͤhe steigen, deren unteres
Ende in die hohle Saͤule, Q, tritt, auf welcher
der ganze Mechanismus ruht. Man bringt nun eine Kurbel an dem vierekigen Stuͤke, b', an, Fig. 2. Tab. I. auf
welchem der Triebstok, a' befestigt ist. Dieser
Triebstok greift in ein Winkelrad, i, ein, welches eine
Mutterschraube, e', fuͤhrt, die die
maͤnnliche Schraube, R, aufnimmt. Diese Schraube
hebt, wenn sie aufsteigt, die Pfanne, D, Fig. 10., die sie in der
Buͤchse, o', schiebt. Und mit ihr das Eisen, J, dessen Zapfen darauf laͤuft. Da die Entfernung
der Muͤhlsteine nie bedeutend ist, so tritt die Pfanne, D, nicht ganz aus der Buͤchse, in welcher sie
durch die Drukschrauben, s, s, festgehalten wird. Ein
Sperr-Rad, c', mit einem Sperrkegel, d', hindert den Triebstok, a', vor dem Zuruͤktreten.
Damit die Muͤhle immer in derselben Regelmaͤßigkeit fortlaͤuft,
wird es nothwendig, daß die in einander eingreifenden Zaͤhne immer mit
einander in Beruͤhrung bleiben. Die Zaͤhne der abgestuzt
kegelfoͤrmigen Raͤder, C, und, D, koͤnnten, in der Laͤnge der Zeit, aus
dieser Beruͤhrung kommen, oder durch die bedeutende Schwere der Welle, E, und ihrer Last koͤnnten sich Schwierigkeiten
in der Bewegung finden. Um diesen Nachtheil zu beseitigen, laͤßt man die
Pfanne, S, die auf den starken Bolzen, l, l, ruht, welche quer durch das hohle Fußgestell, T, laufen, auf- oder niedersteigen. Je nachdem
man naͤmlich die Bolzen-Keile, U, mit
einem Hammer tiefer ein- oder weiter zuruͤktreibt, hebt oder senkt man
die Pfanne, 8, und mit dieser zugleich die Welle, E, und
das Rad, D.
Die Zahl der Zaͤhne dieses Raͤderwerkes, welches die Bewegung von der
Dampfmaschine her der Muͤhle mittheilt, ist folgende:
1) Zahnrad, C, auf der Achse der Triebwelle, B, vier und achtzig Zaͤhne.
2) Winkelrad, D, auf der senkrechten Welle, E, zwei und siebenzig Zaͤhne.
3) Kammrad, H, hundert und sechs und dreißig
Zaͤhne
4) Triebstok, I, der Muͤhlsteine, vier und dreißig
Zaͤhne.
Das Verhaͤltniß der Geschwindigkeit der Triebwelle, B, zu den laufenden Muͤhlsteinen ist also
Textabbildung Bd. 26, S. 10
ungefaͤhr.
Da die Dampf-Maschine vier und zwanzig bis fuͤnf und zwanzig
Umdrehungen in Einer Minute macht, so wird die Triebwelle, B, waͤhrend
derselben Zeit eben so viele machen. Folglich wird die Geschwindigkeit der
Muͤhlsteine 24 × 4,66 = 111,84 Umdrehungen in Einer Minute. Die
Muͤhlsteine des Hrn. Benoist laufen in Einer
Minute hundert zehn bis hundert zwanzig Mahl um; eine Geschwindigkeit, die beinahe
doppelt so groß ist, als an den großen franzoͤsischen Muͤhlsteinen,
deren Durchmesser 5 Fuß 10 Zoll betraͤgt. Da aber die englischen
Muͤhlsteine nur 4 Fuß im Durchmesser haben, so verhalt sich ihre
Oberflaͤche, wie 1 : 2,25; woraus sich zugleich ergibt, daß man um Ein
Viertel weniger Kraft braucht, die englischen Muͤhlsteine zu bewegen, obschon
sie zweimal so schnell laufen, als die franzoͤsischen.
Alle Theile der Muͤhle des Hrn. Benoist sind so
fest als moͤglich, und bewegen sich stets in derselben Regelmaͤßigkeit
fort.
Hr. Benoist bedient sich zur Reinigung des Kornes einer
Art von Trompete (Tarare), die Hr. Gravier erfand. Sie besteht aus mehreren horizontalen Sieben und aus
Blaͤttern von Eisenblech, die wie ein Reibeisen durchloͤchert, und auf
einer Achse so aufgezogen sind, daß sie vier Fluͤgel bilden. Sie drehen sich
120 Mahl in Einer Minute. Nachdem das Korn durch die Siebe lief, faͤllt es
auf diese sich drehenden Blaͤtter, wo es durch die Schnelligkeit der Bewegung
stark geruͤttelt, und durch die Rauhigkeit des Reibeisens vollkommen
gereinigt wird. Nachdem es, noch innerhalb der Maschine, der Einwirkung eines
Faͤchers mit vier Fluͤgeln ausgesezt wurde, der sich 60 Mahl in Einer
Minute dreht, und wodurch alle Unreinigkeiten davon gejagt werden, faͤllt es
endlich gereinigt aus derselben heraus. Diese Maschine reinigt in Einer Stunde 5 bis
6 Saͤke Korn; sie ist in der 8ten Lieferung des Recueil des machines qui servent à l'économie rurale, par
Mr. Leblanc beschrieben.
Die Mehlkasten unter der Muͤhle zur Aufnahme des Mehles konnten auf den Tafeln
nicht dargestellt werden, weil sie nichts Neues in ihrem Baue darbiethen. Die Kleien
werden von dem Mehle mittelst Buͤrsten in der Beutel-Maschine
geschieden, welche bedeutende Vorzuͤge vor den gewoͤhnlichen
Beutel-Kasten besizt, sowohl in Hinsicht auf Schnelligkeit der Arbeit, als
auf die Guͤte des Produktes. Sie unterscheidet sich von der oben
erwaͤhnten Beutel-Maschine dadurch, daß die, mit Metall-Gewebe
uͤberzogenen, Trommeln sich nach Einer Seite drehen, waͤhrend die innere
Vorrichung sich nach der entgegengesezten Seite dreht. Diese Verbesserung ist
wichtig, insofern sie eine vollkommnere Scheidung der Kleie von dem Mehle bewirkt,
welches, nach seiner verschiedenen Feinheit, in verschiedene unten angebrachte
Faͤcher faͤllt. Diese Beutel-Maschine kommt allerdings theurer,
als ein Beutel-Kasten, und auch ihre Unterhaltung ist kostbarer.
Jeder Gang der englischen Muͤhle bei Hrn. Benoist
mahlt in 24 Stunden sechszehn bis achtzehn Saͤke Getreide, den Sak zu 120
Kilogramm (2 Ztr. 40 Pfd. ungefaͤhr). Wenn also alle 6 Gaͤnge zugleich
gehen, kann er 100 Saͤke des Tages mahlen. Er konnte auf seiner Muͤhle
im Jahre 40,000 Sake oder 6,000 Hektoliter Korn mahlen.
Die Graupen mahlt er auf der franzoͤsischen Muͤhle, und laͤßt
sie fuͤnf bis sechs Mahl durchlaufen, bis alles Mehl durchgezogen ist. Er
waͤhlt dazu vorzuͤglich hart und rundkerniges Korn, wie man es um
Crépy baut.
Erklaͤrung der Figuren auf Tab. I. u. II.
Tab. I. Fig. A
, zeigt die Kornmuͤhle zu St. Denis im senkrechten Durchschnitte auf
die Linie, A, B, des Grundrisses.
Tab. II. Fig. 1
u. 2. zeigt
nur drei Gaͤnge und den Mechanismus, der sie treibt.
Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Gegenstaͤnde.
A, gerades Rad aus Gußeisen, an der Trieb-Welle,
B, der Muͤhle gehoͤrig befestigt, C, Winkelrad auf derselben Welle. Die Kaͤmme
desselben sind aus hartem Holze, und in Looͤcher eingezapft, die hierzu auf
der kegelfoͤrmigen Oberflaͤche desselben vorgearbeitet wurden. D, Rad mit kegelfoͤrmigen Zaͤhnen, welches
von C, getrieben wird, und auf der senkrechten Achse,
E, der Muͤhle gehoͤrig befestigt ist.
Diese Achse ist ganz aus Eisen, und bildet ein achtseitiges Prisma. In ihrer Mitte,
in der Hoͤhe des ersten Stokwerkes, wird sie durch ein Halsband, F', festgehalten, und an dem Absaze des zweiten
Stokwerkes durch einen Muff, G, mit einer
Verlaͤngerung vereinigt, die bis an den Giebel des Daches des
Gebaͤudes reicht. H, Kammrad, dessen Zapfen
gerade und aus sehr hartem Holze sind. Es ist auf der Achse, E, aufgezogen, und greift in die Triebstoͤke, I, die auf dem Eisen der Muͤhle, J, befestigt sind.
K, ist ein festes Gestell aus Gußeisen, in welchem der
ganze Mechanismus enthalten ist. Die sechs Gaͤnge oder sechs Paare
Muͤhlsteine ruhen auf eben so viel Saͤulen, L,
L, aus Gußeisen, die auf einer festen Grundlage aus Stein, M, stehen, welche durch eiserne Baͤnder
festgehalten wird. N, N, Ruhelager aus Gußeisen, die mit
kupfernen Muscheln versehen sind, welche die Lager bilden, worin die liegenden
Wellen, B und, P, sich
drehen. O, Triebrad, welches auf der Achse, P, der Dampfmaschine aufgezogen ist, und das Rad, A, fuͤhrt. Q, Q,
hohle Saͤulen, welche den Mechanismus stuͤzen, der zum Stellen der
Muͤhle, und zur Entfernung der Muͤhlsteine von einander dient. Dieser
Mechanismus ist auf dieser Tafel nicht dargestellt, um nichts an Deutlichkeit zu
verlieren: man findet ihn auf Tab. I. – R, R. Schrauben, die in die Saͤulen, Q, Q, treten, und durch deren Beihuͤlfe man die
Hebung des Triebstokes, I, und des Eisens, J, bewirkt. S, Pfanne, die
das untere Ende der großen Welle, E, aufnimmt. T, hohles Fußgestell, in welchem diese Pfanne liegt. U, Muͤhlbottich. V,
Bruͤten zwischen den Saͤulen, L, L, die
den Eisen, J, als Stuͤzpuncte dienen.
a, Rumpf; b, Rumpfleiter;
d, Schuh; e, Triebstok
des Reibers; f, Schlaͤuche aus Leinwand, durch
welche das Korn in die Ruͤmpfe geschuͤttet wird; g, Saͤke, die sich in diese Schlaͤuche
leeren; h, Winkelrad auf der maͤnnlichen
Schraube, R, wodurch der Triebstok, I, ausgehoben wird, i,
anderes Winkelrad, wodurch die Entfernung der Muͤhlsteine hervorgebracht
wird, k, k, Drukschrauben zur Centrirung der Pfanne, S. l, l, Bolzen, die durch das Fußgestell, T, laufen, und mittelst welcher die Pfanne, S, gehoben oder gesenkt werden kann. m, staͤhlerner Wuͤrfel im Grunde der
Pfanne, auf welchem das Ende der Achse, E, sich
dreht.
Tab. II. Fig. 1
und 2.
allgemeiner Grundriß der Muͤhle, und der Muͤhlsteine.
Fig. 1.
Grundriß auf der Hoͤhe der Linie, C, D, des
Durchschnittes. Tab. I. Fig. A
.
Fig. 2.
Grundriß der sechs Gaͤnge, unter den verschiedenen Ansichten gezeichnet, die
sie darbiethen.
X, Unterlage in Form eines Dreiekes, auf welcher die
Schale der Muͤhlsteine, Y, aus Gußeisen ruht.
Diese Schale ist
ausgeraͤumt, damit sie leichter wird. Z, unterer
oder liegender Muͤhlstein.
A', oberer oder laufender Muͤhlstein. B, der Muͤhlbottich, und die Rumpfleiter von
oben. C', Ansicht des Rumpfes, a, von oben. D', Pfanne zur Aufnahme des
Zapfens des Eisens, J. Sie befindet sich auf der
Bruͤke, V.
c, gefurchte Walze, uͤber welche die
Lade-Schnur laͤuft. n, n. Schraube, die
zur Centrirung des unteren Muͤhlsteines dient. o,
o, andere Schrauben, um diesen Muͤhlstein horizontal zu stellen, p, Trichter des Auges. q.
Loch in dem Mehlbottiche. s, s, Drukschrauben, um die
Pfanne, D', zu stellen.
Tab. I. Detail dieser Muͤhlen.
Fig. 1.
senkrechter Durchschnitt durch die Achse der Muͤhlsteine, und durch den
Mechanismus, der sie treibt.
Fig. 2. die
große Schraube, R, und der Mechanismus, der sie in die
Hoͤhe treibt, einzeln dargestellt, und in einem groͤßeren Maßstabe
gezeichnet.
Fig. 3.
Kruͤke oder Krone, im Aufrisse und von oben.
Fig. 4. Gabel,
die die Kruͤke mit der Welle der Muͤhlsteine verbindet.
Fig. 5.
senkrechter Durchschnitt durch die Achse der Buͤchse.
Fig. 6.
horizontaler Durchschnitt durch die Buͤchse nach der Linie, E, F, der vorhergehenden Figur.
Fig. 7. Keil
der Buͤchse von vorne und feldwaͤrts.
Fig. 8. Bolzen
in Form einer Kruͤke, der sich in dem Keile stellt, von vorne und von der
Seite.
Fig. 9. oberes
Ende des Eisens, J.
Fig. 10.
senkrechter Durchschnitt der Pfanne, D', und der
Buͤchse, in welcher sie sich befindet.
E', kegelfoͤrmiger Theil des Eisens der
Muͤhlsteine, auf welchen der Triebstok, I, paßt,
F', Buͤgel mit Schiebern und Schrauben, die
durch die Bruͤke, V, laufen, und zum Heben des
Triebstokes, I, dienen, um ihn aus der Ebene des
Kammrades zu bringen. H', Querstuͤk, das auf den
Stangen des Buͤgels befestigt ist, und mit diesem auf und nieder steigt. I', ein anderes Querstuͤk, auf dem Schafte der
hohlen Saͤule, Q': J', Kruͤke oder Krone;
K', Gabel, welche die Kruͤke oder Krone des
Eisens, J, vereinigt. L',
Buͤchse. M', Keil, um die Widerlage der
Buͤchse anzuziehen. N', Kruͤkenbolz, der
in den Keil tritt. O', Reiber.
t, Ladeschnur, u, Zunge des
Kegels, E', um den Triebstok, I, mitzuziehen, was mittelst correspondirender Furchen geschieht, die in
den Mittelpunct des Triebstokes eingegraben sind. v,
Mutterschraube, um den Bolzen, N', zu ziehen, und den
Keil der Buͤchse anzutreiben, x, Kurbel, um das
Winkelrad, h, mittelst des Triebstokes, y, zu drehen. z,
Mutterschraube des Rades, h, die laͤngs der
Schraube, R, auf und nieder steigt.
a', Triebstok, der das Winkelrad, i, fuͤhrt. Es ist auf einer Achse aufgezogen, die ein vierekiges
Stuͤk, b', fuͤhrt, an welchem eine Kurbel
angebracht ist. c', Sperrrad auf dieser Achse. d', Sperrkegel. e',
weibliche Schraube des Rades, i. f', Widerlage der
Buͤchse. g', Werk, welches in Oehl getaucht ist,
um das Eisen, J, zu schmieren. h', Stuͤk mit einem kreisfoͤrmigen Dekel, das uͤber
die Buͤchse koͤmmt. i, Hut, durch welchen
das vierekige Stuͤk des Eisens, J, durchzieht,
und der von demselben fortgezogen wird. Er hat einen Rand, der den hervorspringenden
Theil des Stuͤkes, h', bedekt, und hindert, daß
der Staub nicht in die Buͤchse kommt. k',
Hoͤhlung in der Kruͤke oder Krone, die das zugerundete Ende des
Eisens, J, aufnimmt. l',
hervorragendes vierekiges Stuͤk, auf welches der Reiber, O', paßt.' m', m',
vierekiges Loch der Gabel, durch welches der vierekige Theil des Eisens, J, durchzieht. n', n'. Einschnitte, in welche die beiden Arme der
Kruͤke sich einsenken. o' Buͤchse, in
welcher die Pfanne, D', auf- und
niedersteigt.Wir haben die im Bulletin de la
Société gegebenen Abbildungen dieser Muͤhle
mit der groͤßten Genauigkeit wieder gegeben, damit wohlhabende
Muͤhlenbesizer nach diesen Abbildungen ihre Muͤhlen verbessern
lassen koͤnnen. Die Muͤhlen in Nieder-Bayern
beduͤrfen gar sehr einer Reform; nur in Ober-Bayern (im
Oberlande) hat man schoͤnes Mehl, und selbst dieses ist nicht so
schoͤn, wie das sogenannte Salzburger-Mehl. Ist es nicht traurig, daß in dem Lande, in
welchem der herrlichste Weizen in ganz Europa gebaut wird, die Kunst aus
demselben Mehl zu bereiten, so sehr vernachlaͤßigt ist, daß man sogar
aus jenem Lande, das seinen Weizen aus Bayern holt, das seine Mehl muß
kommen lassen, wenn man fuͤr seine Kinder gesunden Mehlbrei, oder
fuͤr seinen Tisch schmakhaftes Bakwerk bereiten will? Es ist aber nun
wirklich so. Ja, was noch mehr ist, wenn irgend ein verstaͤndiger
Muͤller des Oberlandes sein feines schoͤnes Mehl in einer
Stadt des Unterlandes verkaufen will, wo man oft Mist fuͤr Mehl hat,
so darf er
dieß nicht. Nicht einmahl feine Perlgraupen und Hafergruͤze
koͤnnen die bayer'schen Muͤller machen: die Wirtemberger
versehen ganz Bayern mit dem sogenannten Ulmer-Gerstel und mit
Haber-Kern, und es gehen Tausende von Thalern jaͤhrlich
dafuͤr in's Ausland. Woher kommt dieß? Die Soͤhne der
Muͤller, die fast alle wohlhabende Vaͤter haben,
schaͤmten sich in Bayern, und schaͤmen sich noch,
Muͤller zu bleiben; sie wurden in fruͤheren Zeiten,
Moͤnche, und jezt Juristen, um Richter und Raͤthe werden zu
koͤnnen. In Bayern studirt der Sohn des Muͤllers nicht
Mechanik, um das Muͤhlwerk seines Vaters, als kuͤnftiger
Besizer desselben, zu verbessern; er lernt Messe lesen, oder die Pandekten
aufschlagen, oder bleibt hoͤchstens dann beim Handwerke, wenn er
nicht so viel Talent in sich verspuͤrt, als zum Treiben jener freien
Kuͤnste noͤthig ist. So blieben und bleiben, (eine Menge
Ursachen, die der Verbesserung der Muͤhlen von Seite des
Muͤhlen-Rechtes [oder vielmehr Unrechtes] im Wege stehen, hier
unberuͤhrt gelassen), die Muͤhlen in Bayern immer in jenem
Zustande, in welchem sie im grauen Alterthume waren. Die
oͤsterreichische Regierung erkannte die Wichtigkeit der Verbesserung
der Muͤhlenwerke sehr gut, obschon ihre Muͤhlen besser sind,
als die bayerischen, und schrieb den bekannten hohen Preis auf das beste
Modell einer Muͤhle aus, der in diesem Jahre vertheilt, werden soll.
Die großen Vervollkommnungen des Muͤhlenwesens in Preußen sind unsern
Lesern bereits bekannt. Bei uns wurden die physischen und mathematischen,
und technischen Wissenschaften bisher zu sehr vernachlaͤßigt, und
sind auch noch jezt zu sehr vernachlaͤßigt, als daß das Land sich
eines Vortheiles von dem unzureichenden Betriebe derselben erfreuen
koͤnnte.A. d. Ueb.