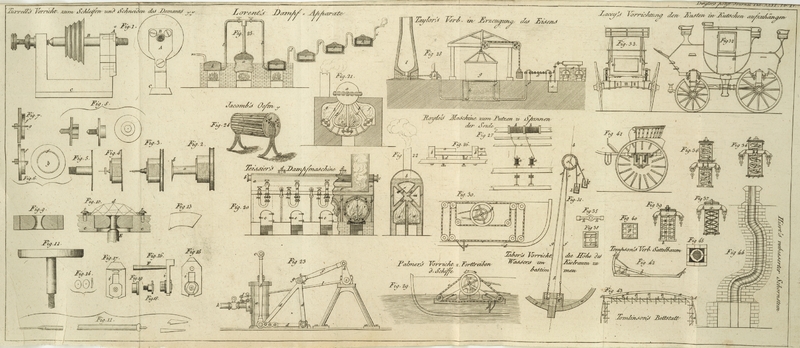| Titel: | Verbesserung an Dampfmaschinen, worauf Joh. Ant. Teissier, Gentleman, Tottenham Court Road, Middlesex, sich in Folge einer Mittheilung eines Fremden am 15. September 1825 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 26, Jahrgang 1827, Nr. XLVII., S. 194 |
| Download: | XML |
XLVII.
Verbesserung an Dampfmaschinen, worauf Joh. Ant. Teissier, Gentleman,
Tottenham Court Road, Middlesex, sich in Folge einer Mittheilung eines Fremden am 15. September 1825 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Jul. 1827. S.
247.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Verbesserung an Dampfmaschinen.
Einige dieser Verbesserungen betreffen den Bau des Kessels, in
welchem der Dampf erzeugt wird; die anderen beziehen sich auf eine einfachere
Einrichtung der Maschine sowohl fuͤr Dampfbothe als zu anderem Dienste.
An dem Kessel sind gewisse bereits bekannte und benuͤzte Vorrichtungen
angebracht, wie man aus James's und Curney's Patent (Polytechn. Journ. Bd.
XXI. S. 158.), sich erinnern wird, zum Theile aber auch auf eine neue
Weise benuͤzt.
Fig. 20.
stellt den Kessel dar, der hier im Durchschnitte gezeichnet ist, um den inneren Bau
desselben zu zeigen. a, a, a, ist der obere Theil des
Kessels oder wagenfoͤrmigen Gefaͤßes, in welchem der Dampf sich
sammelt. b, ist die Roͤhre, durch welche das
Wasser in den Kessel geleitet wird, welches vorlaͤufig in einem
Nebengefaͤße erhizt werden soll, und in einer bedeutend hohen Temperatur
heruͤber gepumpt wird, damit keine Verdichtung Statt hat. c, ist die Roͤhre, welche den Dampf aus dem
Kessel in die Maschine leitet. d, d, sind
Sicherheits-Klappen an dem oberen Theile des Kessels, wie gewoͤhnlich
mit Hebeln versehen, auf welchen Gewichte ruhen.
Es werden hier mehrere einzelne Oefen unter dem Kessel angebracht, jeder mit
Roͤhren umgeben, welche Wasser enthalten, und mit dem Kessel, a, mittelst Schraubengefuͤgen und
Sperrhaͤhnen so verbunden sind, daß jeder dieser Oefen mit seinem
Roͤhren-Systeme außer Gang gesezt werden kann, ohne daß die
uͤbrigen Theile des Kessels dabei in ihrer Arbeit unterbrochen
wuͤrden. Die Thuͤren der verschiedenen Oefen sind bei e, dargestellt: durch diese wird geheizt, f, f, ist einer dieser Oefen im Durchschnitte, um seinen
inneren Bau zu zeigen. g, g, g, sind parallele Kammern
aus Eisenblech an den Seiten des Ofens und oben uͤber demselben: diese
Kammern sind mit Wasser gefuͤllt, und stehen unter einander in Verbindung, so
wie auch mit dem Kessel, und zwar durch die gekruͤmmten Roͤhren, h, h, h.
Jeder Ofen ist mit einer Reihe ringfoͤrmiger Roͤhren, i, i, umgeben, welche in. horizontale Roͤhren,
k, k, an dem oberen und unteren Theile des Ofens
eingefuͤgt sind. Diese Roͤhren sind Roststangen, auf welchen das
Feuermaterial ruht, und zwischen welchen die Luft durchzieht, welche dasselbe
brennend erhaͤlt. Eine senkrechte Roͤhre, l, an der hinteren und vorderen Seite eines jeden Ofens stellt eine freie
Verbindung zwischen den oberen und unteren Roͤhren, k,
k, her, und die Roͤhren, m, n, bilden,
wenn sie mit den oberen Roͤhren, k, in Verbindung
stehen, eine Verbindung zwischen den Ofen-Roͤhren, i, dem Gefaͤße, a.
Das Wasser hat nun freien Durchzug durch alle Roͤhren und Kammern, und da es
in denselben, in unmittelbarer Beruͤhrung mit dem Ofen, kocht, zieht sich der
Dampf in den oberen Theil des wagenfoͤrmigen Gefaͤßes, a, hinauf, und geht von da durch die Roͤhre,
c, in den arbeitenden Cylinder der Maschine.
Um die ringfoͤrmigen Roͤhren-Systeme zu reinigen, oder,
noͤthigen Falles, auszubessern, werden die Sperrhaͤhne oben an den
Roͤhren, m, und, n,
geschlossen, wo dann die Verbindungs-Gefuͤge abgeschraubt werden
koͤnnen, und der Ofen mit seinem ganzen Roͤhren-Systeme aus dem
Kessel genommen werden kann, wodurch die uͤbrigen Oefen in ihrem Gange nicht
unterbrochen werden, sondern den Kessel, wie gewoͤhnlich, fort Dampf erzeugen
lassen: freilich jezt in einer geringeren Menge, weil ein Ofen weniger arbeitet, o, o, sind Reife mit Laͤngen-Stangen, die
um ein Roͤhren-System angebracht sind, und eine Art von Wiege oder
Gestell bilden, wodurch die Roͤhren gestuͤzt und geschuͤzt
werden. Da diese Reife in der Mitte Gewinde haben, so laͤßt sich dieses
Gestell daselbst oͤffnen, und die Roͤhren koͤnnen
herausgeschafft werden. Der Rauch und die Daͤmpfe des Brennmateriales ziehen
ruͤkwaͤrts an den Oefen hin, steigen aufwaͤrts und gelangen in
den Zug, p, der eine ganz vom Wasser umgebene
Roͤhre in dem oberen Theile des wagenfoͤrmigen Kessels ist, theilen
daselbst noch ihre Hize dem Wasser mit, und ziehen endlich durch den Schornstein
hinauf. Diese Form von Kesseln wird vorzuͤglich fuͤr Dampfbothe
empfohlen.Sie ist aber viel zu zusammengesezt. A. d. Ueb.
Eine Abaͤnderung der obigen Vorrichtung, die aber weit einfacher ist, zeigt
der Durchschnitt des Kessels in Fig. 21. a, ist hier das Haupt, oder der
Dampf-Behaͤlter, bestehend aus einem walzenfoͤrmigen
Gefaͤße, aus welchem zwei Seitenkammern unter einem Winkel herabsteigen, b, b, und sich in die Roͤhren, c, c, enden. Eine Reihe von gekruͤmmten
Roͤhren, d, d, laͤuft von dem oberen
Gefaͤße, a, herab, und tritt unten in die
Central-Roͤhre, d. Der Ofen ist innerhalb,
bei e, e, und die Flammen laufen zwischen den
Roͤhren, schlagen an die unteren Flaͤchen der Kammern, b, b, an, und werfen die Hize auf die Roͤhren
zuruͤk.
Der Rauch und die Daͤmpfe des Brennmateriales ziehen innenwendig durch den
Ofen, drehen sich am Ende um, laufen durch den Zug, f,
dann rings um die Vorderseite herum, und laͤngs dem Zuge, g, hizen so die aͤußere Flaͤche der
Kammern, b, b, und entweichen dann durch den
Schornstein. Da die Gesaͤße alle voll Wasser sind, so wird dieses in demselben bald
kochend, und der entwikelte Dampf sammelt sich oben, und wird von da durch eine
Roͤhre in den Cylinder der Maschine geleitet.
Fig. 22.
zeigt einen anderen Kessel, in welchem man auch Seewasser brauchen kann, von
wagenfoͤrmiger Gestalt und im Durchschnitte, a,
a, ist der Ofen in dem Inneren desselben; b, das
wagenfoͤrmige Haupt oder der Dampfbehaͤlter oben. c, c, sind parallele Kammern an den Seiten, durch welche
das Wasser fließt. d, d, sind parallele
Durchgaͤnge, die von oben bis auf den Boden des Kessels hinablaufen. e, ist eine senkrechte Kammer, die mitten
durchlaͤuft. Diese Kammern sind alle mit Wasser gefuͤllt, welches
durch den innerhalb angebrachten Ofen kochend gemacht wird: die Flamme und der Rauch
laufen zwischen den Kammern durch und um dieselben herum, wie die Pfeile zeigen, und
entweichen endlich durch den Schornstein. Bei dieser Einrichtung des Kessels gleitet
das Salz, welches durch das Kochen des Seewassers gebildet wird, an den Seiten der
diagonalen Durchgaͤnge, d, d, herab, und
faͤllt auf den Boden des Gefaͤßes, c,
unter das Feuer, kuͤhlt sich daselbst ab, und kann gelegentlich
herausgeschafft werden, indem man das Wasser abzieht, und die Thuͤrchen an
den Enden oͤffnet. Auf diese Weise wird das verderbliche Anlegen des Salzes
vermieden.
Die Verbesserung an der Maschine ist Vereinfachung des Baues, durch
Veraͤnderung der Form und Lage der Stangen, Hebel und des Gestelles, auf die
Art, wie in Fig.
23. a, ist der arbeitende Cylinder; b, eine Kehrstange, die mittelst einer Querstange, c, oben mit der Staͤmpelstange, und unten mit dem
dreiekigen Hebel, d, d, in Verbindung gebracht wird. Die
Stoͤße des Staͤmpels machen, daß der dreiekige Hebel, d, sich um sein unteres Ende schwingt, und, da mit
diesem dreiekigen Hebel noch eine Stange durch das Gefuͤge, g, in Verbindung steht, welche zugleich mit der Kurbel,
h, auf der Hauptachse, i, in Verbindung ist, so erzeugt das Auf- und Niedersteigen des
Staͤmpels eine drehende Bewegung an der Hauptachse.
Auf diese Weise wird nun das an der Achse, i, befestigte
Ruder-Rad getrieben, oder was immer durch diese Achse in Umtrieb gesezt
werden soll.
Der Dampf wird dem Cylinder durch die Roͤhre, k,
zugefuͤhrt, die
aus einem Kessel herlaͤuft; die Ein- und Auslaß-Klappen werden
durch die Stange, l, getrieben, die durch einen
excentrischen Daͤumling auf der Hauptachse, i,
hin und her geschoben wird.
Tafeln