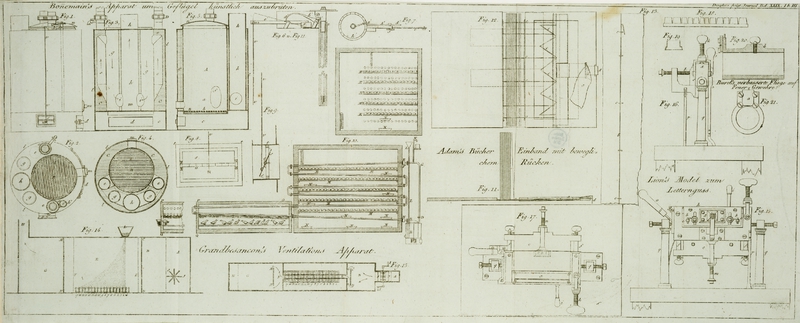| Titel: | Ueber den Ventilationsapparat zur Scheidung der Erze von ihrer Gangart, welchen Hr. Grandbesançon, Commissaire des poudres zu Lyon, erfunden hat. |
| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. XX., S. 89 |
| Download: | XML |
XX.
Ueber den Ventilationsapparat zur Scheidung der
Erze von ihrer Gangart, welchen Hr. Grandbesançon, Commissaire des
poudres zu Lyon, erfunden hat.
Aus dem Bulletin de la Société d'
Encouragement, N. 284, S. 46.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Grandbesançon's Ventilationsapparat.
Hr. Héricart de Thury erstattete im Namen des Ausschusses der
mechanischen Kuͤnste folgenden Bericht uͤber Hrn. Grandbesançon's Ventilator zur Scheidung der Erze
von ihrer Gangart.
„Hrn. Grandbesançon's Apparat beruht auf
folgenden Grundsaͤzen:
1) Wenn zwei Koͤrper von gleichem Umfange, aber von verschiedener Dichtigkeit,
der Wirkung der Schwere uͤberlassen sind, und von derselben Hoͤhe in
einem ruhigen Mittel fallen, so wird der schwerere dem leichteren im Falle bald
voraus seyn, und dieser wird dem Widerstande des Mittels eine laͤngere Zeit
uͤber ausgesezt seyn.
2) Wenn das Mittel, in welchem diese Koͤrper fallen, in Bewegung ist, so wird
es ihnen einen Theil seiner Bewegung mittheilen, und in den ersten Augenbliken
dieser Mittheilung werden die durchlaufenen Raͤume sich beinahe umgekehrt wie
die Massen, und gerade wie die Quadrate der Zeiten verhalten, die jeder derselben
zum Falle von derselben Hoͤhe noͤthig hat.
3) Koͤrper von demselben Umfange und von derselben Dichtigkeit koͤnnen
verschiedene Bewegungen besizen, wenn sie der Schwere uͤberlassen sind und
unter dem beschleunigten Einfluͤsse eines Luftstromes stehen; derjenige aber,
der die groͤßte Oberflaͤche darbietet, oder der platt oder schuppig
ist, wird der Einwirkung der Luft am meisten ausgesezt seyn; er wird weniger schnell
fallen und wird weiter geworfen werden, als der, der eine kugelige oder
wuͤrfelfoͤrmige Form hat.
4) Koͤrper von gleicher Dichtigkeit und aͤhnlicher Form erleiden, wenn
sie der Schwere und der Einwirkung eines Luftstromes ausgesezt sind, nicht dieselbe
Bewegung, weil ihre Oberflaͤchen nicht in demselben Verhaͤltnisse
stehen, wie ihre Massen, und weil die Einwirkung der Luft, sowohl als aufhaltende,
wie als beschleunigende Kraft, mit den Oberflaͤchen dieser Koͤrper im
Verhaͤltnisse steht, und nicht mit ihren Massen. Auch steht man sehr dichte
in Staub verwandelte Koͤrper von dem Winde weit wegwehen, weil ihre
Oberflaͤchen im Verhaͤltnisse zu ihren Massen sehr groß sind.
5) Da ein Koͤrper, der weniger dicht ist, mehr Zeit zu seinem Falle braucht,
und der Raum, den er waͤhrend dieser Zeit durchlaͤuft, wenn ein Luftstrom
waͤhrend derselben auf ihn wirkt, groͤßer ist, so werden zwei gleiche
Koͤrper von verschiedenen Dichtigkeiten auf eine horizontale Flaͤche
in desto groͤßerer Entfernung von einander fallen, als der Punct, voll
welchem sie zu fallen anfingen, von dieser Flaͤche mehr entfernt ist.
Diese Grundsaͤze, nach welchen Hr. Grandbesançon seinen Ventilationsapparat einrichtete, sind
dieselben, nach welchen uͤberhaupt alle Maschinen, die zugleich
puͤlvern und Koͤrper von verschiedener Dichtigkeit absondern sollen,
eingerichtet sind; nach denselben Grundsaͤzen, aber mit den noͤthigen
Abaͤnderungen, sind auch jene Maschinen gebaut, mit welchen man mittelst der
laufenden Kugel puͤlvert, mittelst einzelner Cylinder oder mittelst
Muͤhlsteinen zerreibt und puͤlvert; die greniers ventilateurs des Duhamel, die
Pulverisir- und Ventilirpochwerke des Auger, und
uͤberhaupt alle Siebe und Beutelmaschinen.
Der Ventilationsapparat des Hrn. Grandbesançon's
scheint uns vor allen diesen Maschinen wesentliche Vorzuͤge zu besizen,
insofern es sich um Behandlung gewisser Arten kostbarer Erze handelt, die man mit
der Waschmulde und auf dem Pochwerke nicht behandeln kann, mit welchen man eine
bedeutende Menge dieses Metalles verloͤre, die von dem Wasser fortgerissen
werden wuͤrde, z.B. bei den Silbererzen von Chalanches d'Allemont im Dpt. de
l'Isère, wo das Silber, sowohl gediegen als in verschiedenen Verbindungen, so
sehr in Braunstein-, Kobalt-, Nikel-, Zink- etc. Oxyden
zerstreut und in erdartigen und steinigen Gangarten eingesprengt ist, daß es
unvermeidlich mit diesen lezteren bei dem Waschen von dem Wasser fortgerissen werden
wuͤrde.
Der Apparat des Hrn. Grandbesançon's ist sehr
einfach. Er besteht aus drei bis vier neben einander befindlichen Kammern. In der
ersten, Fig.
14., ist ein Ventilator, J, oder eine
Windmuͤhle mit einer Kurbel, deren Bewegung, die durch was immer fuͤr
eine Triebkraft erzeugt werden kann, sich nach der verschiedenen Groͤße des
Erzes richtet.
Die zweite Kammer ist ein Behaͤlter fuͤr die durch den Ventilator
zusammengedruͤkte Luft.
In der dritten Kammer, K, in welcher sich die Erze
befinden, ist ein Canal, E, F, durch welchen ein
gleichfoͤrmiger Luftzug hergestellt wird, was mittelst der Scheidewand, C, D, geschieht, die den Luftstrom von seinem Austritte
aus dem Ventilator her hindert gerade in den Canal einzudringen, in welchem er
schaͤdliche Wirbel erzeugen wuͤrde. Von dieser Scheidewand, C, D, sagt Hr. Grandbesançon, haͤngt das ganze Gelingen des Apparates
ab.
An der Deke der dritten Kammer befindet sich ein Rumpf, L, durch welchen man die gepochten Erze, nachdem sie durch das Drahtsieb
gelaufen sind, einschuͤttet.
Auf dem Boden dieser Kammer befinden sich mit Nummern (1–17) bezeichnete
Faͤcher mit Schubladen, in welche die Erze und ihre Gangarten fallen, je
nachdem ihre Dichtigkeit und die Wirkung des Luftstromes des Ventilators verschieden
ist.
Dieser Luftstrom sezt endlich in der lezten Kammer, G,
die von der Erzkammer durch die Scheidewand, M, N,
getrennt ist, die Metalltheilchen ab, die er fortgerissen haben konnte, und verliert
sich durch den Schornstein, H.
Nach dem, was wir waͤhrend unseres langen Aufenthaltes an den Huͤtten
zu Allemont gesehen, und nach den Versuchen, die wir nach und nach mit den Erzen zu
Chalanches angestellt haben, koͤnnen wir nicht zweifeln, daß der Apparat des
Hrn. Grandbesançon's nicht mit Vortheil bei diesen
Erzen angewendet wird; denn diese Erze koͤnnen, wie wir oben bemerkten, nur
troken gepocht werden, und fordern, da man die haͤufigen gepuͤlverten
Gangarten nicht von denselben trennen kann, eine unendliche Menge Holz, und
vertheuern alle uͤbrigen metallurgischen Arbeiten.
Wir sind auch der Meinung des Hrn. Grandbesançon's,
daß sein Apparat eine gute Wirkung bei der Bereitung jener silberhaltigen Bleierze
haben kann, die mit quarzigen, kalkigen und thonigen Gangarten gemengt sind; wir
getrauen uns aber nicht mit ihm zu behaupten, daß derselbe auch bei solchen Erzen in
Schwerspathgaͤngen mit Vortheil angewendet werden kann, indem der Unterschied
zwischen den specifischen Schweren zu gering ist.
Hr. Grandbesançon bemerkt, daß er
gegenwaͤrtig mit einer Maschine beschaͤftigt ist, die die Stelle der
Pochwerke vertreten soll, und die aus zwei Cylindern aus weißem Gusse besteht, die
seicht gefurcht sind, und wie die Walzen an Strekwerken sich von einander entfernen
und einander sich naͤhern lassen. Er betrachtet den einen dieser Cylinder,
der sehr schnell laͤuft, als einen Hammer, der bestaͤndig
fortarbeitet, und der nur soviel Kraft aͤußert, als noͤthig ist, um
auf den zweiten Cylinder zu wirken, der sehr langsam laͤuft und al Amboß
dient. Die ersten Versuche scheinen ein vollkommenes Gelingen zu versprechen;
indessen muß man noch den weiteren Erfolg erwarten.
Sein Ventilationsapparat scheint uns auch noch zu anderen Arbeiten, nicht bloß zur
Scheidung der Erze allein, und uͤberhaupt dort, wo es um Behandlung fein
gepuͤlverter Stoffe zu thun ist, mit Nuzen gebraucht werden zu
koͤnnen.
Erklaͤrung der Figuren 14 und 15 auf
Tab. III.
Fig. 14.
Durchschnitt des Ventilationsapparates des Herrn Grandbesançon's zur Scheidung der Erze von ihren Gangarten.
Fig. 15.
Grundriß im Durchschnitte uͤber dem Ventilator.
A, Kammer mit einer Windmuͤhle oder einem
Faͤcher mit 8 Fluͤgeln, dessen Geschwindigkeit sich nach der
Groͤße des gepochten Erzes richtet.
B, Kammer, in welcher die Luft durch diesen
Faͤcher zusammengedruͤkt wird.
E, F, Canal, in welchem sich ein gleichfoͤrmiger
Luftstrom herstellt, und zwar mittelst des Brettes, C,
D, welches von der Kammer, B, her, den
unmittelbaren Eintritt desselben in diesen Canal hindert, wo sich schaͤdliche
Wirbel bilden wuͤrden.
G, Kammer, in welche die Luft bei ihrem Austritte aus
dem Canale, E, F, sich mit verminderter Geschwindigkeit
begibt.
H, Schornstein, durch welchen die Luft entweicht.
Die Luft, die aus dem Canale, E, F, austritt,
fuͤhrt die Erzblaͤttchen mit sich fort; sie fallen in der Kammer, G, nieder, nachdem sie auf das Brett, M, N, gestoßen sind. Die leichtesten fallen in den
Schornstein, H, zuruͤk.
I, Ventilator oder Faͤcher.
J, Kurbel, durch welche dieser Faͤcher oder die
Windmuͤhle in Bewegung gesezt wird.
K, Dritte oder Erzkammer.
L, Rumpf, in welchen das gepochte Erz geschuͤttet
wird, nachdem es vorlaͤufig durch Siebe oder durch einen Cylinder aus
Drahtgewebe in Stuͤke von gleicher Groͤße geschieden wurde.
1, 2, 3, 4–17, Faͤcher mit Schubladen, in welche die Erze b', wirkt. Die vierekige Roͤhre laͤuft
durch eine gleichfalls vierekige und Gangarten fallen. (Hrn. v. Ossezky's Metallabsonderungsmaschine ist weit einfacher
und vortheilhafter, als der hier beschriebene Ventilationsapparat. Vergl. polyt.
Journ. B. XXVIII. S. 480. D. R.)
Tafeln