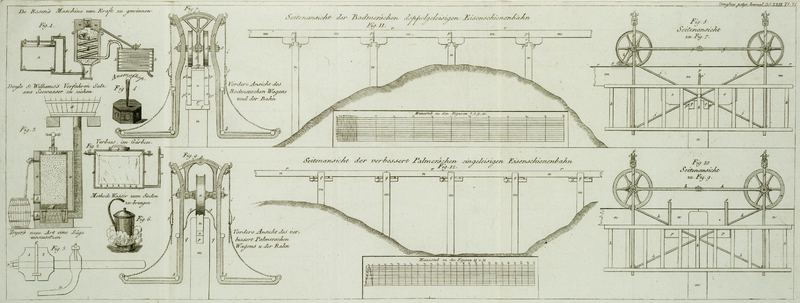| Titel: | Neue Maschine, um Kraft zu gewinnen, auf welche Graf Adolph Eugen de Rosen, Princes Street, Cavendish Square, Middlesex, in Folge einer Mittheilung eines im Auslande wohnenden Fremden sich am 1. August 1826 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. LXII., S. 241 |
| Download: | XML |
LXII.
Neue Maschine, um Kraft zu gewinnen, auf welche
Graf Adolph Eugen de Rosen,
Princes Street, Cavendish Square, Middlesex, in Folge einer Mittheilung eines im
Auslande wohnenden Fremden sich am 1. August
1826 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Junius 1828. S.
156.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
[Neue Maschine, um Kraft zu gewinnen.]
Der Zwek dieser Maschine ist Luft zu erhizen, welche dann in
Folge ihrer Expansionskraft einen Staͤmpel eben so treiben soll, wie der
Dampf in einer Dampfmaschine den Staͤmpel treibt; dieser Apparat kann auch
zur Erhizung des Wassers und Dampferzeugung aus demselben verwendet werden.
Fig. 1. ist
ein Durchschnitt dieses Apparates, in welchem, a, ein
walzenfoͤrmiges Gefaͤß ist, das als Geblaͤse dient, und in
welchem, b, ein Staͤmpel ist, der auf irgend eine
bequeme Weise bewegt werden kann. Dieses Gefaͤß hat zwei Klappen, welche sich
nach einwaͤrts bewegen, c, c, und die Luft in
dasselbe eindringen lassen. d, d, d, ist eine
Roͤhre, die sowohl uͤber als unter dem Staͤmpel aus dem
Gefaͤße, a, ausleitet, und deren
Muͤndungen mit Klappen versehen sind, die sich nach auswaͤrts
oͤffnen, e, e. Das andere Ende der Roͤhre,
d, steht mit dem Ofen, f,
f, unter dem Roste des Feuerherdes in Verbindung.
Der Ofen ist ein walzenfoͤrmiges Gefaͤß von einem Mantel umgeben zur
Vermeidung der strahlenden Hize: der untere Theil desselben ist bei, g, verengt, wo die Aschengrube ist, und unten luftdicht
geschlossen. Die schlangenfoͤrmige Roͤhre, h,
h, windet sich in dem Inneren des Ofens umher, und ist also in Flammen
eingehuͤllt. Das Brennmaterial wird durch eine Buͤchse, i, oben eingeschuͤttet, und hat zwei Schieber, um
die Kohlen nur in geringen Mengen nachfallen zu lassen.
Wenn nun der Staͤmpel, b, des Geblaͤses,
a, auf und nieder geschoben wird, gelangt die Luft
in das Gefaͤß, a, abwechselnd durch eine der
Klappen, c, c, d.h. sie tritt bei jener Klappe ein, von
welcher der Staͤmpel zuruͤk weicht, und wird zugleich an dem Ende des
Gefaͤßes, dem der Staͤmpel sich naͤhert, durch eine der
Klappen, e, e, und durch die Roͤhre, d, ausgetrieben, und durch diese Roͤhre in den Ofen unter dem Roste
eingeblasen.
Die obere Oeffnung der Roͤhre, h, hat eine
trompetenfoͤrmige Muͤndung, und steht beinahe in der Mitte des Ofens,
und der heiße Luftstrom, der auf die oben beschriebene Weise durch das Feuer hinauf
fuhr, tritt in seinem erhizten Zustande in diese Roͤhre, durchlaͤuft
dieselbe, wird in ihr noch mehr erhizt, und tritt an dem entgegengesezten Ende
derselben aus dem Ofen.
Die so erhizte Luft kann nun, als elastischer Koͤrper, einen Staͤmpel
in einem Cylinder eben so gut treiben, wie der Dampf in einer gewoͤhnlichen
Dampfmaschine, oder kann, wie in der Figur, in einen geschlossenen Kasten getrieben
und dort zur Dampferzeugung verwendet werden.
Dieser Kasten, k, k, kann aus Gußeisen, oder aus irgend
einem anderen brauchbaren Materiale verfertigt werden. Er hat in der Mitte eine
Menge von Buͤhnen, die ihn beinahe ganz durchschneiden, und oben eine Kammer,
l, welche durch die Roͤhre, m, mit Wasser versehen wird, das in einem oben auf dem
Kessel angebrachten Behaͤlter, n, n, steht.
Nachdem die Kammer, l, auf diese Weise gefuͤllt
wurde, wird das Wasser mittelst einer Pumpe in kleinen Quantitaͤten in den
Kasten, k, getrieben, wo es auf die obere Buͤhne
faͤllt, und von dieser nach und nach auf die unteren Buͤhnen
hinabtraͤufelt, und durch die heiße Luft in Dampf verwandelt wird, welcher
durch die am Boden des Kastens befindliche Roͤhre, p, zum Treiben einer Dampfmaschine oder zu irgend einem anderen Zweke
ausgeleitet werden kann.Wir zweifeln sehr, daß die heiße Luft je eine Maschine treiben wird, und
wundern uns, wie das London Journal dieses
Patent ohne alle Bemerkung in die Welt schiken konnte. A. d. U.
Tafeln