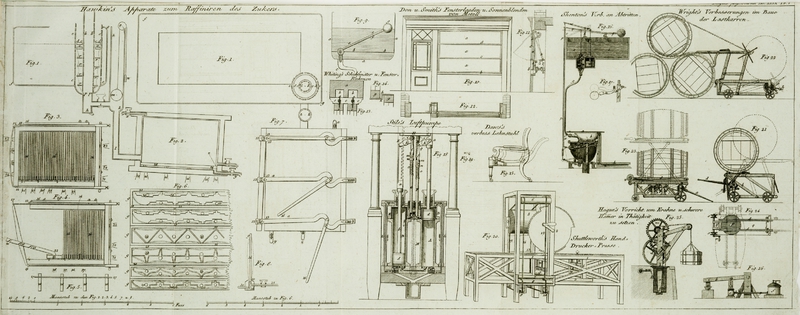| Titel: | Gewisse Verbesserungen an Abtritten, worauf Joh. Snelson Shenton, Glaser und Bleiröhren-Verfertiger zu Husbands Bosworth, Leicestershire, sich am 12. Juli 1827 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. LXXIII., S. 263 |
| Download: | XML |
LXXIII.
Gewisse Verbesserungen an Abtritten, worauf
Joh. Snelson Shenton,
Glaser und Bleiroͤhren-Verfertiger zu Husbands Bosworth, Leicestershire,
sich am 12. Juli 1827 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Mai 1828. S.
84.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Shenton's Verbesserungen an Abtritten.
Diese Verbesserungen bestehen in einer Vorrichtung, wodurch
die Klappen eines Abtrittes sich offnen und schließen, so wie die Person sich auf
denselben sezt und von demselben aufsteht; sie bilden also einen sich selbst
reinigenden Abtritt, d.h., der Unrath wird aus dem Beken hinausgeschafft, sobald
irgend Jemand auf dem Abtritte war, und eine zur Verhuͤtung von allem
Gestanke hinlaͤngliche Menge Wassers wird in das Beken eingelassen und in
demselben erhalten, ohne daß man wie bei den uͤbrigen „(bisher nur
in England)“ gewoͤhnlichen Abtritten erst einen Griff oder
einen Hebel zu ziehen braucht. Auf diese Weise bleibt also das Beken immer rein, und
das in dem unteren Theile desselben enthaltene Wasser verhindert alles Aufsteigen
uͤbler Geruͤche aus dem darunter befindlichen Schlauche.
Fig. 16.
zeigt die Einrichtung dieses verbesserten Abtrittes. a,
ist der Siz desselben mit weggenommenem Seitenbrette, damit man den darunter
angebrachten Mechanismus deutlich sieht. b, ist das
Beken, unten, wie gewoͤhnlich, mit einer Pfanne, mit einem Teller oder mit
einer Klappe versehen. c, ist das Gefaͤß, in
welches der Unrath aus dem Beken, b, kommt, und, d, ist die Roͤhre, durch welche derselbe in den
Schlauch faͤllt, e, ist der
Wasserbehaͤlter (im Durchschnitte), welcher irgendwo uͤber dem
Abtritte angebracht ist. Das Wasser laͤuft durch die Dienstbuͤchse,
f, und durch die Roͤhre, g, in das Beken.
Wenn nun Jemand auf das Brett, h, tritt, oder sich auf
dem Size, a, niedersezt, so wird die rechtwinkelige
Stange, i, i, niedergedruͤkt, indem sie sowohl an
dem Size, a, als an dem Fußbrette, h, befestigt ist. Da diese Stange, i, i, aber zugleich mittelst eines Gewindes mit dem
kuͤrzeren Arme des Hebels, k, in Verbindung
steht, so wird sie den laͤngeren Arm des Hebels, k, durch ihr Herabsteigen in die Hoͤhe heben, indem dieser Hebel
sich um, l, als um seinen Stuͤzpunct dreht, und dadurch folgendes
Spiel in dem Mechanismus dieses Abtrittes erzeugen.
Durch das Aufsteigen des laͤngeren Armes des Hebels, k, wird die Stange, l, gehoben, welche eine
kleine Klinke, m, fuͤhrt. Das untere Ende dieser
Klinke wird dadurch, daß die Stange, l, gehoben wird,
gleichfalls gehoben, und wirkt dadurch auf das Ende oder den Schnabel des Hebels,
n, der sich um den Stuͤzpunct, 2, dreht;
diese Bewegung ist nur eine vorbereitende Bewegung, um die Pfanne oder die Klappe
unten an dem Beken zu oͤffnen, wenn der Hebel, k,
mit der Stange, l, wieder niedersteigt. Man sieht diesen
Mechanismus in einem groͤßeren Maßstabe in Fig. 17.
Das Erste, was durch das Niedersinken des Sizes, a, und
des Fußbrettes, h, geschieht, wenn irgend Jemand darauf
sizt oder steht, ist, daß Wasser aus dem Behaͤlter, e, in die Buͤchse, f, laͤuft,
und zwar auf folgende Weise. Wenn die Stange, i, i, mit
dem Size und mit dem Fußbrette niedersteigt, so hebt sie den laͤngeren Arm
des Hebels, k, auf die bereits beschriebene Weise.
Dieser laͤngere Arm ist aber mittelst einer Kette mit dem Ende des Hebels,
o, verbunden (der sich um den Stuͤzpunct, 3,
dreht) und hebt dieses Ende, o, in die Hoͤhe,
druͤkt also das gegenuͤberstehende Ende nieder, und zieht folglich die
Stange oder den Draht, p, an dem laͤngeren
Hebelarme des Hebels, g, der sich um den
Stuͤzpunct, 4, uͤber dem Wasserbehaͤlter dreht, zugleich mit
diesem Arme nieder.
Ungefaͤhr in der Mitte des laͤngeren Armes dieses Hebels, g, ist eine Kette oder ein Draht angebracht, woran die
Klappe, r, und die an diese durch Ringe
eingehaͤngte Klappe, s, in der
Dienstbuͤchse, f, haͤngt. So wie also der
laͤngere Arm des Hebels, g, niedersteigt,
faͤllt die Klappe, r, oͤffnet die obere
Oeffnung der Buͤchse, und laͤßt das Wasser aus dem Behaͤlter in
die Dienstbuͤchse fließen. Indessen ruht die Klappe, s, auf dem Boden dieser Buͤchse, schließt die untere Oeffnung
derselben, und hindert das Wasser in die Roͤhre, g, abzufließen.
Das auf diese Weise in die Buͤchse, f,
eingelassene Wasser fließt aber auch in die Schwimmbuͤchse, t, in welcher der Schwimmer, u, ein leeres hohles Gefaͤß in die Hoͤhe steigt. Dieser
Schwimmer steht mittelst eines Drahtes oder einer Stange mit dem Hebel, w, in Verbindung, der sich auf dem Stuͤzpuncte,
s, dreht und hebt, so wie er empor steigt, den
kuͤrzeren Arm des Hebels, w, und der
laͤngere Arm desselben, der an seinem gegenuͤberstehenden Ende eine
Stange oder einen Draht, k, fuͤhrt, welche zu
einem Hebel, y, hinablaͤuft, der sich um den
Stuͤzpunct, 6, dreht, wird auf diese Weise durch das Aufsteigen des
Schwimmers niedergedruͤkt.
Nachdem nun beide Buͤchsen mit Wasser gefuͤllt sind, bleibt dieses in
denselben zum Abflusse durch die Roͤhre g, so
lang in Bereitschaft um das Beken zu reinigen, bis die Person von dem Size aufsteht,
indem so lang bis dieses geschieht, alle Theile dieses Mechanismus in Ruhe und in
der durch Puncte angedeuteten Lage bleiben.
So wie die Person von dem Size, a, aufsteht, und von dem
Fußbrette, h, abtritt, wird die gekruͤmmte
Stange, i, i, alsogleich durch die Schwere des Gewichtes
an dem Ende des laͤngeren Hebelarmes, k, in die
Hoͤhe geworfen. Der Hebel, o, kann, auf diese
Weise, in seine vorige Lage treten, und die Stange, p,
heben, welche, indem sie dem laͤngeren Arme des Hebels, q, wieder erlaubt in die Hoͤhe zu steigen, auch
die Klappen, r, und, s, in
die Hohe zieht, wo dann erstere den Behaͤlter und die obere Oeffnung in der
Buͤchse, f, schließt, so daß kein Wasser in
dieselbe mehr einfließen kann, leztere aber dasselbe aus der Buͤchse, f, und auch aus der Schwimmbuͤchse durch die
Roͤhre, g, in das Beken, b, abfließen laͤßt. Zugleich bringt aber auch das Niedersteigen des
laͤngeren Armes des Hebels, k, die Stange, t, nieder, und das untere Ende der Klinke, m, welches mit dieser Stange verbunden ist,
druͤkt auf den Schnabel des Hebels, n, (wie man
in Fig. 17.
noch deutlicher steht), weil die Stange, l, herabsteigt,
und wirft so das laͤngere Ende des Hebels, n, in
die Hohe (wie durch Puncte in Fig. 17. angedeutet ist),
wodurch die Pfanne oder Klappe unten am Beken sich oͤffnet, und der Unrath in
das Gefaͤß, c, hinabkommt. Diese Pfanne oder
Klappe wird auf die gewoͤhnliche Weise mittelst eines Winkelhebels, z, geoͤffnet, der mit dem laͤngeren Arme
des Hebels, n, in Verbindung steht, so daß, wenn dieser
Hebel sich hebt, die Klappe oder Pfanne geoͤffnet wird.
Damit aber diese Pfanne sich nicht sogleich schließt, nachdem der Unrath
durchgefallen ist, sondern gehoͤrig lang offen bleibt, um das Beken durch das
nun nachfließende Wasser vollkommen zu reinigen, tritt der Schwimmer, u, in Thaͤtigkeit. Dieser Schwimmer wurde, wie
gesagt, durch das in seine Buͤchse, t,
einstroͤmende Wasser gehoben. Wenn aber dieses Wasser durch die
Roͤhre, g, abfließt, sinkt der Schwimmer
allmaͤhlich wieder, wodurch der Hebel, y, der mit
demselben durch den Hebel, w, und die Stange, x, wie bereits bemerkt wurde, verbunden ist, in die
Hoͤhe steigt. Eine kleine, an dem Hebel, y,
angebrachte Reibungsrolle, die an der unteren Seite der Klinke spielt, hebt durch
das Aufsteigen des Hebels, y, die Klinken, m, bis das untere Ende derselben von dem Schnabel des
Hebels, n, abglitscht, und so diesem Hebel gestattet in
seine vorige Lage zuruͤkzutreten, wodurch die Klappe am Boden des Bekens geschlossen wird. Auf
diese Weise wird nun das Wasser noch einige Zeit uͤber fortfahren aus der
Dienstbuͤchse durch die Roͤhre, g, in das
Beken zu fließen, und die Pfanne und der untere Theil des Bekens wird sich mit
Wasser fuͤllen, wodurch dann alle uͤblen Geruͤche aus dem
Schlauche oder aus dem darunter befindlichen Gefaͤße abgehalten werden.
Der Patenttraͤger nimmt vorzuͤglich die Stange, l, die Klinke, m, und den Schwimmer, u, zugleich mit den Theilen, durch welche sie in
Thaͤtigkeit gesezt werden, als sein Patentrecht in Anspruch.
Tafeln