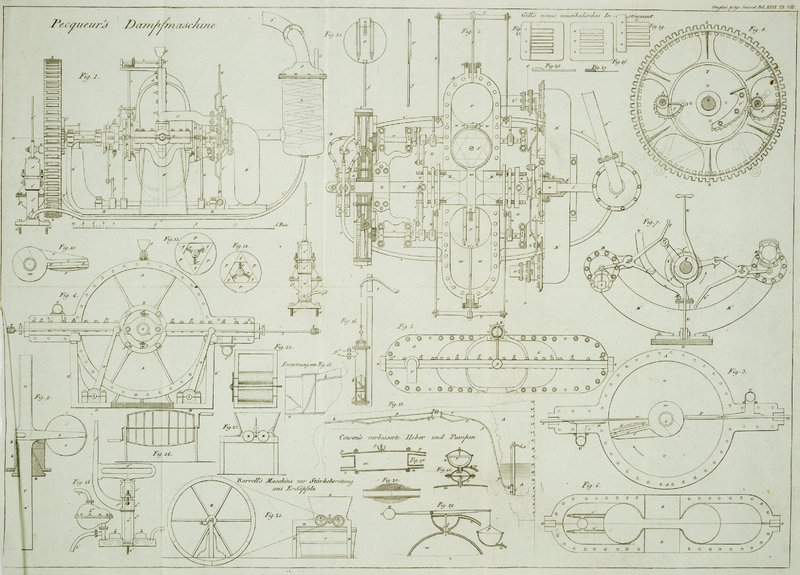| Titel: | Ueber verbesserte Heber und Pumpen zum Ausschöpfen des Wassers aus Niederungen. Von Hrn. R. Cowen. |
| Fundstelle: | Band 29, Jahrgang 1828, Nr. XCVI., S. 361 |
| Download: | XML |
XCVI.
Ueber verbesserte Heber und Pumpen zum
Ausschoͤpfen des Wassers aus Niederungen. Von Hrn. R. Cowen.Hr. Cowen hat fuͤr diese Vorrichtung die
goldene Vulcanmedaille erhalten. – Er hat sie zwar nur zur Trokenlegung
seines Steinbruches zu Carlisle angewendet; sie laͤßt sich aber
uͤberall anwenden, wo Wasser aus den Tiefen uͤber Hoͤhen
gehoben werden soll. A. d. U.
Aus dem XLV. B. der Transactions of the Society of Arts
etc. in Gill's technological Repository. Maͤrz
1828. S. 150.
Mit Abbildungen auf Tab.
VIII.
Cowen, uͤber verbesserte Heber und Pumpen zum
Ausschoͤpfen des Wassers aus Niederungen.
Obschon die Theorie des Hebers allgemein bekannt ist, so wurde
dieses Instrument doch noch nicht gehoͤrig zur Leitung des Wassers
uͤber Hohen so angewendet, wie es nach den Gesezen der Theorie und des
atmosphaͤrischen Drukes moͤglich ist. Obschon das Gewicht der
Atmosphaͤre bei dem hoͤchsten Druke derselben das Wasser auf eine Hohe
von 32 Fuß emporzuheben vermag, so sind doch, so viel ich weiß, 12 bis 14 Fuß die
hoͤchste Hohe, zu welcher man das Wasser mittelst des Hebers in der Praxis
gehoben hat. Wenn ein Heber von beliebiger Hohe mit Wasser gefuͤllt ist, so
kann er der Theorie nach
als Torricellscher leerer Raum betrachtet werden, und man darf nur einen Schenkel
desselben unter die Hoͤhe einer Wassersaͤule, die mit dem Druke der
Atmosphaͤre im Gleichgewichte steht, abkuͤrzen, um dem anderen ein
Uebergewicht zu geben, und das Wasser wird anfangen aus dem laͤngeren
Schenkel auszufließen, und der Theorie nach zu fließen fortfahren. Wasser hat jedoch
eine Verwandtschaft zur Luft und zu einigen Gasarten; und wenn sie diesen unter dem
Druke der Atmosphaͤre ausgesezt ist, so verschlingt sie einen Theil
derselben. Diese Verwandtschaft kann, wie ich glaube, als eine gegebene Kraft
betrachtet werden. Diese Kraft wird durch Kochen zerstoͤrt, sobald die Luft
dadurch aus demselben ausgetrieben wird; sie wird auch dadurch vermindert, daß man
den atmosphaͤrischen Druk entfernt, und ein Theil der Luft wird schon bei
weniger als dem halben Druke der atmosphaͤrischen Saͤule frei. Das
Gewicht der entgegengesezten in den beiden Schenkeln des Hebels enthaltenen
Wassersaͤulen muß nothwendig den Druk der Atmosphaͤre an dem obersten
Theile des Buges des Hebers vermindern, und zwar im umgekehrten Verhaͤltnisse
zu der Hohe des kuͤrzeren Schenkels. Wenn diese zwoͤlf bis vierzehn
Fuß uͤbersteigt, so wird Luft frei, und diese vertreibt das Wasser aus dem
hoͤchsten Puncte des Buges des Hebers, theilt es so in zwei Theile, und
hindert jenes ununterbrochene Ausstroͤmen, welches Statt haben wuͤrde,
wenn das Wasser keine Luft oder kein Gas enthielte. Diesem Nachtheile ist nun durch
gegenwaͤrtige Verbesserung abgeholfen.
In Fig. 15.
ist, A, A, ein Theil des Steinbruches, welcher
ausgeschoͤpft oder troken gelegt werden soll. B,
ist die Stelle, wo das gehobene Wasser hingeleitet werden soll. Sie liegt tiefer
als, A, A, und 100 Klafter von demselben entfernt. c, ist der hoͤchste Punct, uͤber welchen
das Wasser geleitet werden muß. d, e, u. f. sind drei
verschiedene Erhoͤhungen, uͤber welche die Roͤhren laufen
muͤssen, die aber weiter von einander entfernt liegen, als hier gezeichnet
ist. g, g, h, h, ist die bleierne Roͤhre, welche
hier die beiden Schenkel des Hebers bildet, i, ist eine
gewoͤhnliche Drukpumpe, die unter der Oberflaͤche des Wassers
befestigt ist, und bei, j, Fig. 16. eine Angelklappe
und eine offene Werkbuͤchse mit einer aͤhnlichen Klappe wie, k, hat. Die beiden Klappen, j, und, k, werden, wenn der Heber in
Thaͤtigkeit ist, durch die Gewalt des durch die Pumpe in den Heber
ausstroͤmenden Wassers geoͤffnet, l, ist
der Zuggriff oder Hebel, mit welchem die Pumpe bearbeitet wird. Er ist so gestellt,
daß er bei jeder Wasserhohe hinlaͤnglich hoch uͤber der
Oberflaͤche des Wassers zu stehen kommt, m, ist
ein geschlossener eiserner Behaͤlter, den man in Fig. 17. deutlich sieht,
wo an einem Ende, an der unteren Seite, bei, n, der kuͤrzere
oder aufsteigende Arm des Hebers, g, g, eintritt, und an
dem anderen Ende, bei, o, der laͤngere oder
niedersteigende Schenkel, h, h, auslaͤuft. Oben
an demselben sind an beiden Enden zwei Roͤhren, p,
p, angebracht, die klein seyn koͤnnen, und sich mit der
Heberroͤhre bei ihren hoͤchsten Biegungen, hier bei, d, e, und, f, vereinigen,
jedoch so, daß sie in einer regelmaͤßigen Neigung gegen den Behaͤlter
hin ansteigen, und die Luft in denselben gelangen lassen, die sonst bei diesen
hoͤchsten Biegungen der Roͤhre sich anhaͤufen wuͤrde.
q, ist eine kleine Klappe an dem hoͤchsten
Puncte des Behaͤlters, m, durch welche alle Luft
aus demselben entweichen kann, wenn das Wasser durch die Drukpumpe in denselben
hinaufgetrieben wird. Zu diesem Ende muß die Pumpe, i,
und die Roͤhre, g, das Wasser schneller
herbeifuͤhren, als die Roͤhre, h, dasselbe
abzuleiten vermag.
Um nun den Heber in Thaͤtigkeit zu sezen, darf man bloß das Wasser in diesen
Behaͤlter hinaufpumpen, um die Luft durch die Klappe, q, und auch aus dem laͤngeren Schenkel des Hebels auszutreiben. Der
Heber wird dann so lang fortziehen, bis der Behaͤlter wieder mit Luft
gefuͤllt ist, welche durch einige wenige Zuͤge an der Pumpe
ausgetrieben werden kann: dieß ist, wenn die aufsteigende Hoͤhe nur zwischen
12 bis 14 Fuß betraͤgt, nur alle 12 Stunden noͤthig, und
aͤndert sich auch nach dem Wechsel des Drukes der Atmosphaͤre. Wo die
Hoͤhe aber die obige Angabe nicht uͤbersteigt, fließt das Wasser ganz
nach dem Geseze des Hebers ununterbrochen fort.
Bemerkungen uͤber das Legen des Hebers unter
verschiedenen Verhaͤltnissen.
1) Bei dem Legen der Heberroͤhren muß man dafuͤr sorgen, denselben
immer ein regelmaͤßiges Aufsteigen gegen den Behaͤlter, m, zu verschaffen, damit die Luft sowohl zu den
hoͤchsten Biegungen als in den Behaͤlter vorwaͤrts kann.
Entweder muß jede hoͤchste Biegung ihren eigenen Behaͤlter haben, oder
eine Rohre muß von diesen aus die Luft in den Behaͤlter leiten.
2) Wenn von beiden Seiten des Luftbehaͤlters aus hinlaͤnglicher Abfall
vorhanden ist, sind keine Luftroͤhren nothwendig.
3) In Faͤllen, wo die Roͤhren uͤber mehrere Hoͤhen laufen
muͤssen, und die zweite derselben hoͤher ist, als die erste, ist
fuͤr jede dieser Hoͤhen ein eigener Luftbehaͤlter
noͤthig. Wenn daher mehr als ein Luftbehaͤlter nothwendig wurde, so
muß folgende Vorrichtung getroffen werden, um die Klappen nach und nach zu
schließen, wie die Luft naͤmlich aus jedem Behaͤlter ausgetrieben
wurde.
Erklaͤrung von Fig. 18. und 19.
In Fig. 18.
ist, r, die untere Klappe des Behaͤlters, s, welche durch die Kraft des durch die Pumpe
eingetriebenen Wassers gehoben wird, und durch welche die Luft entweicht. t, ist eine umgekehrte Klappe mit einem Schwimmer, v, der auf der Spindel dieser Klappe in dem Mittelpuncte
des Bechers, u, befestigt ist. So lang bloß Luft
ausgetrieben wird, bleibt die umgekehrte Klappe offen; wenn aber Wasser ausgetrieben
wird, und dieses den Becher, u, fuͤllt, so hebt
sich der Schwimmer, und die Klappe wird zugleich geschlossen. Das Wasser kann also
nicht ausfließen und wird in den naͤchsten Behaͤlter getrieben, der
auf eine aͤhnliche Weise vorgerichtet ist. w, ist
eine sehr kleine Auslaßroͤhre im Grunde des Bechers, u, durch welche das Wasser langsam entweichen kann. Wie sich der Becher,
u, leert, sinkt der Schwimmer wieder, und die
umgekehrte Klappe wird wieder geoͤffnet: diese Stellung muß sie
naͤmlich wieder einnehmen, wenn die Luft bei dem naͤchsten Pumpen
entweichen soll.
Eine andere Methode zum Schließen der Klappe.
In Fig. 19.
ist, q, eine Klappe in einem Becher, wie in Fig. 15. Auf
dem Becher befindet sich ein Hebel mit einem Gegengewichte, x, an einem Ende, und mit einem kleinen haͤngenden Gefaͤße
an dem anderen Ende, y. z, ist eine an dem Rande des
Bechers befindliche Roͤhre, um das uͤberfließende Wasser in den
Behaͤlter zu leiten, der, so wie er sich fuͤllt, die Klappe
druͤkt, und die weitere Entweichung des Wassers hindert, folglich dasselbe in
den naͤchsten Behaͤlter zu laufen zwingt. Da sich's erwarten
laͤßt, daß der erste Luftbehaͤlter alle Luft, oder wenigstens den
groͤßten Theil derselben aufnimmt, so koͤnnen die uͤbrigen
verhaͤltnißmaͤßig immer kleiner seyn.
Bei den Gefuͤgen der bleiernen Roͤhren bediente ich mich verzinnter
kupferner Reifen, machte die Gefuͤge selbst vierekig, und verloͤthete
sie auf die gewoͤhnliche Weise. Fig. 20. zeigt diese (wie
Hr. Gill sie nennt, vortreffliche) Methode, Roͤhren zusammenzufuͤgen. Die
Gefuͤge des Luftbehaͤlters sind mit Eisenmoͤrtel verkittet, dem
etwas Mennig, gepuͤlvert, zugesezt wird. Statt des Wassers wird Oehl
genommen, und das Gefuͤge nach der bei Eisenmoͤrtel
gewoͤhnlichen Art verstrichen.
Hr. Cowen bemerkt in einer Nachschrift, daß, da das Wasser
in dem Heber durch den Luftbehaͤlter durchlaufen muß, es auch nothwendig
einige Zeit uͤber in demselben verweilen muß, und zwar eine Viertel oder eine
halbe Stunde lang im Verhaͤltnisse der Menge des in dem Behaͤlter
enthaltenen Wassers zur Menge des ausfließenden Wassers. Diese Ruhe ist dem Wasser
nothwendig, damit die Luft sich aus demselben ausscheiden kann, indem die
Verwandtschaft des Wassers zur Luft in dem Verhaͤltnisse zunimmt, als die Menge der in dem
Wasser enthaltenen Luft abnimmt, und umgekehrt: uͤberdieß ist auch, außer der
Verminderung des Drukes, noch Zeit noͤthig, eine vollkommene Abscheidung der
Luft zu bewirken. Wenn das Wasser nicht Zeit genug hat, in dem Behaͤlter zu
verweilen, sammeln sich Luftblasen in dem absteigenden Schenkel des Hebers, und
vermindern die Menge des ausfließenden Wassers bedeutend.
Bei dem ersten Versuche hatte ich einen kleinen Behaͤlter mit einer Kappe oder
mit einem aufgeschraubten Pfropfen auf der hoͤchsten Erhoͤhung des
Hebers und eine zolldike Roͤhre mit einem Sperrhahne zwischen dem Heber und
dem Behaͤlter, um die Verbindung abzusperren, damit die Menge Luft, die sich
waͤhrend einer bestimmten Zeit anhaͤufte, bemessen werden konnte.
Unter dieser Vorrichtung hoͤrte der Heber aber nach und nach auf zu ziehen,
und in drei Stunden stoß nichts mehr. Die beiden Schenkel des Hebels wurden nun
zugestopselt, die Verbindung mittelst des Sperrhahnes unterbrochen, die Kappe
abgeschraubt, und die Menge der in dem Behaͤlter enthaltenen Luft untersucht.
Die Kappe und der Sperrhahn wurden wieder aufgesezt, und der absteigende oder
laͤngere Schenkel des Hebers von dem unteren Ende gegen den Behaͤlter
hin aufwaͤrts etwas geschuͤttelt. Der Sperrhahn wurde wieder
geschlossen, und der Behaͤlter wie vorher untersucht: es fand sich eine
bedeutende Menge Luft mehr, und das Wasser stieg folglich in der Roͤhre
nieder, und hatte den Raum ausgefuͤllt; woraus sich, wie es scheint, folgende
drei Thatsachen ergeben: 1) daß Luft aus dem Wasser ausgeschieden wurde,
waͤhrend es durch die Roͤhre floß; 2) daß diese nicht vorwaͤrts
getrieben wurde, sondern sich in kleinen Blaͤschen innenwendig in der
Roͤhre anlegte; 3) daß diese Luftblaͤschen die Reibung so sehr
vermehrten, daß sie beinahe den Ausfluß des Wassers hinderten. Dieser Versuch wurde
wiederholt, und gab mit geringer Abweichung dasselbe Resultat. Nun wurde die
Groͤße des Luftbehaͤlters bestimmt, den ich anfangs doppelt so groß
machen wollte: ich hatte urspruͤnglich zwei Gefaͤße mit einander
verbunden; eines hatte aber einen Fehler, und ich bediente mich bloß des anderen.
Nach zwoͤlf Stunden vermindert sich der Ausfluß, der lange Zeit
ununterbrochen fortgeht, um ein Zehntel oder Achtel. Daher die Notwendigkeit, das
Wasser eine hinlaͤngliche Zeit uͤber in dem Behaͤlter zu
halten, eine hinlaͤngliche Menge desselben in dem Behaͤlter
aufzufassen, und daher die Nothwendigkeit eines im Verhaͤltnisse zu den
Roͤhren großen Behaͤlters.
Ich muß bemerken, daß der Heber drei volle Wochen lang im Gange war, ohne daß irgend
eine Luft sich in demselben anhaͤufte, so daß auch keine durch die Pumpe
ausgetrieben werden durfte. Dieß geschah jedoch unter folgenden sonderbaren
Umstaͤnden. Am 3. und 4. Maͤrz fiel eine außerordentliche Menge Schnees, den
ein starker Wind in den Steinbruch trieb, so daß dieser beinahe bis oben an ganz
damit gefuͤllt wurde. Ein schnell eintretendes und mit anhaltendem starken
Regen verbundenes Thauwetter fuͤllte den Steinbruch bis zu einer
unerhoͤrten Hoͤhe mit Wasser, so daß das Wasser in dem
kuͤrzeren oder aufsteigenden Arme beinahe um 8, 5 bis 9 Fuß vermindert wurde.
Nach dieser Zeit war kein Pumpen noͤthig, bis die Wassersaͤule 14 Fuß
erreichte, wo sich wieder Luft in dem Behaͤlter anhaͤufte, und Morgens
und Abends gepumpt werden mußte. Das Barometer stand aber fruͤher um 5/4 Zoll
niedriger, als jezt, was allerdings einigen Unterschied erzeugt, der in Rechnung
gebracht werden muß, ohne jedoch den ganzen Unterschied hinlaͤnglich zu
erklaͤren, der wahrscheinlich uͤber zwei Fuß betragen muß, da der
Heber vom Anfange des ersten Versuches an Luft sammelte, und das Minimum des Drukes,
unter welchem Luft ausgeschieden worden seyn mochte, nicht bestimmt werden konnte.
Es ist also nicht gewiß, daß zwoͤlf Fuß das Minimum der Hoͤhe ist,
unter welcher Luft entwikelt wird, wenn das Wasser vollkommen gesaͤttigt ist.
Unter solchen Umstaͤnden geschieht es wahrscheinlich bei einem noch viel
geringeren Druke, wie obiger Fall beweist, wo der Heber so lang ohne Pumpen zog und
Schneewasser fuͤhrte. Mehrere ausgezeichnete Chemiker (Gay-Lussac und Humboldt ausgenommen)
nehmen an, daß Schneewasser wenig oder keine Luft enthaͤlt, und wenn das
Einsaugungsgesez, welches Henry und Dalton aufstellten, richtig ist, daß die Menge, welche das Wasser
einsaugt, im Verhaͤltnisse zum Druke steht, d.h. daß das Wasser unter einem
Druke von 2 Atmosphaͤren 50 einsaugt, wenn es unter einem Druke von Einer
Atmosphaͤre 25 einsaugt, so wird dieses Gesez auch bei abnehmendem Druke von
Einer Atmosphaͤre bis zum leeren Raume gelten; so daß wir annehmen
koͤnnen, daß vollkommen gesaͤttigtes Wasser in einem Heber Luft bei
einem weit geringeren Druke fahren laͤßt. Ob nun aber entweder das Wasser
nicht vollkommen gesaͤttigt ist, oder Luft vorwaͤrts gefuͤhrt
wird, wenn das Wasser schnell durch den Heber laͤuft, wie bei einem kurzen
Heber, der in seinem laͤngeren Schenkel einen bedeutenden Fall hat, wage ich
nicht zu bestimmen; in der Praxis sammelt sie sich unter solchen Umstaͤnden
in einem gewoͤhnlichen Heber von einer Hoͤhe von 5 bis 6 Fuß nicht. Es
ist noch einige Erfahrung und wiederholte Beobachtung nothwendig, um das Minimum von
Hoͤhe zu bestimmen, unter welchem Luft sich aus dem Wasser ausscheidet; und
dieses Minimum wird wahrscheinlich nach dem Verhaͤltnisse der in dem Wasser
enthaltenen Luft, der Temperatur, der laͤnge des Hebers, der Schnelligkeit
der Bewegung des Wassers in demselben und vielleicht auch nach anderen
Umstaͤnden verschieden seyn.
Hr. Cowen fuͤhrt nun Zeugnisse uͤber den
guten Gang seiner Hebevorrichtung an, durch welche er, obschon die Roͤhre nur Einen Zoll im
Durchmesser haͤlt, in 24 Stunden im Durchschnitte 30,000 Pf. Wasser hebt. Ein
Junge darf nur einige Minuten des Tages uͤber an der Pumpe ziehen, um die
Luft aus dem Behaͤlter zu treiben, die waͤhrend 24 Stunden zwischen 6
bis 10 Kubikfuß betraͤgt.
Tafeln