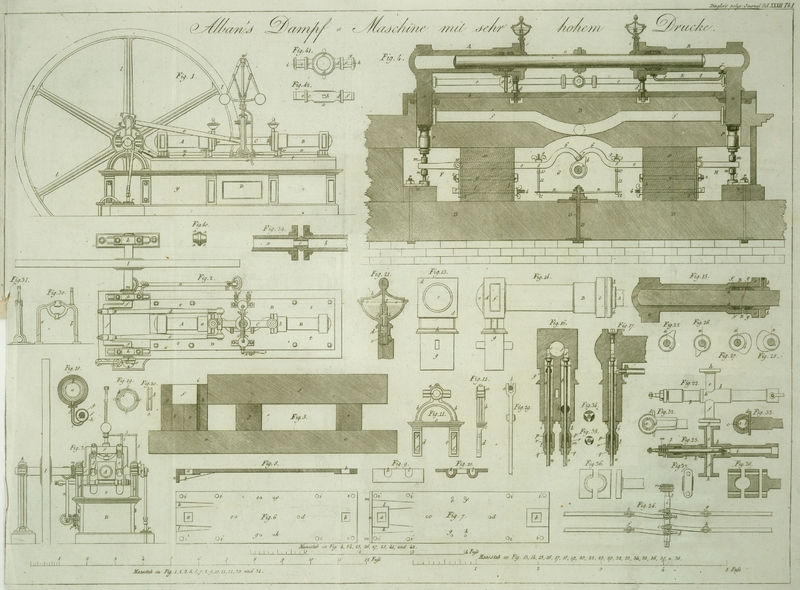| Titel: | Beschreibung meiner neuen Dampfmaschine mit sehr hohem Druke. Von Dr. Ernst Alban. |
| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |
| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. I., S. 1 |
| Download: | XML |
I.
Beschreibung meiner neuen Dampfmaschine mit sehr
hohem Druke. Von Dr. Ernst Alban.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Alban, Beschreibung meiner neuen Dampfmaschine mit sehr hohem
Druke.
Ich schike diese Beschreibung derjenigen meines neuen Entwikelungsapparates voraus,
indem ich vor der Bekanntmachung desselben noch einige Versuche mit ihm abzuwarten
mir vorgenommen habe, deren Resultate manchen Einfluß auf diejenige Construction
desselben haben, die ich als die neueste und beste empfehlen moͤchte.
Schon in meiner vorausgegangenen Abhandlung uͤber mein neues
Dampfentwikelungsprincip und seine Anwendung auf Maschinen habe ich mich darzuthun
bemuͤht, daß ein zwekmaͤßiger Apparat zur Benuzung sehr
hochdruͤkender Daͤmpfe (von 600 bis 800 Pfund Druk auf dem
Quadratzoll) oder eine Dampfmaschine mit sehr hohem Druke bis jezt noch mehr zu den
frommen Wuͤnschen gehoͤrt habe, als ein genuͤgender
Dampfentwikler fuͤr denselben. Es stellt sich naͤmlich der
Ausfuͤhrung und wirklichen Anwendung einer solchen Maschine ein großes Heer
von Schwierigkeiten entgegen, das von dem groͤßten Theile der Verbesserer
bisher kaum gewuͤrdigt, von Hrn. Perkins aber noch
nicht ein Mal zur Haͤlfte uͤberwunden worden ist. Diese
Schwierigkeiten betreffen folgende Hauptumstaͤnde:
1) Es ist sehr schwer, den Gang aller derjenigen. Organe der
Maschine, denen die Triebkraft des sehr hochdruͤkenden Dampfes
mitgetheilt und durch welche sie fortgeleitet wird, die also unter dem hohen
Druke sich in steter Bewegung befinden, in dem Grade dampfdicht zu erhalten, daß
kein merklicher Verlust an Daͤmpfen Statt finde. Diese Schwierigkeit
zeigt sich vorzuͤglich bei der Bewegung der Staͤmpel solcher
Maschinen und in ihrer Neuerung.
2) Es ist ferner selbst eine zwekmaͤßige dampfdichte
Verbindung aller unbeweglichen, starken Dampf enthaltenden, Theile mit großen
Umstaͤnden verbunden, zumal wenn eine der Hauptforderungen dabei,
Einfachheit und Bequemlichkeit in der Anwendung der dahin zwekenden
Vorrichtungen, beruͤcksichtigt werden soll.
3) Eine Hauptschwierigkeit liegt aber in der Besiegung der großen
Hize sehr hoch gespannter Daͤmpfe, die alle Liederungen mehr oder weniger
angreift und jede Reibung zwischen Metallflaͤchen durchaus
verbietet.
Obgleich sich nun nicht laͤugnen laͤßt, daß der menschliche, stets
unerschoͤpfliche, Geist Mittel finden koͤnne und werde, um allen
diesen Schwierigkeiten die Spize zu bieten und sie zu besiegen, so wird doch die bei
dieser Besiegung laut werdende unerlaͤßliche Forderung an ihn, dieselbe durch
die moͤglichst einfachsten und kunstlosesten Mittel auszufuͤhren, eine
nicht minder schwierige, ja fast noch groͤßere Aufgabe fuͤr ihn. Mit
der Erfindung einer durchaus zwekmaͤßigen Dampfmaschine von sehr hohem Druke
sollen naͤmlich nicht allein die bei den bisherigen Dampfmaschinen erhaltenen
Resultate vollkommen erreicht, sondern auch groͤßere Vortheile in der
Anschaffung, Anwendung und Behandlung derselben erzielt werden, wenn sie wirklich
von wohlthaͤtigem Einflusse auf die Industrie seyn soll. Eine solche Maschine
muß einfach, kunstlos, weniger kostspielig und, vor allen Dingen, dauerhaft seyn, in
allen diesen Haupteigenschaften wo moͤglich sogar die bisher
gewoͤhnlichen Maschinen mit niederm Druke noch uͤbertreffen.
Ich werde jezt diejenigen Wege, die ich zur Realisirung einer solchen, allen
Forderungen genuͤgenden, Dampfmaschine eingeschlagen habe, der
Pruͤfung Sachkundiger vorlegen. Sie koͤnnen dieselben theils als Ideen
betrachten, die noch durch keine Erfahrung bestaͤtigt sind, und deßhalb unter
die Kategorie der Vorschlaͤge gehoͤren, theils aber auch als
Plaͤne ansehen, die durch eine Menge zeitraubender und kostspieliger
Versuche, sowohl in Deutschland, als in England gepruͤft, gewuͤrdigt
und als richtig und zwekmaͤßig erwiesen sind. Ich schmeichle mir indessen,
daß selbst die als Vorschlaͤge zu betrachtenden Theile meiner Erfindung
dadurch einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit des Gelingens gewinnen, daß sie
theils auf einfachen, mechanischen und physikalischen Principien beruhen, deren
Wahrheit nicht allein klar in die Augen leuchtet, sondern auch als bekannt
angenommen werden kann, theils aber auch von mir auf Erfahrungen gebaut sind, von
denen ich mir bei einem zwoͤlfjaͤhrigen steten Experimentiren im Felde
der Dampfmaschinen einen nicht unbedeutenden Schaz gesammelt habe. Auch betreffen
sie hie und da Gegenstaͤnde, die schon theilweise zu einem andern Zweke, oder
in einer andern Form, oder bei andern Gelegenheiten mit Gluͤk in Gebrauch
waren und hier nur eine neue veraͤnderte Anwendung finden. Da ich jezt
beschaͤftigt bin, auch diese als Vorschlaͤge zu betrachtenden Ideen
naͤher durch Erfahrungen zu pruͤfen, so duͤrfte ihre
groͤßere oder mindere Zulaͤssigkeit vielleicht bald an's Licht gestellt
werden. Ihre jezige fruͤhe Mittheilung betrachte man als ein Streben, die
Mitwirkung aller derjenigen Vaterlandsfreunde, denen die technische Wohlfahrt
unseres guten Deutschlands am Herzen liegt, anzurufen, und in ihnen den Trieb zur
Befoͤrderung eines so interessanten und wichtigen Unternehmens zu weken.
Von meinem Entwikelungsapparate werde ich spaͤter die gehoͤrigen
Mittheilungen machen, sobald ich die Resultate eines jezt in Arbeit stehendenDieser Entwikelungsapparat macht leider sehr langsame Fortschritte, da mir
gaͤnzlich die Mittel fehlen, die durch den Bau desselben entstehenden
Kosten zu bestreiten. gehoͤrig anzugeben im Stande bin. Ich bin sehr gespannt, ob es mir
gluͤken wird, hier in unserm, so oft von seinen eignen Buͤrgern
herabgewuͤrdigten, Vaterlande einen Apparat herzustellen, der mir bei meinen
Versuchen in England zwar die herrlichsten Aussichten eroͤffnet hat, dessen
voͤllige Vollendung und Vervollkommnung mir aber von den stolzen Britten, die
troz meiner vielfaͤltigen Leistungen durch Ohrenblaͤserei und Kabale
ihrer Landsleute schwankend und mißtrauisch erhalten wurden, verweigert, theils
durch Raͤnke und Unwissenheit und Unbeholfenheit der leztern in einem ganz
neuen Felde der menschlichen Forschung sich zu bewegen, vereitelt wurdeIch hatte meinen Probeentwikelungsapparat in London sehr gluͤklich
vollendet, kann auch daruͤber Zeugnisse meiner Interessenten
beibringen, als der Bau des zweiten Entwiklers Schwierigkeiten bei der
Ausfuͤhrung der Metallgefaͤße bliken ließ, die indessen eine
Reihe einfacher und nicht kostspieliger Experimente bald besiegt haben
wuͤrde, wenn dieselben privatim und mit
gehoͤriger Ruhe angestellt worden waͤren. Diese vorzunehmen
verboten theils die Umstaͤnde (der neue Generator war auf Bestellung
der Regierung gemacht), theils die Ungeduld meiner Interessenten. Die
Maschine sollte durchaus oͤffentlich aufgestellt und ihre
gluͤkliche Vollendung forcirt werden. Diese ungluͤkliche
Maxime veranlaßte einen unmaͤßigen Kostenaufwand, da die wenigen
Versuche, die zur Besiegung jener praktischen Schwierigkeiten unternommen
wurden, alle in einem zu großen Maßstabe und in zu kurzer Zeit
ausgefuͤhrt werden mußten, so daß ich oft beim Verungluͤken
des einen Versuchs nicht 12 Stunden Frist hatte, einen neuen Plan zu
entwerfen und vorzubereiten und nie im Stande war, irgend ein
pruͤfendes und das Gelingen des neuen Versuchs mehr sicherndes
Experiment vor der Ausfuͤhrung desselben anzustellen. Dabei ging der
Muth und Eifer und die Froͤhlichkeit meiner Interessenten und
endlich, da sie meistens wenig beguͤtert waren, auch der nervus rerum gerendarum zu Ende. Ihr Vertrauen
zu mir, dessen Erfindungsgeist sich in der Klemme nicht frei bewegen konnte,
dessen animus zum Schaffen durch den heftigen
und zerstoͤrenden Drang der Umstaͤnde erdruͤkt, dessen
Thaͤtigkeit und Eifer zum Wirken durch Einschraͤnkungen des
freien Willens, den besten Weg zur Erreichung des Zieles zu waͤhlen,
gelaͤhmt und durch die traurige Stimmung, worein mich die
Ausfaͤlle meiner unzaͤhligen Feinde und Widersacher und die
betruͤbende Aussicht auf mein und meiner Familie kuͤnftiges
Loos versezten, getoͤdtet wurden, verlor sich um so mehr, je mehr
meine Widersacher den ungluͤklichen Zeitpunkt gegen mich benuzten und
meine Faͤhigkeiten bei ihnen in ein schlechtes Licht zu stellen
suchten. Alles dieses verwikelte uns in Mißhelligkeiten und Streitigkeiten
mit einander, bis ich endlich im Gefuͤhle, in England bei dem besten
Willen und Faͤhigkeiten nicht frei und darum nicht gluͤklich
und wohlthaͤtig wirken zu koͤnnen und durch die
Erschoͤpfung ihrer, durch unnuͤze Verschwendungen und
Aufopferungen geschwaͤchte, Kasse bewogen, im hoͤchsten
Ueberdrusse, aber mit der ungetruͤbtesten lebendigsten Hoffnung, daß
mir die
Vorsehung uͤber lang oder kurz ein Mal Gelegenheit verschaffen werde,
frei und unabhaͤngig meines Plaͤne auszufuͤhren und
meiner Erfindung eine groͤßere Vollendung zu geben, freiwillig
England verließ..
Ich will jezt erst meine Maschine im Ganzen beschreiben und hernach zur
naͤheren Erklaͤrung ihrer einzelnen Theile und ihres Zwekes
uͤbergehen.
A. Allgemeine Uebersicht der
Maschine.
Meine Maschine besteht aus zwei horizontal liegenden Cylindern oder vielmehr
Stiefeln, die auf dem Gestelle so befestigt sind, daß beider Achsen genau in einer
Linie liegen. Auf der I. Tafel, worauf in Fig. 1, 2 und 3 ein Aufriß meiner ganzen
Maschine, und zwar in Fig. 1 eine Ansicht
derselben von der Seite, in Fig. 2 von oben und Fig. 3 vom
linken Ende vorgestellt ist, sieht man bei A und B die beiden Stiefel. In denselben bewegt sich, C, ein solider Staͤmpel, dessen Gang an beiden
Stiefeln bei a und b durch
eine Stopfbuͤchse gedichtet wird. Zwischen dem Staͤmpel und dem innern
cylindrischen Raume des Cylinders bleibt nur gerade so viel Zwischenraum, daß
ersterer sich frei und ohne die Waͤnde zu beruͤhren darin bewegen
kann.
Der Staͤmpel ist zwischen beiden Stiefeln mit einem Querstuͤke Fig. 2, c, versehen, das durch einen Keil daran befestigt ist.
Lezteres bewegt zwei Leitstangen, d und e, die zur Kurbel, f,
fuͤhren und diese bei dem Hin- und Hergange des Staͤmpels in
eine Rundbewegung sezen. Das Querstuͤk ist gerade in der Mitte des ganzen
Staͤmpels befestigt, und damit es sich mit dem Staͤmpel frei bewegen
koͤnne, stehen die Stiefel in der dazu noͤthigen Entfernung von
einander. Der Staͤmpel ist so lang, daß er bei seiner Hin- und
Herbewegung in den Stiefeln beide wechselsweise fuͤllt und leer macht, so,
daß waͤhrend er in dem einen bis an's Ende eingedrungen ist, er den andern
bis zu seiner Stopfbuͤchse verlassen hat.
Auf diese Weise bildet der Staͤmpel das Organ, dem der Dampf die erste
Bewegung in der Maschine mittheilet. Wenn er naͤmlich in den einen oder den
andern Stiefel ganz eingedrungen ist, so wird der Dampf in diesen geleitet und
treibt ihn auswaͤrts, waͤhrend er den von ihm verlassenen Raum
fuͤllt, zugleich schiebt er ihn aber in die Tiefe des
gegenuͤberliegenden Stiefels hinein. Ist er hier ganz bis an's Ende desselben
gekommen, so wird Dampf in diesen eingelassen, waͤhrend er aus dem andern
in's Exhaustionsrohr abstroͤmt. Der Staͤmpel tritt nun seinen
Ruͤkweg an und dringt von neuem in den entgegengesezten Stiefel, nach dessen
Fuͤllung der einstroͤmende Dampf ihn wieder zuruͤkschiebt.
Waͤhrend der Staͤmpel so in beiden Stiefeln durch den Dampf hin und
her getrieben wird, sezt er außerhalb derselben und zwischen beiden das Querstuͤk und mit
demselben die Leitstangen sammt der Kurbel in Bewegung. Die Kurbel dreht sich in
zwei Lagern des Gestelles Fig. 2 und 3, g, und h, die von Gußeisen mit Messing
ausgebuchset und auf gußeiserne Boͤke, i,
gestellt sind. Leztere werden an das hoͤlzerne Maschinengestelle, D, angeschroben. Außerhalb des hintern Lagers
verlaͤngert sich die eiserne Welle der Kurbel und ihr Endzapfen liegt dann in
einem dritten Lager Fig. 2 und 3, k. Auf der Welle befindet sich das Schwungrad Fig. 1, 2 und 3, l, und ein konisches Getriebe, m, welches
durch die schraͤg nach abwaͤrts zum untern und Mittlern Theile des
Maschinengestelles laufende, und mit zwei gleichen Getrieben versehene Welle, n, die Steurungswelle in Bewegung sezt, deren Ende Fig. 3, o, aus dem Gestelle hervorragt und mit einem gleichen
Getriebe, p, versehen ist. Alle diese verschiedenen
Getriebe haben gleichen Durchmesser und gleiche Anzahl von Zaͤhnen, woher die
Steurungswelle mit der Kurbelwelle gleiche Umlaͤufe macht. Das vordere Ende
der Kurbelwelle traͤgt eine runde Scheibe, Fig. 1, 2 u. 3, q, die mit einem excentrisch angesezten Zapfen versehen ist, von welchem
die Triebstange fuͤr die Drukpumpe, r, zu deren
Staͤmpel herabgeht und diesen in Bewegung sezt. Die Drukpumpe arbeitet mit
einem Staͤmpel und ist ganz so construirt, wie ich eine dergleichen im
polytechn. Journale Bd. XXVIII. S. 425.
beschrieben und abgebildet habe.
Um den Gang des Staͤmpels in den beiden Stopfbuͤchsen immer
schluͤpfrig zu erhalten, sind auf der Scheibe, s,
des Stopfpfropfens jeder derselben kleine Fettbuͤchsen angebracht, die
fortwaͤhrend ihr Fett tropfenweise durch einen Canal der Scheibe dem
Staͤmpel zuleiten. Um ein solches tropfenweises Abfließen des Fettes aus den
Buͤchsen zu bewerkstelligen, enthalten diese in ihrem Fuße eine kleine
Hoͤhlung, worein ein Stuͤkchen Fensterschwamm gelegt wird. In die
Hoͤhlung kann ein Pfropfen, der durch einen kleinen an der, oben auf der
Buͤchse befindlichen Eichel befestigten, Stiel gedreht wird, mehr oder
weniger in die Hoͤhlung hineingeschroben werden, so daß dadurch der
Fensterschwamm mehr oder minder zusammengedruͤkt wird. Nach den verschiedenen
Graden seiner Zusammenpressung laͤßt dieser nun das Fett, was durch einen
Canal des Pfropfens aus der Buͤchse in ihn dringt, schneller oder langsamer
durch, so daß auf diese Weise der Zufluß desselben auf den Staͤmpel genau
regulirt werden kann.
Um den Gang des Staͤmpels in den Stopfbuͤchsen der Stiefel
voͤllig dampfdicht zu machen, liegt in der Mitte der Hanfliederung derselben
ein Ring von Kanonenmetall oder einer besondern Metallmischung, (m. s. weiter
unten), der sowohl nach dem Staͤmpel hin, als an seiner aͤußeren
Flaͤche hohl ausgedreht ist. Er bildet so zwei ringfoͤrmige Canaͤle, einen nach innen
um den Staͤmpel, und einen nach außen an der Wand der Stopfbuͤchsen.
Beide Canaͤle werden durch mehrere kleine, durch die Waͤnde des Rings
gebohrte, Loͤcher in Verbindung gesezt. Der aͤußere Canal communicirt
durch eine Oeffnung in der Wand der Stopfbuͤchse mit einem Rohre, das
entweder von dem untern Theile einer Erweiterung der Dampfroͤhre kommt, oder
mit einer kleinen Hoͤhlung an dem tiefsten Theile des innern Stiefelraumes
zusammenhaͤngt und aus beiden, sowohl Dampfroͤhre als Stiefel, die
sich darin verdichteten Daͤmpfe als Wasser in den Ring fuͤhrt, und
dieses hier unter Druk haͤlt, so daß dem von innen gegen die
Stopfbuͤchse andringenden Dampfe ein hydraulischer, gleich starker Druk
innerhalb der Liederung entgegensteht, der dessen Entwischen vollkommen
verhuͤtet. Die Einrichtung ist hoͤchst einfach und compendioͤs
und auf diese Weise ein sehr wichtiger Zwek durch ein sehr ungekuͤnsteltes
Mittel erreicht.
Die beiden Dampfstiefel sind auf der gußeisernen Platte, t, des hoͤlzernen Maschinengestelles, D, theils festgekeilt, theils festgeschroben. Man vergleiche hier Fig. 4. An den
beiden aͤußeren Enden desselben ist naͤmlich ein langer Fortsaz, a, angegossen, der nach unten durch die Gestellplatte,
b, geht, und unter derselben durch einen Keil, c, befestigt ist. Diese Art der Befestigung ist
hoͤchst sicher, dauerhaft und kunstlos. Außerdem wird das entgegengesezte
Ende der Stiefel durch eine kleine eiserne Stuͤze, d, getragen. In den Fortsaͤzen der Stiefel befindet sich die
Steurung. Sie besteht aus konischen Ventilen von hartem Stahl, die die in die
Stiefel fuͤhrenden Canaͤle oͤffnen und schließen. Ihre Stiele
gehen in Canaͤlen der Fortsaͤze abwaͤrts und am Boden derselben
durch messingene Roͤhren, die in die Fortsaͤze eingeschroben sind und
die kleinen Stopfbuͤchsen fuͤr die Stiele enthalten. Aus den
Canaͤlen fuͤhren Oeffnungen in die Dampf- und
Exhaustionsroͤhre, wovon jede die gleichartigen Canaͤle der beiden
Fortsaͤze verbindet.
Das Dampfrohr, e, Fig. 1, u, muͤndet sich sehr hoch in den Canal des
Dampfventils, und zwar gleich unter dem Stiefel, etwas mehr nach hinten, als vorne.
Auf diese Weise kommt das Dampfrohr uͤber der Gestellplatte zu liegen,
waͤhrend das Exhaustionsrohr (Fig. 4, f,) unterhalb derselben sich befindet. Da die
Fortsaͤze von nicht ganz geringer Hoͤhe sind, so bleibt unter der
Dampfroͤhren-Muͤndung in dem Canale ein bedeutender Raum, in
welchem sich nach und nach verdichtete Daͤmpfe aus der Dampfroͤhre
sammeln und hier eine Wassersaͤule uͤber der Stopfbuͤchse des
Dampfventilstiels und in dem Canale bilden, durch welche die Hize der Daͤmpfe
nach unten nur in sehr geringem Maße durchdringt, so daß jene Stopfbuͤchse, die sonst
eine bedeutende Dampfhize auszustehen haͤtte, nun nur in einer
maͤßigen Waͤrme arbeitet. Eine gleiche Wassersaͤule steht
uͤber der Stopfbuͤchse des Exhaustionsventils, jedoch ist dieselbe
weniger hoch, braucht es auch nicht zu seyn, da die Hize der durch den Canal
abstroͤmenden Daͤmpfe, die sich schon zum Druk der Atmosphaͤre
herunter ausdehnten, den Siedpunkt des Wassers nicht uͤbersteigt.
Das Dampfrohr liegt unter den Stiefeln etwas nach hinten. Es hat in der Gegend der
Stopfbuͤchsen der Stiefel zwei kugelfoͤrmige Erweiterungen, g, Fig. 1, v, v, von welchem das obengenannte Wasserrohr Fig. 4, h, in den Ring der Stopfbuͤchse
fuͤhrt.
In der Mitte des Dampfrohrs befindet sich eine messingene Buͤchse, i, mit einem regulirenden Ventile, worauf der Gouverneur
Fig. 1,
w, der Maschine wirkt. Sie liegt quer uͤber
dem Gestelle und verbindet sich nach hinten mit dem Dampfrohr, vorne aber kommt der
Stiel des regulirenden Ventils aus seiner Stopfbuͤchse nach außen hervor und
hat hier ein dreigaͤngiges Gewinde, womit er sich in einer Mutter des
Stopfpfropfens der Stopfbuͤchse dreht. Außerhalb ist ein Hebel Fig. 1, x, an demselben befestigt, der auf die
gewoͤhnliche Weise von dem Gouverneur der Maschine bearbeitet wird. Dieser
Gouverneur sieht in einem gußeisernen Gestelle uͤber und zwischen beiden
Stiefeln. Er ist von ganz gewoͤhnlicher Einrichtung und wird durch eine
Schnur voll der Steurungswelle aus betrieben.
Die Steurungswelle Fig. 4, i, dreht sich unter dem Gestelle in
Zapfenlagern. Sie hat Nasen, k, wodurch sie in den
bestimmten Momenten die vier Hebel luͤftet, die die Ventile oͤffnen
und schließen, indem sie uͤber deren, nach außen und unten hervorragende, und
unten im Gestelle sich noch in Ruͤken bewegende, Stiele greifen, und diese an
Ansaͤzen, m, heben und senken, die an denselben
durch kleine Keile befestigt sind. Die Nasen fuͤr die Dampfventile sind so
eingerichtet, daß sie den in die Stiefel zulassenden Dampf schon auf 1/3 des
Staͤmpelhubes abschließen.
Da das Dampfventil so gestellt ist, daß die in den Cylinder stroͤmenden
Daͤmpfe es zu schließen streben, so ist einem uͤbermaͤßigen
Druke der Daͤmpfe darauf dadurch vorgebeugt, daß der Stiel desselben genau
den Durchmesser der Oeffnung hat, welche es schließt. Auf diese Weise wird der Druk
der Daͤmpfe darauf so gut wie aufgehoben. Eine kleine Feder an dem
Bewegungshebel druͤkt es wieder zu, wenn es geoͤffnet war.
Mit dem Exhaustionsventile verhaͤlt es sich aber ganz anders. Da es, gleich
dem Dampfventile, von unten gegen die durch dasselbe zu schließende Oeffnung
druͤkt, so strebt der im Cylinder wirkende Dampf es zu oͤffnen und
wuͤrde es stets offen erhalten, wenn nicht eine starke Feder, n, am Bewegungshebel, o,
dasselbe mit Gewalt geschlossen erhielte. Dieser aͤußere mechanische
Gegendruk durch die Feder wird so berechnet, daß er den gesezlichen der
Daͤmpfe im Stiefel um etwas uͤbertrifft. Auf diese Weise hat die
Maschine nur bei Luͤftung des Ventils die Differenz zwischen Dampfdruk und
mechanischen Gegendruk auf dasselbe zu heben. Die Exhaustionsroͤhre liegt
unterhalb der gußeisernen Platte des Gestelles zwischen den beiden
Stiefelfortsaͤzen, und ein von derselben abfuͤhrendes Abzugsrohr, p, fuͤhrt die Daͤmpfe aus demselben unter
die Sohle des Maschinenraums, unter welcher sie in's Freie geleitet werden.
B. Naͤhere Beschreibung der
Maschine.
Die hier beschriebene Maschine ist auf die Kraftleistung von zehn Pferden berechnet.
Sie wirkt mit 600 bis 700 Pfund Druk auf den Quadratzoll, hat einen
dreizoͤlligen Staͤmpel, einen 18zoͤlligen Hub und macht 60
Umgaͤnge in der Minute. Alle Zeichnungen derselben sind genau nach dem
Maßstabe angeordnet und die Berechnung nach englischem Maße gemacht. Ich will nun
versuchen, die Maschine so genau und ausfuͤhrlich als moͤglich zu
beschreiben, damit jeder Dampfmaschinen-Kuͤndiger ein recht klares
Bild davon erhalte.
I. Gestell, Fig. 1, 2, 3 und 4, D. Besonders vorgestellt sieht. man sein Gerippe
Fig.
5.
Es kann dasselbe von Holz oder von Gußeisen verfertigt werden. Fuͤr
Deutschland moͤchte in allen Faͤllen ein hoͤlzernes
vorzuziehen seyn, indem ein solches in den meisten Gegenden nicht allein am
wohlfeilsten zu haben, sondern auch am leichtesten von gewoͤhnlichen
Arbeitern herzustellen ist. Uebrigens ist es auch von Werth, die Transportkosten
von Maschinen nicht durch schwere Gestelle zu vergroͤßern. Ein Gestell,
wie das zu meiner Maschine gehoͤrige, kann beim Aufstellen einer Maschine
gleich an Ort und Stelle durch gewoͤhnliche Zimmerleute verfertigt und
zugerichtet und nach Vollendung der Aufstellung durch einen gewoͤhnlichen
Tischler mit einer zierlichen Verkleidung versehen werden.
Man wird am zwekmaͤßigsten moͤglichst trokenes Eichenholz dazu
anwenden, wenigstens muß die oberste Dekplatte von diesem Holze genommen werden.
Zuerst legt man auf das Grundgemaͤuer zwei bis drei starke Schwellen, a, der Laͤnge nach neben einander und
verbolzt selbige theils unter einander, theils mit ersterem auf die
gewoͤhnliche Weise. Nun legt man in der Breite des Maschinengestelles
bei, b, c, d, und e,
mehrere starke Stuͤke gutes festes Holz quer uͤber die Schwellen
und uͤber diese, in der Laͤnge des Maschinengestelles, die Platte, f, aus zwei oder drei starken, den haͤrtesten
und besten Stuͤken zusammengefuͤgt. Schwelle, Querlager und Platte
werden zusammen verbolzt, so daß sie ein unzertrennliches Ganzes bilden. Die
Laͤnge und Groͤße der verschiedenen Theile des Gestelles wird
jedes Mal durch den Umfang der darauf zu stellenden Maschine bestimmt. In der
vorliegenden Zeichnung ist die Platte acht Fuß lang und Ein Fuß zehn Zoll breit.
Alles Holz in dem Gestelle haͤlt Ein Fuß im Quadrat.
Fuͤr das Lager der Schwungradwelle wird außerhalb des Gestelles, nach
hinten, eine eigene Schwelle gelegt und auf dem Grunde befestigt. Fuͤr
das Schwungrad selbst aber bleibt eine Vertiefung im Grundgemaͤuer, da
ein Theil desselben unter die Sohle hinabreicht.
Bei, g, und h, werden
sowohl hinten, als vorne Falzen eingestemmt, die die gußeisernen Staͤnder
des Welllagerbokes aufnehmen. Ihre Tiefe richtet sich natuͤrlich nach der
noͤthigen Entfernung der beiden Lager, des vordern und hintern, von
einander. Zur Befestigung der Staͤnder gehen vier Bolzen quer durch das
Holz des Gestelles, die beide Lagerboͤke zugleich an das Gestell anziehen
und es fest mit demselben verbinden. Da an der Welle alle Kraft der Maschine
sich gleichsam concentrirt, so ist es durchaus noͤthig, daß die Lager
derselben sehr fest und unverruͤkbar stehen.
Da, wo die beiden Lagerboͤke sich befinden, ist die Platte des Gestelles
bedeutend von oben herunter ausgeschnitten, m. s. i,
damit die Kurbel sich frei uͤber derselben bewegen koͤnne. Sie
bildet hier einen tiefen Absaz des Gestelles, gegen welchen gehalten die Stiefel
mit ihrer gußeisernen Dekplatte bedeutend erhoͤht liegen.
Fuͤr die Drukpumpe ist an der Sohle des Gestelles ein Vorsprung
angebracht, der mit in den Sokel desselben verzogen ist. Sie wird auf diesen
Vorsprung durch Schrauben gehoͤrig befestigt. Ihre Cisterne wird neben
der Schwelle in das Grundgemaͤuer eingesenkt und gehoͤrig bedekt,
damit kein Staub und Schmuz in dieselbe dringen koͤnne. Das ganze
hoͤlzerne Gestell ist mit einer hoͤlzernen Bekleidung versehen,
deren Form und Verzierungen aus Fig. 1 und 3 deutlich
werden. Jedoch koͤnnen beide beliebig und auf mannigfaltige Weise
veraͤndert werden. In den Feldern, y, und z, werden Thuͤren angebracht, um bequem zu
der Steurung kommen zu koͤnnen. Diese liegt in meiner Maschine
voͤllig versteckt und vor allen Unreinlichkeiten und
Beschaͤdigungen gesichert, welcher Umstand manchen wichtigen Vortheil
gewaͤhrt.
An gußeisernen Theilen gehoͤren zu dem Gestelle nur die zwei
Lagerboͤke und die obere Dekplatte. Von beiden will ich noch besonders
reden.
Die Lagerboͤke werden aus einem Staͤke gegossen und aus Fig. 1 und
3
gehoͤrig deutlich. Man sieht einen derselben Fig. 11 im Aufrisse,
Fig.
12 in der Seitenansicht. Gleiche Buchstaben bezeichnen gleiche
Gegenstaͤnde. Beide koͤnnen nach einem Modelle gegossen werden.
Sie bestehen oben aus dem eigentlichen Lager, a,
fuͤr die Welle, in welches die messingenen Buͤchsen eingesezt
werden. Der obere Theil des Lagers ist besonders gegossen und wird durch zwei
Schrauben Fig.
1 und 2 an den, unten an den Bok angegossenen, Theil in dem Maße angezogen,
daß die Wellzapfen frei spielen koͤnnen, ohne im Mindesten zu schlottern.
Damit die Schrauben sich nicht zuruͤkdrehen koͤnnen und das Lager
schlottrig machen, schlage ich vor, jene bekannte Methode zu befolgen, nach
welcher man Stuͤkchen weiches Holz zwischen beide Theile des Lagers da
legt, wo die Schrauben angebracht sind, und nun die Schrauben so fest als
moͤglich anzieht. Daß diese Stuͤkchen Holz gerade die
Staͤrke haben muͤssen, die noͤthig ist, um bei starkem
Anziehen der Schrauben den Wellzapfen ihre Freiheit zu erhalten, versteht sich
von selbst.
Unter dem Lager macht der Bok einen Bogen Fig. 12, b, mit dessen beiden Schenkeln er auf seinem
Gesimse, c, ruht. Dieses Gesimse bildet einen Theil
desselben Gestelles und gibt dem Bogen mehr Festigkeit, zugleich aber
erhoͤht es die gefaͤllige Form des Ganzen. Von demselben gehen die
Staͤnderplatten, d, und e, abwaͤrts und sind so lang, daß sie bis auf
den Sokel des Gestelles reichen. Sie sind auf ihrer aͤußern
Flaͤche in der Mitte vertieft gegossen, so daß ihre vier Seiten einen
starken erhabenen Rand bilden, der ihre Staͤrke und Festigkeit vermehrt,
ohne daß sie uͤberfluͤssig mit Masse uͤberladen
waͤren. In der Vertiefung jeder Staͤnderplatte finden sich die
Loͤcher fuͤr die Bolzen. Gesimse und Staͤnderplatten bilden
nach dem Gestelle hin voͤllig gerade Flaͤchen, damit sie sich gut
an's Holz desselben anschließen. Was die einzelnen Verzierungen der
Lagerboͤke betrifft, so werden sie aus den Zeichnungen voͤllig
deutlich. Ihre Form bleibt der Wahl jedes Baumeisters uͤberlassen.
Die Dekplatte des Gestelles besteht aus einem Stuͤke und hat die
Laͤnge und Breite desjenigen hoͤher liegenden Theils der
hoͤlzernen Gestellplatte, die die Stiefel traͤgt. Sie hat nahe an
ihren beiden Enden fuͤr die Fortsaͤze der Stiefel vierekige
Oeffnungen und ist rund um selbigen herum, und zwar nach unten, diker gegossen,
um an dieser Stelle die gehoͤrige Staͤrke zu besizen. Ihre Dike
muß verschieden nach der Kraft der Maschine eingerichtet werden. Fuͤr
eine zehnpferdige Maschine ist Ein Zoll Dike hinreichend. In der Gegend der
Oeffnungen wuͤrde ich sie indessen gerne 1 1/2 Zoll stark gießen
lassen.
Ihre Construction ist auf beiden Enden verschieden. Da die Leitstangen fuͤr die Bewegung der
Kurbel an dem dahin gekehrten Ende der Platte unter das Niveau derselben
hinabsteigen, wenn die Kurbel den untern Theil ihres Kreises beschreibt, so ist
es noͤthig, daß die Platte an diesen Stellen Vertiefungen enthalte. Die
Form und Groͤße derselben kann man leicht bestimmen, wenn man in dem
Aufrisse der Maschine, von dem mittlern Stande des Querstuͤks des
Staͤmpels zu der Kurbelwarze in ihrem tiefsten Stande, eine Linie zieht.
Man sieht in Fig. 6, 7, 8, 9 und 10 die Platte in
verschiedenen Stellungen gezeichnet. Fig. 6 zeigt eine
Ansicht derselben von oben, a, und b, sind die Oeffnungen zur Aufnahme der
Stiefelfortsaͤze, c, und d, die Oeffnungen fuͤr die die Stiefel
tragenden kleinen Saͤulen; e, f, g, und h, die Oeffnungen fuͤr die Schrauben zur
Befestigung des Gouverneurgestells, i, i, i, i,
verschiedene Loͤcher fuͤr die, die Platte an das Gestell
anziehenden, Bolzen. Diese Bolzen koͤnnen die naͤmlichen seyn, die
die einzelnen Theile des Gestelles unter sich vereinigen. k, und l, sind die Vertiefungen
fuͤr die Leitstangen. Sie liegen gleich neben dem Stiefel und haben am
Rande der Platte ihre groͤßte Tiefe.
Fig. 7
stellt die untere Flaͤche der Platte vor. In allen Figuren der Platte
bezeichnen gleiche Buchstaben gleiche Gegenstaͤnde. Man sieht hier auch
bei, k, und l, die
Vertiefungen. An dem Rand, m, der Platte ist eine
aufstehende Wand, n, von der Hoͤhe des die
Stiefel tragenden hoͤhern Theils der Gestellplatte angegossen.
Fig. 8 ist
ein senkrechter Laͤngsdurchschnitt der Platte durch die Mitte derselben.
Man sieht hier bei, n, die aufstehende Wand und bei,
k, die hintere Vertiefung und ihre Form.
Fig. 9 ist
die Endansicht der Platte nach der Kurbel hin. Sie stellt die aufstehende Wand
derselben vor. Man sieht hier bei, k, und l, die beiden Vertiefungen.
Fig. 10
ist ein senkrechter Querdurchschnitt derselben nahe an der aufstehenden Wand.
Zwei Woͤlbungen der Platte bilden die Vertiefungen, k, und l, in
derselben.
II. Dampfstiefel. Fig. 1, e, und f, Fig. 14,
15
(im perpendikulaͤren Laͤngedurchschnitte).
Die Dampfstiefel verfertigt man am besten aus Gußeisen und dreht und polirt ihren
cylindrischen Theil, um theils das Ausstrahlen von Hize zu vermindern, theils
ihr Ansehen zu erhoͤhen. Sie werden mit ihrem Fortsaze aus einem
Stuͤke gegossen. Damit der Guß recht dicht ausfalle, wuͤrde ich
sehr rathen, sie mit einer hohen Saͤule, einem sogenannten verlornen
Kopfe, und ohne alle Hoͤhlungen zu gießen. Leztere koͤnnen
saͤmmtlich mit leichter Muͤhe hineingebohrt werden, und zwar mit
einem halbrunden Bohrer, wie ich ihn im polytechn. Journale vor Kurzem nur
beschrieben habeIn London ließ ich die zwei Stiefel meiner ersten daselbst erbauten
Maschine, nachdem ich die, spaͤter noch zu erwaͤhnenden,
Oehlgefaͤße abgenommen hatte, mit Blei ausgießen, um den
fruͤher durch das Oehl ausgefuͤllten Raum zwischen Stiefel
und Staͤmpel fortzuschaffen. Dieß fuͤhrte ich in der Art
aus, daß ich um jeden Staͤmpel Papier klebte, ihn dann in den
Cylinder oder vielmehr Stiefel bis auf den gesezlich tiefsten Stand
hineinschob, die Stopfbuͤchse mit Lehm ausfuͤllte, damit
mir das Blei dort nicht herausfloͤsse, und nun das heiße Blei
eingoß. Zu bemerken ist aber, daß ich die Stiefel und Staͤmpel
vor dem Eingießen gehoͤrig erhizte, damit mir das Blei an ihren
Waͤnden nicht zu schnell erkalten und Hoͤhlungen bilden
sollte. Nach dem Erkalten des Bleies wurde der Staͤmpel sehr
leicht herausgezogen und das im Stiefel zuruͤkbleibende Papier
aus der entstandenen Hoͤhlung des Stiefels herausgenommen. Ich
muß bekennen, daß diese Fuͤtterung der Stiefel sehr gut
stand.. Die in der Zeichnung vorliegenden Stiefel sind auf 3 1/16 Zoll gebohrt.
Bei dieser Weite bleibt ein beinahe unmerklicher Zwischenraum zwischen ihren
Waͤnden und den dreizoͤlligen Staͤmpeln, der indessen
vollkommen hinreicht, um eine Reibung des Staͤmpels an diesen
Waͤnden zu verhuͤten. Groͤßer darf dieser Zwischenraum
nicht seyn, weil er ein schaͤdlicher Raum ist, dessen Fuͤllung
Dampf verschwendet. Bei a, Fig. 15 ist ein
Futter von Messing eingelassen, durch welches der Staͤmpel genau
arbeitet. Es wird bloß lose eingesezt, kann dessen ungeachtet aber nie loker und
los werden, indem die Liederung es in seiner Lage befestigt. Es ist nach der
Stopfbuͤchse hin ein wenig trichterfoͤrmig ausgedreht, damit es
den Hanf recht dicht an den Staͤmpel andraͤnge.
Die Stopfbuͤchse bildet eine Erweiterung um den Staͤmpel von 3/4
Zoll Breite. In dieselbe wird der Stopfpfropfen vermittelst seiner Scheibe Fig. 15,
b, hineingezwaͤngt und druͤkt die
Liederung fest um den Staͤmpel zusammen. Das Andruͤken der Scheibe
geschieht durch vier Schrauben, die durch dieselbe laufen und in den breiten
Rand, c, des Stiefels eingeschroben werden. Die
Scheibe ist 3/4 Zoll stark und der Stopfpfropfen ragt, von der Scheibe an
gerechnet, zwei Zoll hervor. Er ist nach der Stopfbuͤchse hin, so wie das
Futter, kegelfoͤrmig ausgedreht. Diese Einrichtung hat den Vortheil, daß
der Pfropfen laͤnger seyn kann, ohne doch der Laͤnge der Liederung
um den Staͤmpel herum Eintrag zu thun. Eine groͤßere Laͤnge
desselben ist aber aus dem Grunde wuͤnschenswerth, weil er so besser in
die Stopfbuͤchse eindringt, ohne bei ungleichem Anziehen der Schrauben
sich sehr zu klemmen, oder gar fest zu stemmen. Der Canal desselben, durch
welchen der Staͤmpel arbeitet, ist mit Messing ausgefuͤttert. Der
Staͤmpel muß sehr genau und fleißig, und doch dabei willig durch
denselben gehen.
Das Futter sowohl des Schlußpfropfens, als das im Boden der Stopfbuͤchse,
werden von einer Mischung von sieben Theilen Kupfer und Ein Theil Zinn gegossen.
Diese Mischung cohaͤrirt mit Eisen in großer Hize wenig und verursacht unbedeutende
Reibung. Sie hat mir an meiner Maschine in England vortreffliche Dienste
gethan.
Anmerkung. Eigentlich findet zwischen den Futtern und
dem Staͤmpel gar keine Reibung Statt, da die Liederung diesem allein die
Fuͤhrung gibt. Nur dann, wenn die Stopfbuͤchse sehr fehlerhaft
gepakt waͤre, koͤnnte ein Schleifen des Staͤmpels an einer
oder der andern Seite des Futters Statt finden. Ich habe bei meiner Maschine
bisher dergleichen noch nicht erfahren. Staͤmpel und Futter blieben in
dem besten Zustande und an beiden ist nie die geringste Abnuzung zu bemerken
gewesen. Nichts ist aber auch in der That leichter, als Stopfbuͤchsen
gleich und regelmaͤßig zu paken, vorzuͤglich wenn es mit guten
Hanfflechten geschieht.
Die Stiefel haben fuͤnf Zoll aͤußeren Durchmesser, also beinahe Ein
Zoll Metallstaͤrke. Bei der Stopfbuͤchse vergroͤßert sich
der Durchmesser um Ein Zoll. Die Scheibe Fig. 15 u. 16, c, am Ende derselben haͤlt 7 1/2 Zoll und ist
1 1/2 Zoll dik. In derselben befinden sich die Gewinde fuͤr die vier
Schrauben der Stopfbuͤchse. Auch ist in dem untern Theile derselben die
kleine Saͤule eingeschroben, die den Stiefel unterstuͤzt und auf
der Gestellplatte ruht. Die Scheibe des Stopfpfropfens hat den Durchmesser der
Stiefelscheibe.
An dem der Stopfbuͤchse entgegengesezten Ende der Stiefel befindet sich
ein prismatischer Theil, d, der die Ventile
enthaͤlt. Er hat an seiner aͤußeren Flaͤche eine kugligte
Erhabenheit, e, die als Verzierung dient. Auch die
uͤbrigen Seiten des prismatischen Theils sind durch kleine versenkte
Felder, f, geschmuͤkt. Von dem prismatischen
Theile erstrekt sich herunterwaͤrts der Fortsaz, g, worin sich die Canaͤle fuͤr den Zu- und Abfluß
der Daͤmpfe befinden. In der Mitte dieser Canaͤle laufen die
Ventilstiele abwaͤrts. Der Fortsaz ist etwas schmaͤler als der
prismatische Theil des Stiefels und sein Durchschnitt bildet ein
laͤnglichtes Vierek, dessen schmaͤlere Seiten nach vorne und
hinten liegen, und nur 3 1/2 Zoll breit sind, waͤhrend die
laͤngeren 6 1/2 Zoll halten. Nach hinten befindet sich in dem Fortsaze
der Dampfcanal, nach vorne der Abzugscanal. Beide liegen neben und hinter
einander, doch in solcher Entfernung, daß der Schliz, der quer durch den Fortsaz
geht und den Keil, zur Befestigung des Stiefels an der gußeisernen
Gestellplatte, aufnimmt, gehoͤrig Plaz zwischen ihnen findet. Der
Dampfcanal ist enger, als der Abzugscanal. Ersterer haͤlt 1 5/8, lezterer
zwei Zoll Durchmesser im Lichten. Beide werden durch halbrunde Bohrer in den
Fortsaz eingebohrt, der Schliz fuͤr den Keil wird aber gleich beim Guß
gebildet. Er liegt gerade im Centrum des Fortsazes und ist 1 1/2 Zoll hoch und 1/2 Zoll breit.
Die Entfernung seines obern Randes von der Achse des Stiefels betraͤgt
acht Zoll. Man sieht den Fortsaz mit den Ventilcanaͤlen in Fig. 16
und 17 in
zwei perpendikulaͤren Durchschnitten abgebildet, und zwar bei Fig. 16 im
Laͤngs-, bei Fig. 17 im
Querdurchschnitte.
Der Dampf- und Abzugscanal, a, und b, reichen in der angegebenen Weite nicht bis zur
innern Hoͤhlung des Stiefels hinauf, sondern haben oben eine Verengerung,
c, und d. Diese hat
in ersterem 1/2, in lezterem Ein Zoll Durchmesser. Beide Verengerungen
muͤnden sich seitwaͤrts in die Hoͤhlung des Stiefels, wie
man in Fig.
16 bei, e, und f, sieht. Die untere Muͤndung dieser verengerten Canaͤle
bildet, die Ventilsize und ist deßhalb konisch ausgedreht. Sowohl in dem
Dampf- als Abzugscanale befindet sich eine Seitenoͤffnung, g, und h, die in beiden
an der innern Seite des Fortsazes angebracht ist. Im Dampfcanale hat diese
Oeffnung Ein Zoll Durchmesser, in lezterem bei, h, 2
1/4 Zoll. Die erstere liegt hoͤher als die leztere, und zwar nur vier
Zoll unter der Achse des Stiefels, waͤhrend das Centrum der leztern 11
1/2 Zoll davon entfernt ist. An diese Oeffnungen werden Dampf- und
Exhaustionsroͤhre angeschroben.
Die untern Enden des Dampf- und Abzugscanals sind mit Gewinden versehen,
so daß die beiden messingenen Roͤhren, i, und
k, in dieselben eingeschroben werden
koͤnnen, welche an ihrem untern Ende die Stopfbuͤchsen, l, und m, fuͤr
die Ventilstiele enthalten. Ihr Rand greift in eine ringfoͤrmige
Vertiefung der Fortsaͤze ein, und wird durch einen Bleiring gedichtet.
Damit derselbe das Blei gehoͤrig festhalte, werden ringfoͤrmige
Furchen in selbigen gedreht. Wegen der Vertiefung in den Fortsaͤzen ist
es dem Bleiringe unmoͤglich, beim Anschrauben des Randes auszuweichen.
Die Form der Roͤhren (i, und k,) ist theils aus eben bezeichneten Figuren, theils
aus Fig. 4
deutlich, wo sie von außen dargestellt erscheinen. Sie nehmen in ihrem Canale
die Ventilstiele Fig. 16 und 17, n, und o, auf und haben
unten um den Ventilstiel eine Erweiterung, p,
fuͤr die Liederung. Die Stopfpfropfen, q,
werden in diese Erweiterung eingeschroben, weßhalb selbige auf 1/3 ihrer
Hoͤhe von unten herauf mit einem Gewinde versehen sind. Damit die
Liederung sich nicht in's Gewinde sezen koͤnne, und das Einschrauben des
Stopfpfropfens verhindere, wird zuerst ein Ring von Messing, r, auf die Liederung geschoben, der das Gewinde dekt
und nun der Stopfpfropfen auf diesen geschroben. Auf diese Weise zwaͤngt
der Stopfpfropfen die Liederung nur mittelbar durch den Ring zusammen, welcher
leztere nach der Liederung hin konisch ausgedreht ist. Der ringfoͤrmige
Raum fuͤr die Liederung um den Ventilstiel herum ist nur 1/2 Zoll
breit.
Anmerkung. Ich richte den Raum fuͤr die
Liederung in allen Stopfbuchsen moͤglichst eng ein und lasse stets sowohl
den Boden der Buͤchsen als den Stopfpfropfen konisch ausdrehen. Dadurch
gewinne ich sehr dichte Stopfbuͤchsen, selbst bei dem hoͤchsten
Druke. Die Sache ist sehr erklaͤrbar. Wenige Liederung laͤßt sich
naͤmlich fester und dichter zusammen pressen, als eine große Menge
derselben. Die keilfoͤrmige Gestalt der sie zusammendraͤngenden
Organe vermehrt aber ihren Anschluß an die zu dichtenden Staͤmpel,
Stangen oder Stiele. Zugleich haben enge Stopfbuͤchsen den Vortheil, daß
sie einer weniger hohen Saͤule von Liederung beduͤrfen. Aller
dieser Umstaͤnde wegen sparen sie sehr an Hanf und Schmiere. Die
Liederung meiner Staͤmpel ist nur zwei, die meiner Ventilstiele nur Ein
Zoll lang oder hoch.
Da, wo die Fortsaͤze der Stiefel durch die Oeffnung der gußeisernen
Gestellplatte gehen, haben sie oberhalb derselben einen sokelartigen Ansaz Fig. 13,
und 14,
h, womit sie auf dem Rande der
Plattenoͤffnung ruhen. Zwischen diesen und der Platte rathe ich einen
Kranz von Eisenblech zu legen. Durch selbigen ist es leicht, die Stellung des
Stiefels gehoͤrig zu berichtigen, indem man von denselben so lange
abfeilen kann, bis der Stiefel mit dem gegenuͤberstehenden genau in einer
Achse liegt.
Die Hoͤhe des Fortsazes betraͤgt, von dem prismatischen Theile des
Stiefels an gerechnet, zehn Zoll, die der messingenen, unten in seine
Canaͤle eingeschrobenen, Roͤhren mit ihren Stopfbuͤchsen
fuͤnf Zoll. Beide zusammen sind gerade so lang, daß sie vor der
Hoͤlzernen Gestellplatte nach unten nicht hervorragen. Sie liegen in
einem Canale dieser Platte, der durch das Holz derselben gestemmt und in Fig. 3.
bei, p, deutlich zu sehen ist.
III. Staͤmpel. Fig. 1,
2 und
3, und
4, C.
Derselbe ist eine voͤllig cylindrische Stange von geschmiedetem oder auch
Gußeisen. Er muß sehr genau abgedreht und gut polirt seyn. Seine Enden sind ein
wenig abgerundet. Genau in seiner Mitte hat er einen Schliz, s, fuͤr den Keil, der ihn mit dem
Querstuͤke, t, verbindet. In der vorliegenden
Maschine von zehn Pferdeskraͤften betraͤgt sein Durchmesser drei,
seine ganze Laͤnge 56 Zoll.
Bei sehr großen Maschinen kann derselbe hohl gegossen werden, um sein Gewicht
etwas zu vermindern. Er wird deßhalb Staͤrke genug behalten.
Vielleicht waͤre es von Nuzen, ihn mit Kupfer zu uͤberziehen, um
das Rosten desselben zu verhuͤten, indessen fehlen mir daruͤber
ganz die Erfahrungen. Meine Staͤmpel in London waren von geschmiedetem
Eisen und standen
vortrefflich. Ich habe sie nie von Rost ergriffen gesehen, selbst wenn die
Maschine laͤngere Zeit außer Thaͤtigkeit war.
IV. Vorrichtungen zur vollkommenen
Dichtung des Staͤmpelganges in den Stiefeln.
Ich habe ihre Einrichtung oben schon oberflaͤchlich angegeben. Hier das
Speciellere. Deutliche Abbildungen davon sieht man in Fig. 4 und 15. Fig. 15.
stellt den Durchschnitt eines Stiefels, der die Stopfbuͤchse und eine
jener Vorrichtungen enthaͤlt, vor. A, ist der
Staͤmpel, B, die Stopfbuͤchse, C, der Stopfpfropfen derselben mit seiner Scheibe,
a, das messingene Futter im Grunde der
Stopfbuͤchse, dessen Form und Art der Einsezung die Zeichnung vollkommen
deutlich macht; f, und g, ist die Hanfliederung, von Hanfflechten gemacht. Der messingene Ring
(von oben angegebenem Metalle) theilt dieselbe in zwei gleiche Haͤlften.
Dieser Ring paßt genau in die Stopfbuͤchse, und ist ungefaͤhr Ein
Zoll breit. Er ist an seiner aͤußern und innern Flaͤche hohl
ausgedreht, wie man in der Figur sieht, und bildet, wenn er in die
Stopfbuͤchse eingesezt ist, durch diese ringfoͤrmigen Austiefungen
einen Canal, sowohl rund um den Staͤmpel, als an der Wand der
Stopfbuͤchse. Beide Canaͤle haͤngen durch drei oder vier
Oeffnungen zusammen, die durch die zwischen beiden Canaͤlen des Ringes
liegende Wand gebohrt werden. In Fig. 19 und 20. sieht
man den Ring besonders abgebildet, und zwar Fig. 19. im
perpendikulaͤren Querdurchschnitte, Fig. 20. von außen
und von der Seite. Fig. 19, a, und b, sind die
ringfoͤrmigen Austiefungen, c, c, c, c, die
Communications-Oeffnungen zwischen beiden. Fig. 20, a, ist die aͤußere ringfoͤrmige
Austiefung, b, eine der
Communications-Oeffnungen.
Wenn die Stopfbuͤchse beschikt wird, so werden erst Hanfflechten
eingelegt, dann schiebt man den Ring hinein und pakt nun eine gleiche
Quantitaͤt Hanfflechten oben darauf. Das Ganze wird dann durch
Einpressung des Stopfpfropfens zusammen gezwaͤngt. Bei gehoͤrig
gleicher Staͤrke der beiden Theile der Liederung wird der Ring immer so
ziemlich in die Mitte zu liegen kommen, was auch durchaus noͤthig ist,
wenn seine aͤußere ringfoͤrmige Austiefung auf die
Wasserzubringungs-Roͤhre, h, Fig. 4.
treffen soll. Ein Maschinen-Aufseher, der erst mit seiner Maschine
Bescheid weiß, wird schon nach dem Augenmaße die Menge des Hanfes fuͤr
beide Theile der Liederung treffen lernen. Uebrigens kann er sich aber auch
durch Abwaͤgen derselben helfen, wenn er ein Mal das Gewicht der zur
Beschikung der ganzen Stopfbuͤchse noͤthigen Liederung kennt. Ist
die Stopfbuͤchse gehoͤrig gepakt, so trifft die
Wasserzubringungs-Roͤhre, h, genau in
die aͤußere Austiefung des Ringes und den dadurch gebildeten
ringfoͤrmigen Canal zwischen Ring und Wand der Stopfbuͤchse. Das
Wasser kann nun auf verschiedene Weise in den Ring geleitet werden.
1) Von der Wasserzubringungs-Roͤhre fuͤhrt ein kleines
kupfernes Rohr zu einer kugelfoͤrmigen Erweiterung der nach unten und
etwas nach hinten liegenden Dampfroͤhre. Dieses Rohr geht erst senkrecht
abwaͤrts, kruͤmmt sich dann wieder dem Dampfrohre zu
aufwaͤrts und muͤndet sich bei, e, an
dem tiefsten Theile seiner kugelfoͤrmigen Erweiterung in selbiges. Das
Rohr wird an den Stiefel nach einer, weiter unten zu beschreibenden, Methode
angedichtet.
In Fig.
18. ist ein perpendikulaͤrer Querdurchschnitt durch die
Stopfbuͤchse des Stiefels, und zwar durch den Ring desselben genommen,
vorgestellt, a, bezeichnet in der Figur den
Staͤmpel, b, den Ring, c, das durch die Wand der Stopfbuͤchse gebohrte, in den
aͤußern Canal des Ringes fuͤhrende, Wasserrohr, d, das von demselben abfuͤhrende
duͤnne kupferne Rohr. Es geht erst nach unten, kruͤmmt sich bei,
e, wieder aufwaͤrts und muͤndet
sich von unten in die kugelfoͤrmige Erweiterung des Dampfrohres, f. g, ist die, aus der kugelfoͤrmigen
Erweiterung in's Dampfrohr fuͤhrende, Oeffnung, h, das, in derselben sich angesammelt habende, Wasser.
Die Wirkung dieser Vorrichtung besteht darin, daß das, in der
kugelfoͤrmigen Erweiterung der Dampfroͤhre sich sammelnde, und aus
einem Theile der, durch die Beruͤhrung der Atmosphaͤre an den
Waͤnden des Dampfrohrs sich verdichtenden Daͤmpfe gebildete,
Wasser durch den Druk der Daͤmpfe in das Rohr, d, und von diesem in den Ring getrieben wird, und sich in dessen
Canaͤlen vertheilt. Hier uͤbt es, da es durch die Daͤmpfe
des Dampfrohrs stets unter starkem Druke erhalten wird, einen Gegendruk gegen
die, in den Stiefeln wirkenden. Daͤmpfe aus, so daß diese bei der innern
Liederung vorbei in den Ring nicht entwischen koͤnnen. Da Wasser wegen
seiner Schwerfluͤssigkeit gute Liederungen nicht leicht durchdringt, so
kann kein bedeutender Verlust desselben Statt finden und der im Dampfrohre sich
immer sammelnde kleine Vorrath davon wird voͤllig genuͤgen, den
Ring immer damit zu speisen. Das Wasser verhuͤtet zugleich eine zu große
Beschaͤdigung des Hanfes durch die Hize.
Anmerkung. Ich habe in England gefunden, daß der Hanf
bei einem Druke der Daͤmpfe von 600 bis 700 Pfd. auf den Quadratzoll und
einer, diesem Dampfdruke entsprechenden, Hize nicht in dem Maße zerstoͤrt
wird, daß er zur Dichtung der Stopfbuͤchsen untauglich wuͤrde.
Wohl habe ich bemerkt, daß er nach laͤngerer Wirkung der Maschine mit
sehr hohem Druke bei der Herausnahme aus den Stopfbuͤchsen leicht zu
zerzupfen, folglich
muͤrbe gemacht war, deßhalb hielt er aber dennoch bis auf den lezten
Augenblik vollkommen dicht und nie konnte ich eine Spur eines Verlustes
desselben entdeken. Ich habe vielfaͤltig daran gedacht, in sehr großer
Hize die Stopfbuͤchsen mit Asbest zu liedern, bis jezt aber noch keine
genuͤgenden Versuche daruͤber anzustellen Gelegenheit gehabt, da
ich in England durchaus keinen langfaserigten Asbest bekommen konnte. Das
Gelingen dieses Planes waͤre gewiß keinem Zweifel unterworfen, wenn nicht
ein bedeutender Verlust des Asbestes durch Verschmierung zu fuͤrchten
waͤre. Bei fortgesezter Reibung verwandeln sich seine Fasern
naͤmlich leicht in ein feines Pulver, das mit dem Wasser und der Schmiere
sich vermischt und auf diese Weise nach und nach verloren geht. So viel ist
gewiß, daß der Asbest bei seiner talkartigen Beschaffenheit sehr wenig Reibung
verursachen wuͤrde. Ich behalte mir genauere Versuche daruͤber
vor. Ein Versuch, den ich in England mit einer ganz kleinen Staͤmpelpumpe
anstellte, gelang vollkommen, obgleich der Asbest von der schlechtesten Gattung
war. Er hielt vortrefflich Fett und der Staͤmpel arbeitete sehr dicht,
obgleich ich ihn bis zur blauen Farbe erhizte. Die von ihm verursachte Friktion
war sichtbar geringer als bei der Liederung mit Flachs; indessen schien sich
etwas Asbest zu verschmieren.
2) Die Versorgung des Ringes mit Wasser kann aber auch noch vom Stiefel selbst
aus geschehen. Die dahin zwekende Vorrichtung sieht man Fig. 4, E. Von der Wasserzubringungs-Roͤhre
geht naͤmlich ein kleines kupfernes Rohr, q,
zu dem andern Ende des Stiefels und muͤndet sich hier in den Boden
desselben. Die innere Hoͤhlung des Stiefels ist an dieser Stelle durch
einen Versenkbohrer etwas vertieft, so daß sie daselbst einen kleinen Sumpf, r, bildet. In diesem sammeln sich die im Cylinder
sich verdichtenden Daͤmpfe mit der Schmiere zu einer Emulsion
zusammengequirlt, und werden durch den Druk der Daͤmpfe im Stiefel in den
Ring getrieben. Wie leicht einzusehen, entspricht hier der Druk im Ringe immer
dem der Daͤmpfe im Stiefel, wo er wegen der Anwendung des
Expansions-Principes stets veraͤnderlich ist, waͤhrend er
bei der vorher beschriebenen Vorrichtung unter dem, im Dampfrohre Statt
findenden und sich immer gleich bleibenden, steht. Die Vorrichtung hat noch den
Vortheil, daß dem Ringe auch zugleich ein mehr oder weniger lubrificirendes
Mittel zugefuͤhrt wird. Dessen ungeachtet habe ich nicht das Vertrauen zu
ihr, wie zur ersten. Vergleichende Versuche ihres Werthes sind sehr leicht
anzustellenAn meiner in England erbauten ersten Probemaschine ließ ich die
Daͤmpfe nicht unmittelbar auf den Staͤmpel
wirken, sondern sezte auf die Stiefel vier Fuß hohe Oehlgefaͤße
von beinahe doppeltem Durchmesser (im Lichten) der Staͤmpel.
Diese, so wie den Raum um die Staͤmpel in den Stiefeln, der 1/2
Zoll breit war, fuͤllte ich mit Oehl und brachte im obern Theile
der Oehlgefaͤße auf dem Oehlspiegel einen hoͤlzernen
Schwimmer an, auch fuͤtterte ich diesen Theil der
Oehlgefaͤße selbst mit Holz aus, um die Mittheilung der Hize der
Daͤmpfe an's Oehl so viel moͤglich zu verhuͤten.
Durch diese Einrichtung wollte ich, nach Hrn. Maschinendirektor Henschel's in Cassel Methode (s. Gilberts
Annalen, Jahrgang 1819 Stuͤk 4, Seite 405) die Staͤmpel
der Dampfstiefel kalt arbeitend machen, was mir auch vollkommen gelang,
indessen fand sich zu meinem großen Leidwesen, daß das Oehl stets mit
zur Exhaustionsroͤhre ausgeblasen wurde. Alle Mittel, die ich
dagegen versuchte, waren mehr oder weniger fruchtlos, und selbst als ich
den obern Oehlgefaͤßtheil bohren ließ und mit gliederten
Schwimmern versah, war der Oehlverlust noch immer so bedeutend, daß er
bei stetem Gange der Maschine einen großen Kostenaufwand verursacht
haͤtte. Das Oehl floß nun zwar nicht unvermischt ab, sondern war
durch die Reibung der Schwimmer an den Oehlgefaͤßewaͤnden
mit den in denselben sich verdichteten Daͤmpfen so durchgequirlt,
daß es an der Exhaustionsroͤhre gleich einer starken Emulsion
sich zeigte und fortwaͤhrend abfloß. Sollte Herr Henschel die von
ihm intendirten Oehlgefaͤße wirklich so ausgefuͤhrt haben,
als er es in Gilberts Annalen l. c. angibt,
so wird er diesen Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten auch gewiß
nicht entgangen seyn. So vortrefflich die Idee ist, durch hohe
Oehlschichten die Hize von den arbeitenden Cylindern und
Staͤmpeln abzuhalten und so außerordentliche Vortheile daraus
fuͤr sehr hohen Druk erwachsen, so wenig duͤrfte dieselbe
je ausfuͤhrbar werden. Ich habe es genug bedauert, daß ich in
England durch diesen Mißgriff, der sich durch das warme Interesse, was
ich an der damals von allen Seiten her angeregten und empfohlenen
Anwendung hoͤherer oder niederer Oehlschichten sowohl
uͤber als unter dem Kolben der Treibcylinder nahm, wohl
entschuldigen laͤßt, so viel Zeit verloren habe. Er wurde
fuͤr mich die Quelle großer Unannehmlichkeiten,
vorzuͤglich dadurch, daß bei der Arbeit der Maschine durch den
Oehlverlust so große schaͤdliche Raͤume in den
Oehlgefaͤßen entstanden, die nun einen großen, oft dreifachen
Dampfconsum herbeifuͤhrten. Er war vorzuͤglich die
Ursache, daß von manchem Beurtheiler die Kraft meiner Maschine verkannt
wurde, weil diese nachließ, sobald jene schaͤdlichen
Raͤume einen uͤbermaͤßigen Dampfverbrauch
herbeifuͤhrten, auf den weder der Entwikelungs-Apparat
noch das in denselben gesprizte Wasserquantum berechnet waren..
V. Vorrichtungen zum Schmieren des
Staͤmpels.
Ich habe als Schmiere gereinigten guten Rindertalg am liebsten, und auch mit dem
meisten Nuzen angewandt. In den meisten Gegenden Deutschlands duͤrfte
seine Anschaffung auch mit geringem Kosten verbunden seyn, als die der bessern
gereinigten Oehle. Er sezt wenig Schmuz und schleimige Bestandtheile an den Hanf
ab, weßhalb dieser sich laͤnger schwammiger und elastischer haͤlt,
als bei der Anwendung von schlechten Oehlen, deren viele schleimigte
Bestandtheile darin erhaͤrten, ihn hart und steif und seine
oͤftere Erneuerung noͤthig machen.
Meine Vorrichtung zum Schmieren der Staͤmpel steht auf der Scheibe des
Stopfpfropfens und ist auf selbige angeschroben. Sie communicirt mit einem
kleinen Canale, der die Scheibe senkrecht durchbohrt und bis auf den
Staͤmpel fuͤhrt. In Fig. 21. ist die
ganze Vorrichtung in gehoͤriger Groͤße dargestellt. In Fig. 4.
sieht man bei s, den eben beruͤhrten Canal.
Die Vorrichtung selbst besteht aus einer messingenen Fettbuͤchse in Gestalt einer
kleinen Vase. Sie ist mit ihrem Fuße in die Scheibe eingeschroben, wie man
sowohl in Fig.
4. als in Fig. 21. bei a, deutlich sehen kann, und mit einem Dekel, b, geschlossen, der lose darauf gesezt wird, indem
er durch den ringfoͤrmigen, in die Buͤchse eingreifenden
Vorsprung, c, vor jedem Vorschieben nach der Seite
gesichert ist. Er schuͤzt das in der Buͤchse enthaltene Fett vor
Verunreinigung. Der Fuß der Buͤchse enthaͤlt eine cylindrische
Hoͤhlung, d, aus welcher nach unten der
Canal, e, zu dem Staͤmpel fuͤhrt, der
zur Leitung des aus der Buͤchse kommenden Fettes nach diesem hin bestimmt
ist. In die Hoͤhlung, c, hinein kann ein
Stopfpfropfen, f, geschroben werden. Dieser Pfropfen
ist senkrecht durchbohrt und hat bei g und h, noch zwei Seitenoͤffnungen, die das Oehl
aus der Buͤchse in den senkrechten Canal fuͤhren. In den obern
Theil, i, des Canals ist die Stange, k, eingesezt und befestigt, die durch den Dekel der
Buͤchse geht und hier mit ihrem vierekigen Zapfen in eine gleiche
Hoͤhlung der hoͤlzernen oder elfenbeinernen Eichel oder Kugel, l, paßt. An dieser Stange kann der Stopfpfropfen
außerhalb der Buͤchse gedreht und mehr oder weniger in die
Hoͤhlung, d, gedruͤkt werden. Die
hoͤlzerne oder elfenbeinerne Eichel oder Kugel dient dabei als
Schluͤssel und stekt nur lose auf den Zapfen der Stange, damit der Dekel
der Buͤchse ohne Umstaͤnde abgenommen werden koͤnne, wenn
sie von neuem mit Fett oder Talg gefuͤllt werden muß. In die
Hoͤhlung, d, wird ein Stuͤk
Fensterschwamm gelegt, der das Fett der Buͤchse nur langsam durchsikern
und durch den Canal auf den Staͤmpel abtroͤpfeln laͤßt. Je
staͤrker man den Stopfpfropfen in die Hoͤhlung hineinschraubt, je
fester wird der Schwamm zusammengedruͤkt und je weniger Fett oder Talg
laͤßt er abtroͤpfeln. Bei dieser Einrichtung kann der
Maschinenmeister genau die Menge Fett abstießen lassen, die zur
zwekmaͤßigen Schmierung des Staͤmpels noͤthig ist. Er
braucht nur die Eichel oder Kugel, die von schlechten Waͤrmeleitern
construirt sind, und daher das Verbrennen seiner Finger verhuͤten,
vor- oder zuruͤkdrehen, um dadurch den Stopfpfropfen mehr oder
weniger in die Hoͤhlung, d, einzutreiben.
Beim Stillstande der Maschine kann man den Stopfpfropfen fest niederschrauben,
damit bis zu ihrem Kaltwerden, wobei der Talg erstarrt, nicht zu viel desselben
unnuͤz abtroͤpfle. Wo man finden sollte, daß der Schwamm durch das
zu starke Zusammenpressen litte oder wo man das beim wiedererfolgenden Anlassen
der Maschine noͤthige Experimentiren zur neuen Auffindung eines
gehoͤrigen Grades des Fettabtroͤpfelns vermieden wuͤnscht,
da kann man das vorbeifließende Fett in einer Schale auffangen, die man unter
die Stopfbuͤchse des Stiefels in eine Vertiefung der gußeisernen
Dekplatte stellt. Das darin aufgefangene Fett wird wieder in die
Fettbuͤchse gethan und von neuem verwandt. Diese Maßregel zur
Abhuͤlfe eines Talgverlustes moͤchte fuͤr alle
Faͤlle die einfachste und gerathenste seyn.
Ich habe durch die Erfahrung gefunden, daß meine Maschine, auf diese
oͤkonomische Weise mit Fett versehen, nicht den zwoͤlften Theil
der Schmiere gewoͤhnlicher Maschinen mit niederem Druke gebraucht. Der
Staͤmpel verarbeitet erstaunlich wenig derselben, so daß bei einer
Maschine von 10 Pferdeskraft 1 Tropfen Fett fuͤr die Minute hinreicht, um
die Stopfbuͤchsen jedes Stiefels gehoͤrig damit zu versorgen. Wird
der Staͤmpel zu reich mit Schmiere gespeiset, so ist dieß sogleich daran
zu bemerken, daß selbige aus der Stopfbuͤchse nach unten
abtroͤpfelt; man darf dann den Stopfpfropfen nur mehr in die
Hoͤhlung, d, schrauben, um den Fehler
sogleich zu verbessern. Das etwa von der Stopfbuͤchse abfließende Fett
kann man in ebengenannter Schale wieder auffangen.
Da die Fettbuͤchse immer heiß ist, so haͤlt sich der Talg darin in
einem stets fluͤssigen Zustande.
Die Groͤßenverhaͤltnisse der Buͤchsen sind aus dem
beiliegenden Maßstabe zu ersehen.
VI. Steurung.
Sie wird, wie ich schon oben auseinandergesezt habe, durch konische Ventile
beschikt, die in den Canaͤlen der Stiefelfortsaͤze liegen. Was die
Construction derselben betrifft, so muß ich daruͤber Folgendes genauer
anfuͤhren: Sie werden mit ihrem Stiele ganz von StahlNoch besser ist es, die Ventilstiele von Eisen zu schmieden und einen
Kopf von Stahl in Form eines Ringes darauf zu schweißen. Diesen kann man
dann hart Machen, ohne daß man fuͤrchten darf, daß der Stiel die
Haͤrte, die ihn sproͤde und zum Abbrechen geneigt machen
wuͤrde, mit annehmen wird. geschmiedet und genau abgedreht. Der Stiel ist voͤllig
cylindrisch und muß, wenigstens an derjenigen Parthie, die in der
Stopfbuͤchse arbeitet, polirt seyn. Derjenige Theil desselben, der die
konische zu dichtende Flaͤche enthaͤlt, ist staͤrker, bei
dem Dampfventil 1 Zoll, dem Exhaustionsventil aber 10/8 Zoll stark,
waͤhrend der Stiel selbst bei beiden die Dike von 3/4 Zoll nicht
uͤberschreitet. Die konische Dichtungs-Flaͤche ist nicht
hoͤher als 1/4 Zoll und bildet mit dem Horizonte einen Winkel von 45 bis
50 Graden. Der verengerte Canal uͤber den Ventilen, der in die Stiefel
fuͤhrt, und dessen untere Muͤndung den Ventilsiz bildet, ist bei
dem Dampfventile 3/4 Zoll, bei dem Exhaustionsventile 1 Zoll weit.
Ungefaͤhr 1 1/2 Zoll tief unter dem obern Kopfe der Ventile ist auf den
Ventilstiefel eine messingene Scheibe geschoben, die dem Kopfe des Ventils die
Leitung gibt, damit er immer genau in den Siz treffe. Damit der Dampf durch
diese Platte aber
nicht abgesperrt werde, ist selbige nach drei Seiten weggefeilt. In Fig. 34
und 35.,
wo horizontale Querdurchschnitte durch die Ventilcanaͤle vorgestellt
sind, sieht man bei a, die Platte an dem
Ventilstiele, b. In den beiden Figuren stellt Fig. 34.
diese Vorrichtung an dem Exhaustionsventile, Fig. 35. selbige am
Dampfventile vor.
Zuweilen bohre ich die Canaͤle, c und d, Fig. 16. ganz durch,
wie in Fig.
17. zu sehen ist. Ich schließe dann die obere Oeffnung derselben durch
eine Schlußschraube, die den ganzen obern Theil des Canals ausfuͤllt und
so weit in denselben herunter geht, als sie irgend kann, ohne den großen
Staͤmpel des Dampfcylinders zu beruͤhren, wenn er in den
Dampfcylinder eingedrungen ist. Diese Einrichtung ist getroffen, um die
jedesmalige Fuͤllung des ganzen Canals mit Dampf zu verhuͤten. Die
Schlußschraube schließt in der obern Oeffnung durch einen konischen Ansaz dicht,
der beim Einschrauben gegen den scharfen Rand der obern Oeffnung gedruͤkt
wird. Bei eintretenden Maͤngeln an den Ventilen kann man die
Schlußschraube loͤsen, nachsehen und helfen.
Was die Bewegung der Ventile zu ihrem regelmaͤßigen Oeffnen und Schließen
betrifft, so geschieht diese, wie oben bemerkt ist, durch Hebel, die vermittelst
sogenannter Nasen an einer besondern Welle, der Steurungswelle, in den richtigen
Zeitmomenten gehoben und gesenkt werden. In Fig. 4. ist diese
Steurung in allen ihren Theilen im Aufrisse dargestellt. Man sieht hier bei l, die Ventilstiele, wie sie aus ihren
Stopfbuͤchsen hervortreten. Um ihren Gang recht zu sichern und gegen
schaͤdliches Draͤngen von Seiten der Hebel zu schuͤzen,
sind sie so lang, daß sie unten im Gestelle der Maschine noch eine Leitung in
einer messingenen Nut, t, erhalten, die an die
untere Gestellplatte so angeschroben ist, daß sie auf selbiger in ihrer Stellung
veraͤndert werden kann, wenn sie etwa aus der Achse der Ventilstiele
geruͤkt waͤre. Zu dem Ende befindet sich an der Nut ein Lappen,
u, mit einem Schlize, wodurch der Anziehbolzen,
v, geht. Auf den Stiel jedes Ventils sind zwei
Huͤlsen, m, m, von hartem Stahle geschoben
und durch einen kleinen Keil befestigt. Zwischen beiden spielt der Hebel, dessen
Ende an dieser Stelle gabelfoͤrmig gespalten ist und den Stiel umfaßt.
Die beiden Huͤlsen machen, daß die Ventilstiele jeder Bewegung der Hebel
folgen muͤssen; die den Hebel beruͤhrenden Flaͤchen der
Huͤlsen sind ein ganz wenig abgerundet. Obere und untere Flaͤche
der, den Ventilstiel umfassenden und gegen die Huͤlsen desselben
reibenden, Flaͤchen der Hebel sind gut verstahlt und gehaͤrtet. In
Fig.
29. ist das den Ventilstiel umfassende gabelfoͤrmige Ende eines
der Hebel von oben vorgestellt, a, ist das
gabelfoͤrmige Ende desselben, b, ein
Durchschnitt des Ventilstieles. Das Hypomochlion der Hebel dreht sich auf
einem staͤhlernen 3/4 Zoll starken Zapfen, der durch die beiden den Hebel
umfassenden Baken des Stuͤkes, w, Fig. 4,
geschoben ist. Zwischen diesen Baken bewegt sich der Hebel, wie in einem
Charnier. Das Stuͤk selbst ist eine starke eiserne Platte zur
Haͤlfte in das hoͤlzerne Querstuͤk, x, des Maschinengestelles eingelassen und daran durch einen Bolzen,
y, und starke Muttern, z, angezogen und festgehalten. Um das Hypomochlion des Hebels etwas
nach oben und unten verruͤken zu koͤnnen, dient der eiserne
Schieber, 1, der bei 2 eine schraͤge Flaͤche hat und bei 3 auf
einer eisernen, in das Querstuͤk eingelassenen Schiene ruht. Das Ende, 4,
desselben ist mit einem Gewinde versehen, auf welches eine Fluͤgelmutter
geschroben ist. Diese reibt gegen eine eiserne Schiene, die bei 5, die
perpendikulaͤre Wand des Querstuͤks bekleidet und durch welche
auch der Kopf des Bolzens, y, gehalten wird.
Derjenige Theil des Schiebers, der die schraͤge Flaͤche
enthaͤlt, liegt in einem Schlize des Stuͤkes, x. Wird die Fluͤgelmutter angezogen, so
draͤngt die schraͤge Flaͤche gegen den obern Rand des
Schlizes und schiebt das Stuͤk mit dem Hypomochlio des Hebels
hoͤher. Die Mutter, z, braucht nur so stark
angezogen zu werden, daß das Stuͤk noch einige Beweglichkeit zum
Auf- und Abschieben behaͤlt. Der Zwek der Verstellbarkeit des
Hebelhypomochlions wird sogleich angegeben werden. Da wo die Hebel in den
Querstuͤken des Maschinengestelles liegen, sind diese ausgeschnitten, um
ihnen freie Bewegung zu gestatten.
Beide Hebel, sowohl fuͤr das Dampf- als Exhaustionsventil, sind in
allen ihren Theilen voͤllig gleich eingerichtet. Sie liegen neben
einander und ihre bogenfoͤrmigen Enden, 6, treffen auf die
Steurungswelle, i, mit ihren Nasenscheiben. Diese
Enden enthalten eine kleine hart staͤhlerne Friktionsrolle, 7, die in
einem Schlize liegt und auf einem gleichfalls harten staͤhlernen Zapfen
laͤuft. Die Rolle hat nur 3/8 Zoll Breite und 1 1/2 Zoll Durchmesser und
muß sich voͤllig frei in dem Schlize bewegen koͤnnen. Die Hebel
der Ventile sind so zu stellen, daß ihre Friktionsrollen die Nasenscheiben nur
dann beruͤhren, wenn die Nasen zur Hebung derselben ihre Funktion
beginnen. Der Zwek dieser Anordnung ist leicht einzusehen. Da naͤmlich
die Ventile nach ihrer Oeffnung durch die, an ihren Hebeln angebrachten, Federn
in ihre Size gedruͤkt und darin erhalten werden sollen, so duͤrfen
die Hebelenden mit den Friktionsrollen auf keine Weise unterstuͤzt
werden, weil dadurch der Druk der Federn voͤllig aufgehoben
wuͤrde. Bei etwanigen Unrichtigkeiten in der Stellung der Hebel immer
gehoͤrig nachhelfen zu koͤnnen, ist eben jene vorhin bemerkte
Verstellbarkeit ihrer Hypomochlien noͤthig. Bei 8, ist jeder Hebel
durchbohrt und nimmt eine kleine Stange mit einem Gewinde auf, auf welche die
Fluͤgelmutter, 9, geschroben wird. Die Stange hat unten ein Charnier, 10, in welchem eine
andere vierekige Stange, 11, beweglich haͤngt, die durch eine
(gleichfalls) vierekige Oeffnung der Feder, n, geht
und unter derselben durch einen großen Knopf, 12, festgehalten wird. Diese ganze
Stangenvorrichtung dient zur Anspannung der Hebel durch die Feder. Bei dem
Anschrauben der Fluͤgelmutter, 9, und dadurch bewirkter
Verkuͤrzung der Stange, 10, kann der Druk der Feder auf den Hebel
beliebig gesteigert werden.
Es ist nur eine FederIch ziehe Federn den Gewichten vor, weil Gewichte bei der Schnelligkeit
der Hebelbewegung springen und so ihren Zwek voͤllig verfehlen
wuͤrden. fuͤr 2 und 2 gleiche Ventilgattungen vorhanden, so daß ihrer also
im Ganzen zwei existiren. Beide sind in der Mitte auf einer kleinen
laͤnglichten, gußeisernen, in die Gestellsohle, 13, eingelassenen,
erhabenen Platte, 14, durch den Bolzen, 15, befestigt, der durch die Sohle und
die Platte geht. Die Feder fuͤr die Dampfventilhebel braucht nur sehr
schwach zu seyn, indem die Schwere der Hebel fast allein schon hinreicht, diese
Ventile wieder zu schließen. Anders ist es bei den zu den Exhaustionsventilen
gehoͤrigen Hebeln. Diese sollen das Ventil mit einem großen Druke
geschlossen erhalten, wenn die Daͤmpfe in den Stiefel treten, daher muß
die dazu gehoͤrige Feder eine bedeutende Staͤrke haben. In der
vorliegenden Maschine muß sie auf jeden der Hebel mit 250 Pfund Druk und mehr
wirken.
Die Dimensionen der auf der Tafel vorgestellten Ventilhebel sind folgende: Vom
Centrum der Ventilstiele bis zum Hypomochlion der Hebel, 7 Zoll, von da bis zum
Centrum der Friktionswelle, 28 Zoll. Erstere Entfernung ist also vier Mal in der
lezteren vorhanden. Vom Hypomochlion bis zum Loche der Hebel fuͤr die
Federstange, 18 Zoll. Laͤnge der ganzen Feder, 22 Zoll, vom Mittelpunkte
derselben bis zum Befestigungspunkte der Stange, 10 Zoll. In Fig. 24. ist ein
Theil der Steurung von oben vorgestellt. Man sieht bei a,
b, c und d, die vier mit Friktionsrollen
versehenen Enden der Hebel, die auf den Nasen der Steurungswelle arbeiten. Sie
sind etwas seitwaͤrts gebogen, um richtig auf diese Nasen zu treffen. e, f, g und h, sind die
Befestigungspunkte der von den Federn kommenden Zugstangen. i, ist die Steurungswelle, k und l, sind die Zapfen, m, das konische Getriebe derselben.
Die Steurungswelle ist von geschmiedetem Eisen 1 1/2 Zoll stark und traͤgt
die vier gußeisernen Nasenscheiben. Sie laͤuft in zwei Lagern, von denen
das eine vorne, das andere hinten an die Gestellplatte angeschroben ist. Sie
sind von ganz gewoͤhnlicher Einrichtung, daher ich ihrer nicht weiter
Erwaͤhnung thun will. Die ganze Welle ist, beide 1 1/2 Zoll breite
Zapfen mitgerechnet, 14 Zoll lang. Nach hinten liegt eine Fortsezung derselben
außerhalb des Gestelles und traͤgt ein konisches Getriebe zur Bewegung
der Welle. Dieses konische Getriebe hat 5 Zoll Durchmesser und weiter nichts
Ungewoͤhnliches. Die Nasenscheiben liegen in der in Fig. 24. bezeichneten
Entfernung von einander.
In Fig.
25, 26, 27 und 28. sieht man alle
vier Nasenscheiben besonders abgebildet. Fig. 25 und 27.
stellen die fuͤr die Dampfventile, Fig. 27 und 28. aber
die fuͤr die Exhaustionsventile vor. Der Durchmesser aller Scheiben ist 4
Zoll, die Hoͤhe der Nasen darauf 2 Zoll. Sie luͤften die Ventile
bei dem angegebenen Stande des Hypomochlions der Hebel um 1/2 Zoll. Eine solche
Luͤftung reicht vollkommen hin, um den Daͤmpfen gehoͤrig
Durchgang zu verschaffen, d.h. wenn die Ventile ganz auf die angegebene Art
construirt sind. Die Eintheilung der Nasenscheiben wird auf folgende Weise
gemacht:
Man theilt den Umkreis der beiden Scheiben fuͤr die Dampfventile in sechs
gleiche Theile, und stellt die Nasen in zwei einander gegenuͤberstehende
Theile nach der in der Zeichnung angegebenen Form. Fuͤr die
Exhaustionsventile werden die Scheiben nur in zwei gleiche Abtheilungen
gebracht. Jede der Nasen nimmt eine ganze Abtheilung nach der in der Zeichnung
gegebenen Form ein. Die Scheiben werden so auf die Welle aufgezogen, daß die
punktirten Linien, a, a, a, a, an allen Scheiben in
einer Flucht stehen, d.h. wenn die Welle in der, in den Fig. 25, 26 etc.
durch einen Pfeil bezeichneten Richtung umlaͤuft. Zuerst nach vorne kommt
die Scheibe, 27, fuͤr den Exhaustionsventilhebel der linken Seite, dann
28, fuͤr den rechten Hebel des Namens, darauf folgt, 26, fuͤr den
linken, dann 25, fuͤr den rechten Dampfventilhebel. Beim Aufstellen und
Anlassen der Maschine wird die Welle in eine solche Stellung gebracht, daß
saͤmmtliche punktirte Linien, a, a, a, a,
aufrecht und in der in der Zeichnung vorhandenen Richtung stehen, wenn die
Kurbel im todten Punkte der rechten Seite sich befindet und nach der Richtung
des Pfeiles in Fig. 4. sich umdrehen soll.
Zur Bewegung der Steurungswelle dienen konische Raͤder von gleichem
Durchmesser und gleicher Anzahl von Zaͤhnen. Eins derselben befindet sich
bei m, Fig. 2 und 3. an der
Schwungradwelle, ein anderes, p, an der
Steurungswelle, und eins an jedem Ende der Zwischenwelle, n, die die Verbindung macht zwischen Schwungradwelle und
Steurungswelle. Die Zwischenwelle laͤuft in zwei Lagern, die an's
Maschinengestell angeschroben werden. Alle diese Anordnungen sind so
gewoͤhnlich und aus der Zeichnung fuͤr jeden Maschinenbauer so
deutlich, daß ich eine genauere Beschreibung fuͤr durchaus
unzwekmaͤßig halte. Zu den drei verschiedenen Raͤumen, F, G,
H, die die Steurung enthalten, kann man bequem durch Thuͤren
kommen, die in der Bekleidung des Maschinengestelles (wie ich oben schon
bemerkte) angebracht werden. Fuͤr die Raͤume, F u. G, befinden sich
diese Thuͤren am besten in der Vorderfronte des Gestelles, fuͤr
den Raum, H, aber in der rechten Seitenwand
desselben.
VII. Regulationsapparate fuͤr
den Zufluß der Daͤmpfe zur Maschine.
Zu diesen gehoͤren das regulirende Ventil an dem Dampfrohre und der
Gouverneur mit den zur Bewegung des Ventils noͤthigen Vorrichtungen.
Das regulirende Ventil ist ein konisches Ventil von Stahl ganz den
Steurungsventilen gleich, nur ist seine konische Dichtungsflaͤche in
einen Winkel von 60 Graden auf den Horizont gestellt. Sie verlaͤuft sich
in einen Kegel und faͤllt in einen Ventilsiz mit einem ganz scharfen
Rande. In Fig.
22. ist das regulirende Ventil mit seiner messingenen Buͤchse
von außen und oben, Fig. 23. ein
horizontaler Querdurchschnitt desselben vorgestellt. Man sieht hier bei a, das Ventil mit seinem kegelfoͤrmigen
Kopfe. Es hat einen langen staͤhlernen Stiel, der da, wo er durch seine
Stopfbuͤchse geht, gut polirt seyn muß. Die dasselbe einfassende
Buͤchse, b, hat die in der Abbildung
bezeichnete Form. Sie enthaͤlt bei c, die 5/4
Zoll weite Ventilkammer mit dem scharfen Ventilsize, d. Aus derselben fuͤhren die beiden kurzen Roͤhren, e und f, die mit
Scheiben, g und h,
versehen sind, und an welche die kupfernen Dampfroͤhren angeschroben
werden, i, ist der Dampfcanal der Buͤchse,
welcher den Dampf zum Ventile fuͤhrt. Er muͤndet mit der vom
Entwiklungsapparate kommenden Dampfroͤhre, die an's Ende der
Buͤchse vermittelst zweier Oehrschrauben angeschroben wird. Die
Stopfbuͤchse fuͤr den Ventilstiel besteht fuͤr sich und
wird in die Ventilkammer bei k, eingeschroben. Sie
hat ganz die Einrichtung der Stopfbuͤchse fuͤr die
Steurungsventilstiele. Der Stopfpfropfen allein hat eine besondere Einrichtung
und bedarf deßhalb einer Beschreibung.
Der Canal durch die Achse desselben ist naͤmlich nach der
Stopfbuͤchse hin bei l, auf eines Zolles
Laͤnge weiter als nach außen. In feinem verengerten Theile, m, befindet sich ein Gewinde mit drei
Gaͤngen. Dieser Einrichtung entspricht der Ventilstiel. Derselbe (von 3/4
Zoll Durchmesser) paßt genau in den weitern Theil, hat aber in der Verengerung
gleichfalls ein Gewinde mit drei Gaͤngen und arbeitet als
maͤnnliche Schraube in dem muͤtterlichen Gewinde des Canals. Er
ragt nach außen einige Zoll hervor und ist hier mit einem Bewegungshebel
versehen, der mit dem Gouverneur in Verbindung steht. Man sieht nun leicht ein,
daß er bei der Hin- und Herdrehung des Ventilstieles vermittelst des Hebels, wegen des
Gewindes in dem Canale des feststehenden Stopfpfropfens eine vor- und
ruͤkgaͤngige Bewegung machen muß. Hiedurch wird aber
natuͤrlich das Ventil mehr oder weniger in seinen Siz gedruͤkt,
und eroͤffnet den Daͤmpfen einen groͤßern oder kleinern
Durchgang zur Maschine hin. Der Bewegungshebel ist auf dem außerhalb der
Stopfbuͤchse hervorragenden Theile des Ventilstiels so befestigt, daß man
ihm mit Bequemlichkeit jede moͤgliche Stellung geben kann. Dieß ist sehr
noͤthig, um bei dem veraͤnderlichen Stande des Stopfpfropfens, der
nach Beschaffenheit und Menge der Liederung bald weniger oder mehr in die
Stopfbuͤchse eindringt, dem Ventile jedes Mal die gehoͤrige
Stellung gegen seinen Siz zu geben. Auch kann man auf diese Weise der Oeffnung
fuͤr den Durchgang der Daͤmpfe zwischen Ventil und Siz einen
verschiedenen Spielraum geben, je nachdem man eine groͤßere oder
geringere Leistung der Maschine beabsichtigt. Will man diese naͤmlich
unter den Normalaffekt bringen, so loͤset man nur den Bewegungshebel auf
dem Ventilstiele, dreht das Ventil tiefer in seinen Siz und befestigt den Hebel
wieder in seiner vorherigen Stellung darauf. Dem Dampfe wird dann ein kleinerer
Durchgang zur Maschine verstattet und er bei der geringsten Bewegung des
Gouverneurs ganz abgesperrt. Man kann auf diese Weise den Effekt der Maschine so
vermindern, daß ihre Kraft nur eben hinreicht, ihre eigene Friktion mit der
gesezlichen Geschwindigkeit zu uͤberwinden.
Diese bequeme und nuͤzliche Art der Befestigung des Bewegungshebels auf
dem Ventilstiele geschieht so, daß man denselben mit einer schwach konischen
Oeffnung versieht, womit man ihn genau auf das eben so konisch geformte Ende des
Ventilstiels schiebt, und ihn durch eine Mutter stark anzieht. Seine Verbindung
mit dem Ventilstiele gewinnt dadurch so viel Festigkeit, als noͤthig ist,
um den Ventilstiel zu drehen. Will man ihn loͤsen, so schraubt man die
Mutter zuruͤk, wo dann ein geringer Schlag gegen denselben ihn leicht
frei macht. Damit er recht genau auf den Ventilstiel passe, kann man ihn darauf
schmirgeln.
Der Bewegungshebel, Fig. 1, 2., x, hat einen cylindrischen Zapfen mit einem Knopfe.
Ueber denselben greift die vom Gouverneur kommende Bewegungsstange mit einem
Ausschnitte. Sein aͤußerstes Ende bildet einen Handgriff, woran man ihn
bei beabsichtigtem Stillstande der Maschine, nach ausgeloͤster
Bewegungsstange, vorwaͤrts drehet und so das Ventil ganz in seinen Siz
druͤkt, worauf aller Dampf von der Maschine abgeschlossen wird.
Ein solches regulirendes Ventil hat große Vorzuͤge vor den bisherigen
Drosselklappen und Regulirhaͤhnen. Es fordert zu seiner Bewegung, wie ich aus der
Erfahrung weiß, einen sehr geringen Kraftaufwand, den der kleinste Gouverneur zu
besiegen vermag. Außerdem ist es einfach in seiner Construction, dauerhaft und
leicht in Ordnung zu erhalten, und verrichtet seinen Dienst, selbst bei dem
hoͤchsten Druke und einer bedeutenden Hize der Daͤmpfe, mit großer
Genauigkeit.Diese Vortheile hat Herr Perkins wohl zu wuͤrdigen gewußt; denn er
hat es bei seiner neuen Maschine aufgenommen, nachdem ich es ein halbes
Jahr fruͤher an meiner ersten Maschine in London angewandt hatte.
Hoͤchst wahrscheinlich ist ihm dessen Einrichtung von meinem
Werkmeister mitgetheilt worden, der einen besondern Geschmak daran fand
und, wie ich spaͤter erfuhr, stets bei Herrn Perkins
verkehrte. Das regulirende Ventil liegt quer uͤber dem Gestelle, gerade in
der Mitte zwischen beiden Stiefeln. Seine beiden Enden liegen in zwei Oeffnungen
des gußeisernen kleinen Geruͤstes fuͤr den Gouverneur und werden
dadurch unterstuͤzt. Das vordere Ende ragt mit dem Stopfpfropfen, dem
Ventilstiele und seinem Bewegungshebel aus der vorderen Oeffnung des
Geruͤstes hervor. Die von seiner Buͤchse abgehenden
Seitenroͤhren liegen etwas uͤber die Mitte hinaus, mehr nach
vorne, so, daß die daran geschrobenen Dampfroͤhren eine Kruͤmmung
nach vorne machen muͤssen, um darauf zu treffen. Diese Anordnung ist
noͤthig, um beim Anziehen der Dampfroͤhren an die Buͤchse
und die Fortsaͤze der Stiesel zugleich einige Nachgiebigkeit und Federung
in derselben zu bewirken. Laͤgen sie naͤmlich gerade, und die an
beiden Enden derselben liegenden Dichtungen waͤren zu einer Zeit ein Mal
schwaͤcher, als zu einer anderen, so muͤßten sich dann die
Roͤhren ausdehnen und wuͤrden dabei leiden. Jezt geben sie aber in
den Biegungen so viel nach, als fuͤr den angegebenen Fall noͤthig
ist.
Die Form des Geruͤstes des Gouverneurs ist aus Fig. 30 und 31.
deutlich, wo es Fig. 31. von der Seite und Fig. 30. von vorne
vorgestellt ist. Es ist von Gußeisen aus einem Stuͤke gegossen, und wird
mit seinen Fuͤßen auf die untere Gestellplatte festgeschroben. Seine
Schenkel, a und b,
muͤssen so weit gespreizt stehen, und der von demselben gelassene innere
Spielraum uͤberhaupt so groß seyn, daß das Querstuͤk des
Staͤmpels mit den beiden Leitstangen bequem zwischen demselben spielen
kann; seine Form kann sehr verschieden seyn, so auch die Art der Aufstellung des
Gouverneurs auf selbigen.
Dieser Gouverneur ist von gewoͤhnlicher Art. Er bewegt, gleichfalls auf
bekannte Weise, den Hebel, Fig. 3. 3, dessen
Hypomochlion auf der an dem Geruͤste angeschrobenen Stuͤze 4,
ruht, und von dessen entgegengeseztem Ende die Bewegungsstange, 5, fuͤr
das regulirende Ventil herunterhaͤngt. Springen bei zu vermehrter
Geschwindigkeit der Maschine die Kugeln des Gouverneurs ab, so steigt der
demselben zugewandte Schenkel des Hebels, 3, waͤhrend der entgegengesezte
sinkt, die
Bewegungsstange herunterdruͤkt und das regulirende Ventil fester in
seinen Siz schraubt.
Das untere Ende der Spindel des Gouverneurs tragt zwei bis drei Schnurscheiben
von verschiedenem Durchmesser, um verschiedene Geschwindigkeiten an demselben
hervorbringen zu koͤnnen. Ueber eine derselben wird die Schnur geleitet.
Sie laͤuft nach hinten uͤber zwei Rollen, Fig. 2. 6 und 7, welche
an dem Geruͤste angeschroben werden, und steigt dann zu der
Steurungswelle hinab, an welche ebenfalls Schnurscheiben, aber in umgekehrter
Ordnung wie oben, angebracht sind.
VIII. Dampfrohr und
Exhaustionsrohr.
Das Dampfrohr ist von starkem Kupferbleche, 1 Zoll im Lichten weit, und liegt von
den Fortsaͤzen der Stiefel an, bis zu Ende derselben, voͤllig
parallel mit ihnen. Hier kruͤmmt es sich bogenfoͤrmig nach vorne,
um auf die Seitenroͤhren der Buͤchse des regulirenden Ventils zu
treffen. Sonach besteht es also aus zwei Theilen, von denen auf beiden Seiten
einer liegt. Ein dritter Theil desselben ist derjenige, der von dem hinteren
Ende der Buͤchse des regulirenden Ventils zum Entwikler fuͤhrt.
Ihn rathe ich mit schlechten Waͤrmeleitern zu umgeben, waͤhrend
die beiden ersten Theile, um die Ausstrahlung von Hize moͤglichst zu
vermindern, und ihnen ein gefaͤlliges Ansehn zu geben, polirt seyn
koͤnnen. Alle Theile haben an beiden Enden Scheiben, um sie mit den
anstoßenden Vorrichtungen durch Schrauben verbinden zu koͤnnen. In der
Gegend der Dampfcylinder-Stopfbuͤchsen sind erstere beiden
Roͤhren mit einer kugelfoͤrmigen Erweiterung versehen, deren schon
Erwaͤhnung gethan ist.
Das Exhaustionsrohr ist gleichfalls von Kupferblech, aber nur von einer
duͤnneren Sorte desselben. Es liegt unterhalb der gußeisernen
Gestellplatte zwischen den Dekplatten des hoͤlzernen Gestelles, und ist
in der Mitte bogenfoͤrmig nach unten gekruͤmmt, um Nachgiebigkeit
bei seinem Anschrauben zu bewirken. Dieses Anschrauben desselben geschieht an
die, in den Fortsaͤzen der Stiefel unterhalb der gußeisernen Dekplatten
befindlichen Exhaustionscanaͤle. Das Abzugsrohr muß von dem tiefern
bogenfoͤrmigen Theile desselben abgehn, und kann in der Hinteren Fronte
des Gestelles, abwaͤrts unter die Sohle des Maschinenraumes, und so zum
Gebaͤude hinaus geleitet werden. Man muß bei Leitung desselben unter der
Sohle wohl beruͤksichtigen, daß die darin sich verdichtenden
Daͤmpfe Abfluß finden. In dieser Ruͤksicht kann man an dem
tiefsten Theile desselben ein heberfoͤrmiges Rohr anbringen, dessen einer
Schenkel in das Exhaustionsrohr eingelassen, dessen anderer aber etwas unter dem
Niveau des tiefsten Standes dieses Exhaustionsrohres eine Ausgußoͤffnung
hat, und die verdichteten Daͤmpfe in einer Rinne abfuͤhrt. Die
Wassersaͤule in beiden Schenkeln verhindert das Herausdringen der
Daͤmpfe aus der Roͤhre.
IX. Vorrichtungen zur Verwandlung
der geradlinigten Bewegung des Staͤmpels in eine
kreisfoͤrmige.
An dem Staͤmpel, und zwar genau in der Mitte desselben, ist das
Querstuͤk, Fig. 2. c, befestigt, an welches die Leitstange, d und e, zur Bewegung
der Kurbel eingehaͤngt werden. Es ist von Schmiedeeisen und bildet einen
2 1/2 Zoll breiten und 3/4 Zoll starken Ring, der auf den Staͤmpel
geschoben und durch einen Keil an denselben befestigt wird, welcher durch beide
Theile geht. Nach vorne und hinten hat der Ring zwei in einer Linie und
horizontal liegende Schenkel, woran sich die Zapfen befinden, auf welchen die
Enden der Leitstangen arbeiten. Diese 1 1/2 Zoll starken Zapfen haben nach
beiden Seiten eine Schulter, deren aͤußere einen Knopf bildet, der auf
einen vierekigen Theil neben den Zapfen aufgepaßt und durch eine Schraube
befestigt ist, die in den Zapfen eingeschroben wird. In Fig. 41 und 42. sieht
man das Stuͤk besonders vorgestellt, und zwar in Fig. 42. von oben,
und in Fig.
41. von der Seite. a, ist der Ring, durch
dessen Oeffnung der Staͤmpel geht, b, der
Schliz fuͤr den Befestigungskeil des Ringes an den Staͤmpel, c und d, sind die
Schenkel, e und f, die
Zapfen fuͤr die Leitstangen, g und h, die aͤußern knopfartigen Schultern, i und k, die dieselbe
befestigenden Schrauben.
Bei groͤßeren Maschinen, wo der Staͤmpel ein bedeutendes Gewicht
hat, wird es sehr vortheilhaft seyn, an dem Stuͤke außerhalb des Zapfens
fuͤr die Leitstangen, ein Paar Friktionsraͤder anzubringen, die
auf eisernen Schienen des Gestelles laufen und das Stuͤk sammt dem
Staͤmpel tragen. Bei dieser Einrichtung wird es dann noͤthig, die
Schwungradwelle nach der entgegengesezten Richtung umlaufen zu lassen, damit der
schiefe Druk der Leitstangen auf das Stuͤk nach unten gerichtet sey, und
hier von den Friktionsrollen und Schienen aufgenommen werde. Die Schienen
muͤssen auf der Gestellplatte so befestigt werden, daß ihre Stellung
ajustirt werden kann.
Bei kleineren Maschinen, wo der Staͤmpel wenig Gewicht hat, kann diese
Kuͤnstelei fuͤglich wegbleiben, vorzuͤglich wenn man die
Schwungradwelle in der, in den Abbildungen bezeichneten, Richtung umtreiben
laͤßt. Sowohl Druk als Zug des Staͤmpels draͤngen ihn dann
immer in schiefer Richtung nach oben, wobei sein Gewicht voͤllig
aufgehoben wird.
Die Leitstangen sind cylindrische geschmiedet eiserne Stangen, an beiden Enden 1
1/2 Zoll, in der Mitte aber 2 Zoll stark. Diejenigen Endtheile, womit sich
selbige auf den Zapfen des Querstuͤkes und der Kurbel bewegen, sind
verschieden gebaut. Erstere Endtheile sieht man in Fig. 32. im Aufrisse,
und in Fig.
33. im senkrechten Laͤngsdurchschnitte. Die messingenen Futter,
a und b, liegen hier
in einem laͤnglichten Schlize. Das Futter, a,
wird durch den Zapfen, c, festgehalten, der in den
Koͤrper des Endtheiles dringt, das andere, d,
aber durch den Keil, d, der in einem
perpendikulaͤren Falze desselben liegt. Dieser Keil treibt die Futter
zugleich an einander, damit sie immer fleißig gehen.
Das andere Stangenende endigt sich in ein Querstuͤk, an welches zwei große
metallene Baken angeschroben werden, die die Zapfen der Kurbel umfassen. Die zum
Anschrauben dienenden Bolzen gehen durch alle drei Theile zugleich und halten
alle theils unter einander, theils die Baken um den Zapfen zusammen. In Fig. 36.
sieht man die einzelnen Theile dieses Stangenendes im Aufrisse, in Fig. 38.
im Durchschnitte, in Fig. 37. die
aͤußeren Baken vom oberen Ende.
Die Kurbel ist von geschmiedetem Eisen, stark gebaut und doppelt
gekroͤpft. Sie ist in Fig. 2 und 3.
besonders gut zu sehen, und hat zwei Wellzapfen, womit sie in den
Lagerboͤken des Gestelles laͤuft. Sie bildet mit der
Schwungradwelle, deren aͤußerster Zapfen in einem besondern, von der
Maschine getrenntem Lager arbeitet, Ein Stuͤk. Wo das Schwungrad auf
derselben befestigt ist, hat sie einen staͤrkern Theil. Das Achsenloch
des Schwungrades wird ausgebohrt und genau auf den abgedrehten staͤrkern
Theil der Schwungradwelle aufgepaßt. Ein Keil reicht dann hin, um es fluchtrecht
zu befestigen. Da wo das Getriebe, m, sizt, ist die
Schwungradwelle gleichfalls etwas weniges staͤrker. Das Getriebe wird
eben so, wie das Schwungrad, darauf befestigt. Dieß gilt auch von der Scheibe,
woran die Drukstange der Drukpumpe haͤngt. Ihr excentrischer Zapfen steht
1 5/4 Zoll aus dem Mittel der Welle.
X. Speisepumpe.
Sie ist eine gewoͤhnliche Drukpumpe und hat ganz genau diejenige
Construction, die ich im polyt. Journ. Bd.
XXVIII. S. 425. als die beste fuͤr solche Pumpen empfohlen
habe. Ihr Hub betraͤgt 3 1/2 Zoll, und der Durchmesser ihres
Staͤmpels, 9/8 Zoll. Lezterer erhaͤlt seine Leitung in der
Stopfbuͤchse. Die Pumpe hat die im polytechnischen Journale beschriebene
Vorrichtung zur Luͤftung des Saugventils, die vom Gouverneur aus auf
folgende Weise beschikt wird: Von dem Bewegungshebel des regulirenden Ventils
fuͤhrt eine kleine Stange abwaͤrts bis unter den Fußboden, hier
greift sie mit einem Schlize uͤber das eine Ende eines hoͤlzernen
Balanciers, der mit seinem andern Ende die Hebstange des Saugventils eingelenkt
enthaͤlt. Zwei Stifte zu jeder Seite der Stange schuͤzen diese vor
jeder Seitenbewegung. Auf dem zuerst genannten Ende des Balanciers befindet sich das Gegengewicht
zur Luͤftung des Saugventils, das in Wirksamkeit tritt, wenn der Hebelarm
frei wird. Frei wird er aber, wenn in Folge des Abspringens der Kugeln des
Gouverneurs die, von dem Bewegungshebel des regulirenden Ventils kommende,
Stange herabgedruͤkt wird, und auf diese Weise der untere Rand ihres
Schlizes, der den Arm des Balanciers geluͤftet hielt, diesem zu sinken
erlaubt. Man vergleiche hier die oben angefuͤhrte Beschreibung meiner
Hemmungsmethode fuͤr Drukpumpen.
Bei dieser Einrichtung regulirt der Gouverneur der Maschine nicht allein den
Zufluß der Daͤmpfe zu derselben, sondern auch die Einsprizung von Wasser
in den Entwikler. Ersterer Umstand bewirkt einen regelmaͤßigen Gang der
Maschine, selbst bei einem veraͤnderlichen Widerstande, waͤhrend
lezterer eine Ueberladung des Entwiklers mit Daͤmpfen zwekmaͤßig
verhuͤtet. Bei jeder, selbst der geringsten Ueberschreitung der
gesezlichen Geschwindigkeit von Seiten der Maschine, hoͤrt die
Einsprizung in den Entwikler sogleich und genau so lange auf, bis diese wieder
eingetreten ist. Hemmt man die Arbeit der Maschine durch Zuschließung des
regulirenden Ventils, so wird zugleich auch die Wirkung der Pumpe in dem
Augenblike aufgehoben, als man nach Aushaͤngung der vom Gouverneur
kommenden Stange den Bewegungshebel des Ventils und mit ihm die zur
Hemmungsvorrichtung herabgehende Stange abwaͤrts dreht.
Das Speiserohr der Drukpumpe wird am besten unterhalb des Fußbodens zum
Entwiklungsapparate geleitet. Auf diese Weise ist es am zwekmaͤßigsten
vor Beschaͤdigung gesichert.
XI. Dichtungsmethode, welche bei der
Verbindung der verschiedenen Roͤhren unter einander und mit den
groͤßern Maschinentheilen befolgt ist.
Diese Methode ist eigentlich eine Erfindung des Hrn Perkins, der sie an allen seinen Maschinen befolgt und schon
fruͤher bekannt gemacht hat. Hr. Perkins hat
sich um die Maschinen mit sehr hohem Druke durch diese Erfindung ein großes
Verdienst erworben.
Nach dieser Methode wird zwischen zwei Roͤhrenenden, oder einem
Roͤhrenende und irgend einer Oeffnung, ein Doppelkegel von weichem
geschmiedetem Eisen gesezt, der mit seinen schmaͤler zulaufenden Enden in
die, mit einem scharfen Rande versehenen, Muͤndungen der Roͤhren
oder Canaͤle eindringt, und beim Anziehen der Schrauben seinen
staͤrker Theil gegen den scharfen Rand der Muͤndung
keilfoͤrmig so andraͤngt, daß die Verbindung zwischen ihm und dem
Rande der Muͤndungen fuͤr jeden Druk und fast fuͤr jede
(nicht zu hohe) Temperatur voͤllig dicht wird, der Rand der
Muͤndung mag von einem Metalle seyn, von welchem er will. Daß bei dieser
Verbindung der Kegel durchbohrt seyn muͤsse, um die Communikation
zwischen den verbundenen Theilen zu erhalten, versteht sich von selbst. Eine
solche Dichtungsmethode laͤßt bei hohem Druke nichts zu wuͤnschen
uͤbrig. Man kann die Verbindung der durch sie vereinigten Theile leicht
aufheben, und wieder herstellen, ohne schmierige Kitte und andere
Kuͤnsteleien noͤthig zu haben, die oft geraume Zeit zum Troknen
brauchen. Die Verbindung ist nach dem Anziehen der Schrauben sogleich dicht, und
fuͤr immer sicher und dauerhaft. Sollten nach oͤfterem Anschrauben
und Abnehmen der Roͤhren starke Eindruͤke in den Kegeln sich
zeigen, so braucht man selbige nur von neuem etwas abzudrehen, worauf sie
sogleich ihren Dienst wieder vollkommen verrichten.
In Fig.
39. ist die Verbindung zweier Roͤhren nach dieser Methode im
Durchschnitte dargestellt, a und b, sind die Roͤhren, c und d, die Scheiben, durch welche sie
vermittelst einiger Schrauben an einander gezogen werden, e, ist der Doppelkegel in seiner Stellung zwischen den beiden scharfen
Raͤndern der Roͤhrenmuͤndungen. In Fig. 40. sieht man
den Kegel im Aufrisse besonders vorgestellt.
Herr Perkins schweift die konischen Flaͤchen
des Kegels nicht so aus, wie es Fig. 40. bei, a, a, a, a, zeigt. Ich habe aber gefunden, daß bei
Vernachlaͤssigung dieser Anordnung der Kegel nicht so dicht schließt, und
die Roͤhrenmuͤndungen leichter aufspalten. Ich kann die hier
dargestellte Form desselben als hoͤchst zwekmaͤßig, und durch eine
laͤngere Erfahrung gepruͤft, unbedingt empfehlen.Wo bei großem Dampfdruke Roͤhren von groͤßerem Durchmesser
mit ihren Enden an einander zu dichten sind, nimmt man zum
Dichtungsmittel Bleiplatten, oder noch besser, einen Ring von
duͤnnem, recht weichem Kupferdrathe. Lezterer schließt ganz
vorzuͤglich an, jedoch muͤssen bei seiner Anwendung die
auf einander zu dichtenden Flaͤchen gut geebnet seyn. Mit solchem
Kupferdrathe habe ich sehr ausgedehnte Flaͤchen und
Raͤnder auf einander gedichtet, z.B. die beiden Haͤlften
der Sammlungsbehaͤlter meines Generators, an denen die ganze
Laͤnge des zu dichtenden Randes ein Mal uͤber 15 Fuß
betrug. Der Drath hielt so dicht, daß ein Dampfdruk von 800 bis 1000
Pfund auf den Quadratzoll keine nachtheilige Wirkung darauf
hervorbrachte. Der einzige Nachtheil dieser Dichtungsmethode ist, daß
der Drath durch oͤfteres Anschrauben nach und nach platt
gedruͤkt wird und dann nicht mehr dicht schließt. Man muß ihn
dann mit einem neuen vertauschen, welche Maßregel einen nur sehr
unbedeutenden Kostenaufwand verursacht, da ein Drath von der Dike eines
Achtel-Zolles hinreicht, einen genuͤgenden Schluß zu
bewirken.
In Fig.
39. habe ich auch noch zu versinnlichen gesucht, wie ich kupferne,
zusammenzufuͤgende Roͤhrenenden mit den fuͤr die Aufnahme
der Schrauben noͤthigen Scheiben versehe. Ich nehme naͤmlich
gußeiserne Scheiben, bohre durch die Mitte derselben einen cylindrischen Canal,
dessen Durchmesser dem der Roͤhrenmuͤndung (mit Zugabe der halben
Roͤhrendeke auf beiden Seilen der Muͤndung) gleich ist; schneide
in diesen Canal ein nicht zu grobes Gewinde, und schraube solches mit Gewalt auf das
Roͤhrenende so weit hinauf, daß die Muͤndung der Roͤhre
uͤber der Flaͤche der Scheibe etwas hervorragt. Dann feile ich das
uͤber der Flaͤche der Scheibe hervorragende Ende der Roͤhre
ab und treibe einen staͤhlernen Kegel in die Muͤndung, wodurch
diese die gehoͤrige Rundung bekommt.
(Beschluß im naͤchsten
Hefte.)
Tafeln