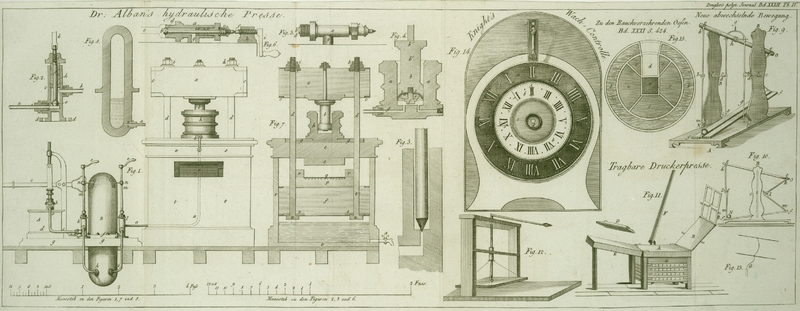| Titel: | Versuch einer Verbesserung der hydraulischen Pressen, Von Dr. Ernst Alban. |
| Autor: | Dr. Ernst Alban [GND] |
| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. XI., S. 74 |
| Download: | XML |
XI.
Versuch einer Verbesserung der hydraulischen
Pressen, Von Dr. Ernst Alban.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Alban, Versuch einer Verbesserung der hydraulischen
Pressen.
Von jeher hat man den hydraulischen oder hydromechanischen Pressen den Vorwurf
gemacht, daß der zu ihrer Betreibung noͤthige Kraftaufwand zu
veraͤnderlich sey, indem dieser mit der Steigerung der Pressung in dem
Verhaͤltnisse wachsen muß, als der hydraulische Druk steigt, bei Aufhebung
dieses Drukes aber fast auf bloße Ueberwindung der Reibung in der Drukpumpe
beschraͤnkt wird. Allerdings ist dieser Vorwurf aber auch gerecht, und
gewinnt da vorzuͤgliches Gewicht, wo man ein stetig wirkendes Agens, zur
Betreibung der Presse, gebrauchen will. In solchem Falle hat man zwar allerlei
MittelSolcher Mittel siehe zwei im Polytechn. Journale, Bd. XII. S. 76. und Bd. XX. S. 218. aufgesucht und erfunden, Kraft und Last in eine uͤbereinstimmende
Wirkung zu bringen, fast alle diese Mittel sind aber entweder mehr oder weniger
unzuverlaͤssig, oder auch zu complicirt und umstaͤndlich, und
verursachen nicht selten sehr bedeutende Kosten.
Es sey mir erlaubt, einen sehr einfachen Weg anzugeben, auf dem man hier ohne große
Anlagen und bedeutenden Kostenaufwand zum gewuͤnschten Ziele gelangen
kann.
Auf der Tafel IV. habe ich einen Apparat vorgestellt, der vorzuͤglich zum
Pressen des Oehles aus oͤhlliefernden Saamen bestimmt ist. In Fig. 1. sieht man meine
neue Vorrichtung neben der Drukpumpe, A, aufgestellt,
von derselben fuͤhrt die Roͤhre, a, zur
eigentlichen Presse, deren Form ich zum Pressen der Oehlsaamen vorzuͤglich
zwekmaͤßig gefunden habe.
Daß ich gerade hier meinen Apparat auf eine Oehlpresse anwende, hat weiter keinen
Zwek, als Gelegenheit zu finden, uͤber die Form dieser meiner neuen
Oehlpresse dasjenige mittheilen zu koͤnnen, was meinem Vaterlande vielleicht
nuͤzlich werden koͤnnte. Daß mein Apparat fuͤr jede
hydraulische Presse anwendbar sey, sie moͤge einen Zwek haben, welchen sie
wolle, halte ich fuͤr uͤberfluͤssig zu bemerken.
Das neue Princip, welches ich anwende, den oben angegebenen Zwek zu erfuͤllen,
besteht darin, daß ich das, von der Drukpumpe der Presse in den Drukstiefel zu
foͤrdernde, Medium zuerst in einen Windkessel von sehr starker Bauart
fuͤhre, und von diesem dann zu dem Drukstiefel leite, die Verbindung zwischen
beiden aber willkuͤhrlich aufzuheben und herzustellen Einrichtungen getroffen
habe, die es moͤglich machen, die Drukpumpe ungehindert und fast in stetiger
Kraft fortarbeiten zu lassen, waͤhrend die Wirkung der eigentlichen Presse
bald gesteigert, bald aufgehoben wird. Da wo mehrere Pressen in Thaͤtigkeit
sind, kann mein Apparat mit wenigen Kosten in der Ausdehnung hergestellt werden, daß
alle aus seinem Windkessel ihre Beduͤrfnisse zu ziehen vermoͤgen.
Das in Tab. IV. Fig.
1, A, abgebildete Drukwerk ist ein ganz
gewoͤhnliches. Seine Einrichtung werde ich nicht weiter beschreiben, da
diejenigen, die sie nicht kennen sollten, sich aus Christian's
mecan. industrielle daruͤber belehren
koͤnnen. Ein solches Drukwerk kann ein einfaches (d.h. aus einer Drukpumpe
bestehendes, oder ein doppeltes (mit zwei Drukpumpen versehenes) seyn. Lezteres hat
bei groͤßern Pressen, oder da, wo mehrere einzelne Pressen in
Thaͤtigkeit gesezt werden sollen, entschiedene Vorzuͤge, zugleich ist
seine Wirkung auch stetiger, als die eines einfachen.
b, ist die Drukpumpe des Drukwerkes, c, der Drukhebel, d, die
Cisterne fuͤr das anzuwendende Medium, (Wasser oder Oehl). Sie ist mit einem
Dekel gehoͤrig dicht verschlossen, damit keine Unreinigkeiten in selbige
kommen koͤnnen, die das Medium verderben und der regelmaͤßigen Wirkung
der Drukpumpe Gefahr bringen.
Von der Drukpumpe fuͤhrt die Roͤhre, e, das
von derselben kommende Medium in den Windkessel, B.
Dieser ist ein sehr starkes cylindrisches Gefaͤß von Gußeisen, mit seinen
sphaͤrischen Endstuͤken aus einem Stuͤke gegossenUm denselben in dieser Form gießen, und namentlich, um den Kern befestigen zu
koͤnnen, kann man an beiden Enden desselben Oeffnungen lassen, die
nachher zugeschroben werden.. Bei, f, hat derselbe einen Kranz, womit er an
die Unterlage, g, festgeschroben ist. Er muß wenigstens
den vier- bis fuͤnffachen kubischen Inhalt des oder der Preßcylinder
(zusammengenommen) haben, und darf wo moͤglich, vorzuͤglich bei
groͤßern Pressen von keinem groͤßern innern Durchmesser, als der
Preßcylinder seyn, damit er dem Druke gehoͤrig widerstehe. Nahe am Boden
desselben bei, h, muͤndet das von der Drukpumpe
kommende Rohr ein, und auf der entgegengesezten Seite fuͤhrt das Rohr, i, aus demselben zum Preßcylinder. Zu- und
Abflußrohr koͤnnen beide durch Ventile abgeschlossen werden. Diese stehen
bei, k, und l, mit ihren
Buͤchsen aufgestellt. Die Einrichtung beider Ventile und ihrer Buͤchsen ist sich so
ziemlich gleich. Um sie deutlicher zu machen, habe ich eins derselben, und zwar das,
zwischen Drukpumpe und Windkessel befindliche in Fig. 2. im
perpendikulaͤren Durchschnitte vorgestellt. a,
ist das, von der Drukpumpe kommende, b, das zum
Windkessel fuͤhrende Rohr. Zwischen beiden steht der Cylinder, c, der das Ventil mit seiner Stopfungsbuͤchse
enthaͤlt. Er ist unten auf der Unterlage durch Schrauben, die durch seinen
Kranz, d, gehen, befestigt. Bei, e, im Cylinder befindet sich die Scheidewand, die die Roͤhren, a, und b, von einander
trennt. In selbiger ist eine Oeffnung angebracht, die das Ventil, f, (ein gewoͤhnliches Kegelventil)
enthaͤlt. Dieses hat einen diken Stiel, g, der in
dem obern Canale jedoch so viel Raum lassen muß, daß das Medium zwischen Stiel und
Canal zum Rohre, b, gelangen kann. Der Ventilstiel geht
bei, h, durch eine Stopfungsbuͤchse, damit das
Medium nicht bei demselben nach außen entwischen koͤnne. Der Schlußpfropfen,
i, der Stopfbuͤchse hat ein
muͤtterliches Gewinde mit drei Gaͤngen, in welchem der obere Theil des
Ventilstiels mit einem maͤnnlichen Gewinde sich bewegt. Auf das oberste, nach
außen hervorragende, Ende des Stiels ist ein Schluͤssel Fig. 1, m, gestekt, der bei Fig. 1, n, sich in einer, an dem Windkessel befestigten, Nuth
dreht, und am obersten Ende mit einem Handgriffe, o,
versehen ist. Durch selbigen kann man den Ventilstiel drehen. Bei dem Drehen
desselben wird das Ventil durch das Gewinde am Stiel gehoben, oder in seinen Siz
gedruͤkt.
Das Ventil fuͤr das Abflußrohr ist von gleicher Construktion; sein unterer
Kegel muß jedoch nur eine sehr kleine Oeffnung deken. Eine Oeffnung von einer Linie
Durchmesser wird schon hinreichen, bei groͤßern Pressen genug vom Medium in
den Preßcylinder zu lassen. Denn da es fuͤr die meisten Faͤlle
erforderlich ist, daß der Preßkolben nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit
steige, um ein allmaͤhliches Zusammendruͤken der zu pressenden
Gegenstaͤnde zu bewirken, so darf der Zufluß nur hoͤchst
gemaͤßigt seyn. Das Ventil wird hier zugleich Regulator des Zuflusses in den
Preßcylinder, indem es vermittelst des Schluͤssels beliebig mehr oder weniger
geoͤffnet werden kann. Ventilsiz sowohl als Kegel des Ventils rathe ich in
der, Fig. 3.
bezeichneten, Form, und zwar von Stahl, zu verfertigen. Die Figur stellt beide in
natuͤrlicher Groͤße vor.
Das Ventil zwischen Drukwerk und Windkessel kann in den meisten Faͤllen auch
entbehrt werden. Es hat dann nur seinen Nuzen, wenn das Drukwerk einer Reparatur
bedarf, und man den Druk des Mediums im Windkessel nicht zu vermindern
wuͤnschtIch habe bei hydraulischen Pressen immer Ventile den Haͤhnen
vorgezogen und ich glaube wohl, daß ich darin der Meinung jedes erfahrnen
Mechanikers entspreche. Haͤhne werden naͤmlich durch den
großen Druk des Mediums zu sehr gegen die entgegengesezte Wand ihrer
Huͤlse gedraͤngt und dieserhalb bald verdorben. Man vergleiche
hiemit, was ich im XXIX. Bd. S. 325
in der Note gesagt habe..
Um den Windkessel mit dem gehoͤrigen Quantum stark comprimirter Luft zu
versorgen, koͤnnte derselbe durch eine Compressionspumpe geladen werden. Die
comprimirte Luft wird sich sehr lange darin erhalten, ohne durch neuen Zuschub
ersezt werden zu duͤrfen. Wo man die Anschaffung einer besondern
Compressionspumpe scheut, koͤnnte man den Windkessel allenfalls auch durch
das gewoͤhnliche Drukwerk mit derselben laden. Man koͤnnte bei der
Construktion des Drukwerks dann die gehoͤrige Ruͤksicht darauf
nehmen.
An dem Drukwerke muß ein Sicherheitsventil angebracht werden, welches so eingerichtet
ist, daß es das, aus demselben etwa kommende, Medium in die Cisterne des Drukwerkes
wieder zuruͤkfuͤhre. Einrichtungen der Art befinden sich an jedem
gewoͤhnlichen Drukwerke (s. Christian's
mecan. industr.). Statt des Sicherheitsventils kann man
auch meine in diesem Journale (Bd. XXVIII. S. 425) beschriebene und abgebildete
Hemmungsvorrichtung anbringen. Sie verhuͤtet auf eine weniger Kraft
verschwendende Art die Ueberladung des Kessels.
Die eigentliche hydraulische Oehlpresse Fig. C, hat, wie
auf der bezeichneten Tafel zu sehen ist, eine ganz neue Form. Ihr Drukcylinder sieht
uͤber der Preßlade und ist gebohrt. Es bewegt sich ein Kolben darin, dessen
unterer Theil genau in den Cylinder paßt. Seine Liederung besteht aus einer
doppelten Lederkappe, zu deren Aufnahme die untere Flaͤche des Kolben etwas
hohl ausgedreht ist. Die Kappe wird in diese Hoͤhlung durch eine Scheibe
eingedruͤkt, die durch eine starke Schraube an den Kolben angezogen wird.
Um diese Einrichtung meines Preßkolbens mehr zu versinnlichen, habe ich in Fig. 4. einen
perpendikulaͤren Durchschnit des Preßcylinders mit demselben vorgestellt, a, bezeichnet den Preßcylinder von Gußeisen mit sehr
starken Waͤnden. Er ist unten zugegossen, so daß sein Boden mit ihm aus einem
Stuͤke besieht. b, ist der Kolben. Er paßt mit
seinem untern Theile genau in den Cylinder, und bewegt sich beinahe schon dicht
darin auf und nieder. Sein oberer Theil b' ist etwas
schwaͤcher, und hat ganz oben bei b'' einen
starken Ansaz, womit er sich gegen den Querbalken Fig. 1, a, der Presse stuͤzt. Der oberste
schwaͤchere Theil desselben geht durch den Querbalken und dient zu
Befestigung des Kolbens daran. Zu diesem Zweke wird, wenn er durch den Querbalken
gestekt ist, oben eine Mutter vorgeschroben.
Die Form der Aushoͤhlung der untern Kolbenflaͤche ersieht man bei, c: d, sind die beiden ledernen Kappen. (Ich nehme zwei
Kappen uͤber einander, der groͤßern Dauerhaftigkeit wegen). Der
umgestuͤlpte Rand der innern Kappe ist etwas schmaͤler, als der der
aͤußern; e, ist die, die Kappen an den Kolben
andruͤkende, Scheibe, f, die sie anziehende
Schraube. Sie dient beim Sinken des Kolbens demselben zugleich als Stuͤzpunkt
auf dem Boden des Cylinders, um zu verhuͤten, daß die Kappen auf denselben
stoßen, und verbogen und beschaͤdigt werden. Dieserhalb ragt sie auch nach
unten mehr, als diese hervor.
In den Boden des Cylinders muͤndet sich das vom Windkessel kommende Rohr,
welches ihm das Medium unter starkem Druke zufuͤhrt, wenn die Pressung
beginnen soll. Es ist auf die gewoͤhnliche Weise in denselben eingesezt. In
der bezeichneten Figur sieht man dasselbe bei, g.
Zum Ablassen des Mediums aus dem Cylinder dient ein Ablaßventil, das in Fig. 1. bei,
b, von vorne gesehen wird, und in Fig. 5 und 6. besonders, und zwar der
bessern Deutlichkeit wegen in ersterer Figur im Aufrisse, in lezterer im
Durchschnitte vorgestellt ist.
Es besteht aus dem Rohre, a, das in den Preßcylinder
eingeschroben wird. Von seiner innern Muͤndung, b, fuͤhrt ein enger Canal in den innern Raum des Preßcylinders.
Selbiger ist in Fig.
6. bei, c, punktirt angegeben. Die innere
Muͤndung desselben wird durch ein Ventil, d,
geschlossen, dessen Stange durch den Canal des Rohres fuͤhrt, am Ende
desselben durch eine Stopfbuͤchse geht, und dann nach außen hervortritt.
Außerhalb ist eine Huͤlse, e, auf selbigen
geschroben, in welcher eine Spiralfeder enthalten ist. Diese Spiralfeder wird durch
das Aufschrauben der Huͤlfe auf die Stange zusammengedruͤkt, stemmt
sich folglich gegen diese, druͤkt dadurch die Stange nach außen, und
haͤlt so das Ventil geschlossen. Soll es geoͤffnet werden, so
druͤkt die Schraube, f, gegen das Ende der
Stange, und schiebt diese nach einwaͤrts, worauf das Ventil seinen Siz
verlassen muß, und dem Medium den Austritt aus dem Cylinder verstattet. Dieses
fließt dann durch das Seitenrohr, g, ab, und kann durch
eine an selbiges geschrobene Roͤhre in die Cisterne des Drukwerks geleitet
werden.
Die das Ventil oͤffnende Schraube dreht sich in einer Stuͤze, h, die auf der großen Platte der Presse angeschroben
ist. Sie ist an ihrem Ende zur leichtern Handhabung mit einer Kurbel, i, versehen.
Diese ganze Vorrichtung zum Ablassen des Mediums aus dem Preßcylinder muß in der
vordern Fronte der Presse angebracht seyn, damit der Arbeiter, der auf dieser Seite
die zu pressenden Oehlkuchen in die Presse hineinschiebt, und aus derselben wieder
herauszieht, die Kurbel gleich bei der Hand habe, um den Preßcylinder, nach den
jedesmaligen Forderungen seines Geschaͤfts, zu fuͤllen oder zu
entleeren.
Was diejenigen Vorrichtungen meiner Presse betrifft, die den Druk des Preßkolbens auf
die Oehlkuchen uͤbertragen, so bestehen sie zuvoͤrderst: aus dem
Querbalken, Fig.
1 und 7. a, der gegen den der Preßkolben, b, von unten druͤkt. Er kann von starkem
Eichen- oder Buchenholz verfertigt werden, und muß an beiden Enden mit
eisernen Ringen, c, c, beschlagen seyn. Da wo der Kolben
gegen ihn druͤkt, ist er mit einer starken eisernen Platte belegt.
Von dem Querbalken haͤngen zwei starke eiserne Stangen, d, d, herunter, die die große Platte, e, des
Gestelles durchbohren, um in den innern Raum des untern Preß- und
Oehlbehaͤlters hinabzusteigen. Innerhalb dieses Raumes gehen sie durch einen
zweiten Querbalken, der in Fig. 7., die das Gestell
der Presse im perpendikulaͤren Laͤngsdurchschnitte vorstellt, durch,
f, bezeichnet ist.
Da wo die Stangen durch die große Gestellplatte, e,
dringen, ist in diese eine eiserne Platte, g,
eingelassen, die zugleich dem Preßcylinder, h, als
Unterlage dient, und deren Oeffnungen den Stangen zur sichern Fuͤhrung
dienen, um das Schwanken des obern Querbalkens und des Kolbens zu verhuͤten.
Zur Befestigung der Stangen an den obern Querbalken dienen die Muttern, i und k, die auf das obere
Ende derselben geschroben sind, und den Stuͤzpunkt fuͤr die Stangen
abgeben. Da wo sie auf dem Querbalken aufliegen, ist derselbe mit starken eisernen
Schienen, l und m,
versichert. Das untere Ende der Stangen hat große Koͤpfe, n, n, die sich gegen den untern Querbalken
stuͤzen. Sie sind mit den Stangen aus einem Stuͤke geschmiedet, und
druͤken ebenfalls gegen eiserne, im untern Querbalken eingelassene Schienen,
o, o. Bei der Zusammenstellung der Presse stekt man
die Stangen zuerst durch den untern Querbalken, dann durch die Gestellplatte und
zulezt durch den obern Querbalken.
Der untere Querbalken traͤgt die Preßplatte, x. Selbige muß etwas
groͤßer seyn, als der zu pressende Kuchen. Sie ist von Holz und auf ihrer
Oberflaͤche gefurcht. Die Furchen bilden die Rinnen zum Abtroͤpfeln
des Oehls bei der Pressung. Ueber dieselben ist eine Eisenplatte, q, mit Loͤchern gelegt. Nach drei Seiten, die
vordere ausgenommen, ist um die Preßplatte herum ein mehrere Zolle erhabener Rand,
r, r, von Holz gelegt, der die Lage des Kuchens nach
diesen drei Seiten sichert. An der vordern muß er natuͤrlich fehlen, damit
hier dem Auflegen der Kuchen auf die Preßplatte nichts im Wege stehe. An die untere
Flaͤche der Gestellplatte, e, gegen welche die
Preßplatte beim Steigen des Preßkolbens die Oehlsaamenkuchen andruͤkt, ist ein Kloz,
s, angenagelt und mit Eisenblech beschlagen. Der
Kloz paßt, beim Ansteigen der Preßplatte an die Gestellplatte, genau zwischen die
erhabenen Raͤnder der Preßplatte hinein, und beruͤhrt diese Platte
beim weitern Aufsteigen. Diese Einrichtung befoͤrdert das gehoͤrige
Zusammenpressen des Kuchens, das, beim Mangel dieses Klozes, durch die aufstehenden
Raͤnder der Preßplatte sonst verhindert wuͤrde.
Die Presse ruht mit der Gestellplatte, e, ohne weitere
Befestigung auf dem untern Behaͤlter, t. Ihre
Schwere reicht hin, um sie fest mit diesem zu verbinden. Der Behaͤlter ist
ein starker Kasten von Tannen- oder Eichenholz, im untern Theile mit Blech
ausgesezt, um ihn gehoͤrig dicht zu machen, und so jeden Verlust von dem sich
darin sammelnden Oehle aus demselben zu verhuͤten. Er ist am untern Ende mit
einem Abzapfhahne, u, versehen. Da, wo die Kuchen in
denselben gefoͤrdert werden, um sie auf die Preßplatte zu legen, ist die Wand
desselben ausgeschnitten, wie in Fig. 1. bei v, zu sehen ist.
––––––––––
Die Wirkung meiner neuen hydraulischen Preßvorrichtung erklaͤrt sich auf
folgende Weise:
Der Windkessel muß auf irgend eine Art durch eine Compressionspumpe oder, im Falle
der Noth, durch die Drukpumpe selbst mit Luft in dem Maße geladen werden, daß
wenigstens 2/3 seines innern Raumes (wie in Fig. 8, die einen
perpendikulaͤren Durchschnitt des Windkessels darstellt, zu sehen ist) mit
hoͤchst comprimirter Luft, etwa von 2000 Pfund Druk auf den Quadratzoll
gefuͤllt werden. Diese Luft ist nun als das eigentliche Agens fuͤr die
Presse zu betrachten, und wird bei der Wirkung derselben dadurch in ihrem
comprimirten Zustande erhalten, daß fortwaͤhrend durch das Drukwerk von dem
Medium der Presse Wasser, oder besser, Oehl,Man vergl. hier das von mir in diesem Journale, Bd. XXIX S. 85. Gesagte. in den untern Theil des Windkessels gebracht, und so das in den Drukcylinder
abfließende stets ersezt wird. Da die Luft sich immer im obern Theile des
Windkessels haͤlt, das das Medium aus dem Windkessel zum Druk- oder
Preßcylinder fuͤhrende Rohr, a, aber vom untern
Ende desselben abgeht, wo nur vom Medium angehaͤuft ist, so wird die Luft nie
entweichen koͤnnen, es muͤßte denn zu viel des Mediums aus dem
Windkessel abgelassen werden, und die Luft in das Rohr, a, mit uͤbergehen. Ein solcher Umstand kann aber nicht eintreten,
wenn das Drukwerk und das durch dasselbe in den Windkessel zu liefernde Quantum des
Mediums in ein gehoͤriges Verhaͤltniß zu seinem Verbrauche in der
Presse (dem Drukcylinder) gebracht ist.
Ist nun die Presse mit einem Oehlsaamenkuchen gespeiset, und ihre Wirkung soll
beginnen, so bewegt der Arbeiter nur den Handgriff des, zwischen Windkessel und
Drukcylinder befindlichen Ventils, wodurch dieses sich oͤffnet und das Medium
mit dem ihm durch die comprimirte Luft des Windkessels mitgetheilten Druke in den
Drukcylinder treten laͤßt. Die Folge hiervon ist, daß der Kolben desselben
dadurch gehoben wird, und die Pressung des Oehlsaamenkuchens besorgt. Ist die
Pressung vollendet, so schließt der Arbeiter das eben genannte Ventil, ergreift die
Kurbel des am Drukcylinder befindlichen Entleerungsventils, und oͤffnet
selbiges durch Vorwaͤrtsdrehung der Kurbel. Das Medium fließt nun durch die,
von dem Entleerungsventile zur Cisterne des Drukwerks fuͤhrende,
Roͤhre in leztere zuruͤk, der Kolben und mit ihm die Preßplatte
sinken, worauf die Presse neu beschikt werden kann.
Da der kubische Inhalt des Windkessels so berechnet ist, daß er den des
Drukcylinders, und zwar desjenigen Raumes darin, der beim hoͤchsten Stande
des Kolbens unter demselben sich befindet, bei weitem an Groͤße
uͤbertrifft, so wird beim Abstroͤmen einer so geringen
Quantitaͤt des Mediums aus demselben, als der Drukcylinder zu seiner
langsamen und allmaͤhlichen Fuͤllung bedarf, der Druk der comprimirten
Luft, die durch das Abstroͤmen des Mediums nur wenig Raum gewinnt, um ein
sehr geringes vermindert werden, zumal da die Drukpumpe einen großen Theil des
abfließenden Mediums sogleich und waͤhrend seines Abfließens wieder
ersezt.
Auf diese Weise muß das Drukwerk mit einer fast immer stetigen Kraft arbeiten, um den
Abgang des Mediums im Windkessel zu ersezen, und es ist also durch diese Vorrichtung
jener an den hydraulischen Pressen oben geruͤgte Nachtheil bei ihrem Betriebe
fast ganz gehoben, wenigstens ist die Veraͤnderlichkeit im Widerstande des
Drukwerkes bei dessen Bearbeitung so sehr unbedeutend, daß sie fast keine
Erwaͤhnung verdient.
Hat man einen genuͤgend großen Windkessel und ein entsprechendes Drukwerk, so
koͤnnen, wie ich schon oben bemerkt habe, von ersterem auch mehrere Pressen
versorgt werden. Die Wirkung dieser Pressen ist dann mit leichter Muͤhe von
dem sie bedienenden Arbeiter durch Oeffnung und Schließung der dazu dienenden
Ventile abwechselnd zu steigern und aufzuheben, waͤhrend die Kraft, ohne
durch diesen Wechsel modificirt zu werden, an dem Drukwerke stetig fortwirkt.
Noch ein großer Vortheil der Anwendung meines Windkessels ist in dem Umstande
begruͤndet, daß man den Act der Pressung mit jeder beliebigen Geschwindigkeit
begehen kann, je nachdem man die Communikation zwischen Windkessel und Drukcylinder
durch Oeffnung des
Ventils (das zugleich Regulirungsventil ist), schneller oder langsamer bewirkt. Daß
dieser Vortheil bei manchen technischen Arbeiten großes Gewicht gewinnen
koͤnne, duͤrfte wohl Keiner bezweifeln. Was die Form meiner Oehlpresse
betrifft, so hat sie sich durch die Erfahrung als sehr zwekmaͤßig und
vortheilhaft bestaͤtigt. Zu den bei ihrem Gebrauche sich ergebenden
Vortheilen rechne ich vorzuͤglich folgende:
1) Der Preßcylinder befindet sich nicht, wie bei den gewoͤhnlichen
hydraulischen Pressen, unter der eigentlichen Preßvorrichtung oder der Preßlade,
sondern uͤber selbiger, ist daher nicht der Verunreinigung durch
uͤbertriefendes Oehl oder etwa durch die Tuͤcher dringendem
schmierigem Saamen ausgesezt, kann auch nicht so leicht durch den Arbeiter
waͤhrend des Einlegens und der Herausnahme der Kuchen verunreinigt und
beschaͤdigt werden, zumal wenn man uͤber den Cylinder und alle zu ihm
gehoͤrigen, uͤber der großen Gestellplatte befindlichen, Theile der
Presse eine hoͤlzerne Kappe sezt. Auch sind Reparaturen am Cylinder und
Kolben ferner bei einer solchen Form der Presse leichter bewerkstelligt, indem man
nur den obern Querbalken abzunehmen braucht, um leicht zu beiden zu gelangen.
2) Die Presse ist sehr einfach, wenig kostspielig, leicht, und nimmt wenig Raum ein.
Ihr Gestell kann sogar, unbeschadet der noͤthigen Staͤrke der Presse,
wie Fig. 1.
zeigt, von Holz gebaut werden. Ihre Aufstellung bedarf keines besondern Fundamentes
oder der Grundgrabung. Sie ist an jedem Orte aufzustellen, und es sind dazu keine
großen Vorbereitungen noͤthig. Auch kann sie leicht von einem Orte zum andern
transportirt werden.
3) Ihre Behandlung ist sehr einfach, durch das Oeffnen und Schließen zweier Ventile
ist ihre Wirkung schnell oder langsam (nach Belieben) auf den hoͤchsten Grad
zu steigern und auch wieder schnell aufzuheben, ohne daß der Arbeiter seinen
Arbeitsplaz zu verlassen noͤthig hat.
4) Die Presse enthaͤlt zugleich ein Oehlmagazin, in welches das ausgepreßte
Oehl ohne besondere Vorrichtung von selbst ablaͤuft, und keine
Abflußcanaͤle, wie in den gewoͤhnlichen Preßladen, verstopfen kann.
Durch einen Schwimmer kann man den Oehlstand im Magazine leicht erfahren, und dieser
wird den Besizer der Presse bald belehren, ob der Arbeiter fleißig gewesen ist oder
nicht. Das Oehl braucht nur von Zeit zu Zeit abgelassen zu werden, wodurch das
Geschaͤft leicht unter bessere Controlle gebracht werden kann.
5) Die Arbeiter koͤnnen nicht zum gepreßten Oehle kommen. Die Preßplatte steht
naͤmlich dem Rande der, zum Hereinschieben und Herausnehmen der Kuchen
bestimmten, Oeffnung im Behaͤlter zu nahe, als daß jemand in den
Behaͤlter kommen und Oehl herausfuͤllen koͤnnte. Der Abzapfhahn
wird aber mir einem Schlosse versehen, dessen Schluͤssel der Fabrikbesizer
allein in Haͤnden hat.
Diejenige Oehlpresse, die ich nach dieser Form gebaut habe, preßt nur zur Zeit immer
Einen Kuchen. Nach derselben habe ich die, in der Zeichnung gelieferten, Maaße auch
so ziemlich genommen. Der Drukcylinder derselben ist von Messing, das uͤbrige
Gestelle, mit Ausnahme der eisernen Stangen und Schienen, von gutem, altem, trokenem
Eichenholze. Sie steigt bei der Pressung nur um 2 1/2 bis 3 Zoll, woher die ganze
Hoͤhe des Preßcylinders nur 9 Zoll betraͤgt. Ihr Kolben schließt
allezeit sehr dicht. Etwa durch das Leder seiner Kappen durchsikerndes Oehl sammelt
sich uͤber demselben und wird beim Steigen des Kolbens durch eine am obern
Rande des Cylinders angebrachte Oeffnung abgefuͤhrt, die es in diejenige
Roͤhre leitet, welche vom Entleerungsventile zur Cisterne geht. Es wird Senf
mit dieser Presse gepreßt, und sie liefert eine so reiche Ausbeute an Oehl, und die
ausgepreßten Kuchen sind so vollkommen troken und fest, daß der Besizer derselben
stets im hoͤchsten Grade zufrieden damit gewesen ist.
Sehr leicht kann man diese Presse auch zum Pressen mehrerer Kuchen zugleich
einrichten, wenn man die Entfernung zwischen Preßplatte und Drukkloz groͤßer
und den Hub und Durchmesser des Kolbens verhaͤltnißmaͤßig
hoͤher einrichtet. Jeder Mechaniker wird hier die noͤthigen Mittel zur
Erreichung des Ziels von selbst zu finden wissen.
Tafeln