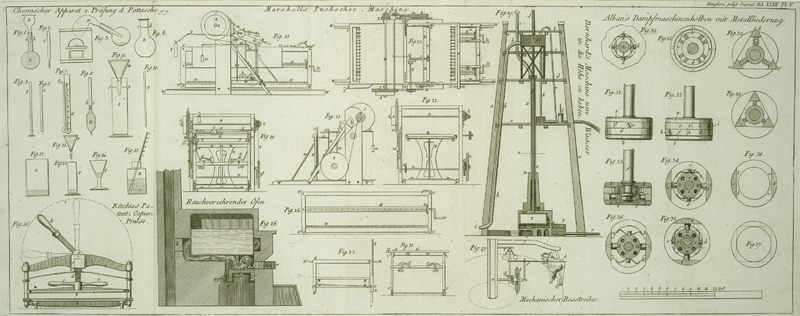| Titel: | Verbesserung an der Maschine zum Scheren und Zurichten der Tücher und anderer aus Wolle verfertigten Stoffe, worauf Wilh. Marshall, Scheren-Fabrikant zu Fountain Grove, Haddersfield, Grafschaft York, sich am 26. April 1828 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. XXXVII., S. 182 |
| Download: | XML |
XXXVII.
Verbesserung an der Maschine zum Scheren und
Zurichten der Tuͤcher und anderer aus Wolle verfertigten Stoffe, worauf Wilh. Marshall,
Scheren-Fabrikant zu Fountain Grove, Haddersfield,
Grafschaft York, sich am 26. April 1828 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Februar
1829. S. 65.
Mit Abbildung auf Tab.
V.
Marshall, Verbesserung an der Maschine zum Scheren und Zurichten
der Tuͤcher etc.
Meine Erfindung, so wie die Anwendung derselben, ist in folgender Beschreibung und
Abbildung, in welcher dieselben Buchstaben dieselben Gegenstaͤnde bezeichnen,
dargestellt.
Fig. 18 ist
ein Seiten-Aufriß; Fig. 20 ein Grundriß;
Fig. 19
ein End-Aufriß meiner Erfindung oder Verbesserung an der
Tuchscher-Maschine, und Fig. 21, 22, 23, 24 und 25 stellen verschiedene
Theile derselben einzeln dar.
Die Eigenschaften und Wirkungen dieser Maschine lassen sich unter drei Bewegungen
bringen: 1) die Bewegung, welche die schneidende Wirkung der Scheren hervorbringt;
2) diejenige, durch welche das Tuch waͤhrend des Scherens durchlaͤuft;
3) diejenige, wodurch eine neue Tuchflaͤche unter die Scheren oder Messer gebracht wird, nachdem
jene, welche man fruͤher unter die Scheren gestellt hat, bereits ausgeschoren
ist. Diese leztere Bewegung wird von dem Arbeiter, oder von der Person, welche die
Maschine zu bedienen hat, hervorgebracht; die beiden ersteren bringt die Maschine
durch sich selbst hervor, die mittelst eines Laufbandes von irgend einer Triebkraft
her in Bewegung gesezt wird. Das Laufband laͤuft uͤber die
Lauf-Rolle, A, in Fig. 18, welche auf der
Spindel, B, gehoͤrig befestigt ist. Durch diese
Spindel oder Achse wird die erste Bewegung, naͤmlich die der Scheren oder
Messer, hervorgerufen, so wie die zweite oder der allmaͤhliche Durchzug des
Tuches unter der Schere.
Die erstere dieser Bewegungen wollen wir zuerst beschreiben. In Verbindung mit der
Rolle, A, und auf derselben Spindel, B, befestigt, steht die Rolle, C, welche mittelst des Laufriemens, D, die
kleine Rolle, E, treibt. Diese leztere Rolle steht mit
der Spindel, F, in Verbindung, welche an ihrem
entgegengesezten Ende ein Rad, G, fuͤhrt (wie man
in Fig. 19
und 20
sieht). Auf der Vorderseite dieses Rades, G, befindet
sich ein excentrischer Stift, H, Fig. 19 und 20, und an
diesem Stifte, H, ist eine kleine Stange, eine
Verbindungs-Stange, I, angebracht. K, ist ein Cylinder aus Holz, oder aus irgend einem
andern Materiale, der sich frei um seine Achse, K, K,
dreht. In der unteren Seite dieses Cylinders, K, ist das
Messer oder das bewegliche Scherenblatt, O, O, in
spiralfoͤrmiger Lage gehoͤrig befestigt, wie die Zeichnungen in Fig. 19 und
23
ausweisen.
Auf der obern Seite des Cylinders, K, ist ein kleines
hervorstehendes Stuͤk, L, mittelst Schrauben oder
auf irgend eine andere Weise wohlbefestigt, so wie mit dieser die bereits
beschriebene Stange, I, mittelst eines Riemens oder
Stuͤkes Leders verbunden ist, das sich an einen aͤhnlichen Riemen an
dem gegenuͤberstehenden Ende der Stange, I, so
anschließt, daß die Mittelpunkte des excentrischen Stiftes, H, und das Stuͤk, L, waͤhrend
jedes Theiles der Umdrehung des Rades, G, in gleicher
Entfernung gehalten werden. Es ist nun offenbar, daß der excentrische Stift, H, waͤhrend er sich um den Mittelpunkt des Rades,
H, dreht, abwechselnd bald vor dem Mittelpunkte des
Cylinders, K, voraus, bald hinter demselben
zuruͤktreten muß. Da nun der Mittelpunkt, L, mit
welchem, H, mittelst der Stange, I, verbunden ist, excentrisch gegen den Mittelpunkt, K, ist, mit welchem er in Verbindung steht, so muß die
Umdrehung des Rades, G, eine Schwingung erzeugen, oder
eine Bewegung des Cylinders, K, nach vor- oder
ruͤkwaͤrts. M, ist der Lieger oder das
stillstehende Messer, das an dem Schlitten, N, N, N, N,
wohlbefestigt ist. Nach diesem Lieger: ist das Spindel-Messer, O, O, gestellt, welches in dem Cylinder, K, befestigt ist, und in eine zum Schneiden gehoͤrige Lage
gebracht: dieß geschieht mittelst einer Schrauben-Vorrichtung, P, P, die die Achse des Cylinders, K, stellt, in welcher das Messer, O, O befestigt ist, wodurch die Federn, Q, Q,
zuruͤk gedruͤkt werden, welche die Mittelpunkte von, K, stuͤzen. (Siehe Fig. 19 und 23.) Wenn die
Scheren-Blaͤtter so gestellt sind, so bewirkt dann die schwingende
Bewegung des Cylinders, K, von welcher wir oben
sprachen, daß die Blaͤtter, O, O, und M, M, schneiden.
Man muß hier bemerken, daß die ganze schneidende Maschinerie von dem Schlitten oder
Wagen, N, N, N, N, getragen wird, der sich auf seinen
Mittelpunkten, R, R', dreht. Es geschieht mittelst des
Mittelpunktes R', (der, je nachdem man den Theil, S, naͤmlich hebt oder senkt, wandelbar ist, wie
man in Fig.
21 sieht,) daß der Schlitten, N, N, N, N,
parallel mit dem Tuche gehalten wird, welches geschoren werden soll. T, ist ein Hebel, welcher ein Gewicht, t, fuͤhrt, wodurch der Schlitten, N, N, N, N, so oft es noͤthig ist, von dem Tuche
gehoben wird, wie wir unten zeigen werden.
Der Schlitten oder Wagen, u, u, u, u, welcher die zweite
Bewegung erzeugt, laͤuft auf Raͤdchen, die in zwei geraden Kanten oder
Bahnen von irgend einer gehoͤrigen Laͤnge laufen, hier aber bei, W, W, W, W, abgebrochen dargestellt sind. Mittelst
dieses Schlittens oder vielmehr dieses Wagens wird das Tuch regelmaͤßig unter
die Scheren gebracht, und der Wirkung der Scheren auf die bereits bemerkte Weise
unterzogen. An dem entgegengesezten Ende der Spindel, B,
ist eine Reihe von Rollen befestigt, X, in deren eine,
je nachdem eine verschiedene Geschwindigkeit erfordert wird, der Laufriemen, Y, (siehe Fig. 19 und 30) geworfen
wird. Der Laufriemen, Y, treibt die Rolle, Z, an deren Mittelpunkte der Triebstok, g, angebracht ist, der in das Rad 10 eingreift, und
durch die Spindel 11 den Zahn-Triebstok 12 in Bewegung sezt. (Siehe Fig. 18 und
19.)
Dadurch laͤuft nun der Zahnstok 13 zugleich mit dem Schlitten, u, u, u, u. Das Ende der Spindel 11, an welcher der
Zahn-Triebstok sich befindet, wird von einem Hebel, 14, gestuͤzt, der,
indem er sich um seinen Stuͤzpunkt 15 schwingt (siehe Fig. 18), von dem
Zahnstoke 13 frei wird, sobald das Tuch seine gehoͤrige Streke unter den
Scheren hingelaufen ist und der Wagen, u, u, u, u, das
Ende seines Laufes erreicht hat.
Die dritte Bewegung, oder diejenige, wodurch eine frische Flaͤche Tuches unter
die Scheren kommt, und die, wie gesagt wurde, durch den Arbeiter selbst
hervorgebracht wird, geschieht dadurch, daß die cylindrischen Walzen, 16a, 16, von den Hunden oder Sperrkegeln, 17, 17 frei
gemacht werden, und das Tuch uͤber den Rahmen, u, u,
u, u, so lang
gewunden wird, bis eine frische Tuchflaͤche unter die Scheren gelangt, wo
dann die Sperrkegel, 17, 17, wieder eingelegt werden, und das Tuch waͤhrend
des Scherens auf dem Wagen, u, u, u, u, festgehalten
wird. Unter dem auf diese Weise auf dem Wagen, u, u, u,
u, ausgespannten Tuche und unmittelbar unter der Kante des Scherenblattes
oder Messers, M, M, befindet sich der Cylinder oder die
Walze 18 (siehe Fig. 22), die von dem Schlitten, 19, und von dem Bande, 20, festgehalten
wird. Die Oberflaͤche dieses Cylinders oder dieser Walze ist mit einem
Wollentuche oder mit einem aͤhnlichen Stoffe bedekt, und etwas uͤber
dem Niveau der oberen Kante des Wagens, u, u, u, u,
erhoben, wodurch das Tuch unter dem Messer in Beruͤhrung gebracht, und
waͤhrend der Wirkung des Messers, O, O (siehe
Fig. 18
und 19)
festgestuͤzt wird. Diese geringe Erhoͤhung des Tuches mittelst des
Cylinders oder mittelst der Walze 18 sieht man deutlicher in Fig. 18, wo, so wie in
Fig. 20
das Tuch roth gezeichnet ist „(was nothwendig im Kupferstiche wegbleiben
mußte. A. d. O.)“
In dem Baue dieser Maschine finden sich drei besondere, abgeschiedene Theile: 1) die
Laufbahn, die bei W, abgebrochen ist, (die aber bei
einer Schermaschine dieser Art 14 Fuß lang seyn muß) mit der Trieb-Spindel
oder Trieb-Achse, B, und ihrem Zugehoͤre.
2) der Wagen, u, u, u, u, sammt Zugehoͤr. 3) Der
Schwing-Wagen, N, N, N, N, der den beschriebenen
Scher-Apparat fuͤhrt. Um nun den Bau der Maschine noch deutlicher zu
zeigen, habe ich einzelne Theile derselben besonders dargestellt. Fig. 21 stellt den Aufriß
eines Theiles der Maschine auf der entgegengesezten Seite von Fig. 18 dar, wo man die
Rolle, X, und das Laufband, Y, noch deutlicher sieht, als in Fig. 19. Fig. 22 zeigt eine
End-Ansicht, wie Fig. 19, wo der
Schwing-Wagen, N, N, N, N, und der
Lauf-Wagen, u, u, u, u, abgenommen ist, um den
Bau des Cylinders oder der Walze, 18, und der Stuͤzen derselben zugleich mit
dem Raͤderwerke darzustellen, das den Lauf-Wagen, u, u, u, u, in den Gang bringt. Fig. 24 und 25 zeigt
Seiten- und Ende-Ansichten des Lauf-Wagens, u, u, u, u, wo noch, außer den bereits beschriebenen
Theilen, ein Sperr-Rad mit seinem Sperrkegel, 21, in Verbindung mit der
Walze, 22, dargestellt ist, wodurch das Tuch mittelst der Riemenstreifen, 23, und
dem Querstuͤke 24 (siehe Fig. 20) gespannt und
gestrekt wird. Figur 23 ist ein Grundriß der unteren Seite des Schwing-Wagens,
N, N, N, N, um die Schrauben-Vorrichtung, P, P, zu zeigen, wodurch das Messer, O, O, gestellt, und auch die Spiral-Richtung, in
welcher es in dem Cylinder, K, angebracht ist,
angedeutet wird.
Wenn man mit dieser Maschine arbeitet, so ist das Erste, was geschehen muß, dieses, daß der
Triebstok, 12, außer Umtrieb gesezt wird, was dadurch geschieht, daß man die Feder,
25, zuruͤk druͤkt, wodurch der Hebel 26, Fig. 18 und 20 frei wird,
und in Folge der Wirkung des Gewichtes 28 in die Hoͤhe steigt, welches, da es
mit der Stange, 29, verbunden ist, den Hebel 14 in senkrechte Lage stellt, wodurch,
da der Triebstok, 12, auf dem Hebel, 14, ruht, der Zahnstok, 13, und der Wagen, u, u, u, u, frei werden. Der Wagen laͤuft dann in
der Richtung der schwarzen Pfeile (Fig. 18 und 20), und ein
Stuͤk des Tuches windet sich regelmaͤßig um eine der Walzen, 16a, in dem das Ende an Stiften oder
Spannhaͤkelchen, die zu diesem Ende in der darauf befindlichen Furche
angebracht wurden, eingehaͤkelt ist, waͤhrend das andere Ende des
Tuches uͤber die oberen Seitenleisten des Wagens, u,
u, u, u, gezogen und auf aͤhnliche Weise an dem anderen Cylinder 16
befestigt ist, wie die rothe Farbe in den Zeichnungen 18, 19 und 20 zeigt. Der
Wagen, u, u, u, u, wird nun
zuruͤkgefuͤhrt, so daß das Mantel-Ende des Tuches uͤber
den Cylinder oder uͤber die Walze, 18, kommt, wo dann, nachdem die
Sperrkegel, 17, wieder in das Zahnrad eingelegt wurden, das Tuch mittelst der
Griffe, 30, 30, gespannt, und auch in entgegengesezter Richtung gestrekt wird, indem
man die mit dem Theile 24 verbundenen Haken einhaͤkelt und auch jene an dem
entgegengesezten Ende des Rahmens, u, u, u, u, wie man
in Fig. 20
sieht. Gespannt wird es durch Umdrehung der Walze, 22, die gleichfalls durch
Sperr-Raͤder und Sperrkegel, wie die Figur zeigt, festgehalten
wird.
Man seze nun, daß jezt der Schwing-Wagen, N, N, N,
N, welcher die Messer oder Scherenblaͤtter fuͤhrt, in jene
Lage gekommen ist, die durch die rothe Außenlinie in Fig. 18 angedeutet ist:
denn diese Lage wird er immer annehmen, indem das Gewicht, t, und der Hebel, T, ihn aufwiegen, wenn er
nicht durch den Sperrkegel, 31, wie in Fig. 18 niedergehalten
wird. Der Schwing-Wagen, N, N, N, N wird nun mit
der Hand herabgefuͤhrt, und mittelst des Sperrkegels, 31, in
Beruͤhrung mit dem Tuche gehalten. Der Riemen, D,
theilt aber der Rolle, E, leine Bewegung mit, eben so
wenig als der Triebstok 12 dem Zahnstoke 13, bis nicht auch der Hebel, 26, durch die
Hand niedergedruͤkt und mittelst des Sperrkegels, 25, und des Theiles, 27,
(wie man in Fig.
18 und 20 sieht) festgehalten wird. Dadurch kommt der Triebstok, 12, in Umlauf,
der Riemen, D, wird mittelst der Spann-Rolle, 32,
gespannt, und beide Scherenblaͤtter, O, O, kommen
in Bewegung, und der Wagen, u, u, u, u, kommt in Gang.
Da der Theil, K, sich mittelst der bereits beschriebenen
Bewegungen sehr schnell schwingt, und der Wagen, u, u, u,
u, sich zugleich in der Richtung der rothen Pfeile langsam bewegt (Fig. 18); so kommt das roth
angedeutete Tuch uͤber den Ruhe-Cylinder oder die Ruhe-Walze,
18, auf welcher es der Einwirkung der Messer oder Scherenblaͤtter so lang
ausgesezt bleibt, bis der Wagen, u, u, u, u, so weit
gelangte, daß das Mantel-Ende des Tuches an die Kante des Messers, M, kommt. Sobald dieß geschieht, kommt die Schraube, 33,
die horizontal an dem Ende des Theiles 24 angebracht ist (siehe Fig. 18 und 20) in
Verbindung mit dem Feder-Sperrkegel, 31, und befreit, indem sie denselben
zuruͤk treibt, den Schwing-Wagen, N, N, N,
N, welcher mittelst des uͤberwiegenden Gewichtes, t, und des Hebels, T, von
dem Tuche aufgehoben wird. Zu gleicher Zeit wird auch der Sperrkegel 25, auf welchen
der Theil, 34, wirkt, zuruͤk gedruͤkt, und, indem dadurch der Hebel,
26, frei wird, hebt das uͤberwiegende Gewicht, 28, den Triebstok, 12, aus dem
Zahnstoke, 13, und der Wagen, u, u, u, u, bleibt
augenbliklich in seinem Laufe stehen. Dieser Wagen, u, u, u,
u, wird dann in der Richtung der schwarzen Pfeile zuruͤkgeschoben;
ein frisches Stuͤk von dem Tuche kommt, nach der oben angegebenen Weise, von
dem Cylinder, 16 a, auf den Cylinder, 16, und die Arbeit
wird wieder, wie vorher fortgesezt.
Waͤhrend die Maschine arbeitet, ist es wesentlich nothwendig, daß die Kanten
der Scherenblaͤtter oder Messer, O, O, und M, M, gelegentlich mit Oehl bestrichen werden. Aus
diesem Grunde ist eine Oehlflasche mit einem Pinsel in Fig. 19 in der bequemsten
Lage angebracht.
Ich nehme nicht einzelne Theile der Tuchscher-Maschine, die bereits
fruͤher gebraucht wurden, als mein Patent-Recht in Anspruch, sondern
jene Stellung und Verbindung der Theile, die hier oben beschrieben wurde; auch
gewisse Modificationen meiner Maschine, z.B., wenn man die Schwung-Bewegung
des Theiles, K, in eine umdrehende verwandeln
wuͤrde; wenn man noch eine Verbindungs-Stange an dem excentrischen
Stifte, H, anbraͤchte (wie die punktirten Linien
in Fig. 20
andeuten), wodurch dann noch eine andere Reihe von Scherenblaͤttern, wie, M, M, und O, O, getrieben
und eine doppelte Scher-Maschine zu Stande gebracht werden koͤnnte;
auch jene Abaͤnderung, wodurch das Tuch von einem Ende zum anderen statt nach
der Quere, wie in der hier beschriebenen Maschine geschoren wird, Alle diese
Abaͤnderungen, die ich bereits versucht und gut befunden habe, sind
fuͤr sich selbst zu einleuchtend, als daß sie einer weiteren Entwikelung
beduͤrfen. Ich bemerke ferner, daß die Geschwindigkeit, mit welcher sich die
verschiedenen Theile meiner Maschine bewegen, so wie die Mittel, wodurch die
verschiedenen Bewegungen erzeugt werden, durch andere, als die hier angegebenen
ersezt und verschieden abgeaͤndert werden koͤnnen. Diese
Abaͤnderungen, so wie die verschiedenen Groͤßen-Verhaͤltnisse und der Stoff
der einzelnen Theile der Maschine haͤngen von der Art der Tuͤcher ab,
die auf demselben geschoren werden sollen. Ein geschikter verstaͤndiger
Arbeiter, der eine solche Maschine gehoͤrig verfertigen kann, wird alle diese
Abaͤnderungen gehoͤrig zu treffen wissenDas Repertory of Patent-Inventions hat in
demselben Hefte S. 105 und 152 einen Patent-Proceß der HHrn. Lewis gegen Hrn. Davis
in extenso mit allen juridischen
Schnurrpfeifereien eingeruͤkt, die der streit- und
raͤnkelustige Leser a. a. O. selbst nachlesen mag, wenn er sich von
der Erbaͤrmlichkeit der englischen Patent-Geseze und des
englischen Gerichtswesens einen deutlichen Begriff machen will. Hr. Rayner, der diese „cause célébre“ des
englischen Gerichts-Hofes dem Redakteur des Repertory mittheilte, bemerkt, daß, wenn der Gerichtshof fortfahrt
so zu urtheilen, etc. die englische Industrie bald zu Grabe gehen
muͤsse, und Niemand mit Sicherheit ein Patent auf eine
Tuchscher-Maschine nehmen kann. Indessen haben wir hier schon wieder
eine neue Maschine, die neue Processe veranlassen wird. A. d. U..
Tafeln