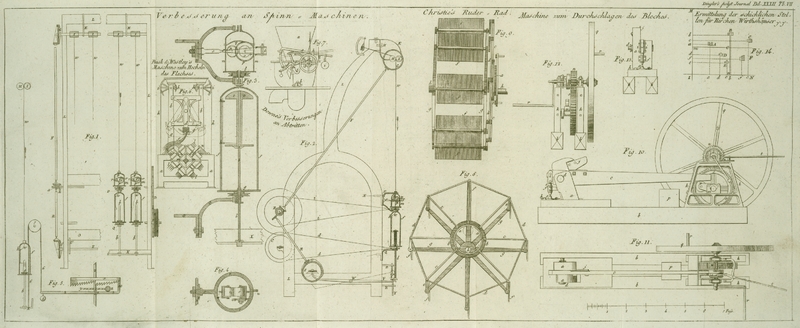| Titel: | Verbesserung an Abtritten, worauf Hr. Wich. Downe, d. ält., Bleiröhrenleger und Messinggießer zu Exeter, Devonshire, sich am 25. August 1826 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 32, Jahrgang 1829, Nr. LXXXIII., S. 370 |
| Download: | XML |
LXXXIII.
Verbesserung an Abtritten, worauf Hr. Wich. Downe, d. aͤlt.,
Bleiroͤhrenleger und Messinggießer zu Exeter, Devonshire,
sich am 25. August 1826 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Jaͤner 1829. S.
196.
Mit einer Abbildung auf Tab. VII.
Downe, Verbesserung an Abtritten.
Dieser Abtritt gehoͤrt unter die sogenannten
„selbststaͤndigen“ (self-acting), d.h. unter diejenigen, die sich selbst ausleeren und
reinigen, ohne daß man wie bei den in „(England)“
gebraͤuchlichen Abtritten einen Staͤmpel aufzuziehen braucht, oder
einen Hebel mit der Hand in Thaͤtigkeit sezen darf. Das irdene Beken
laͤßt den Unrath und das Wasser durch eine Klappe in eine eiserne
Buͤchse, aus welcher beide durch die Roͤhre in den Schlauch oder in einen anderen
Behaͤlter gelangen. Oben ist eine Cisterne mit Wasser und einer
Roͤhre, die dieses in das Beken zum Auswaschen leitet.
Der Mechanismus, durch welchen die Klappe in Thaͤtigkeit gesetzt wird, die den
Unrath aus dem Beken entleert, ist von den gewoͤhnlichen Klappen zu diesem
Zweke nicht verschieden; sie ist jedoch mehr complicirt, da sie nicht bloß den
sogenannten Teller oͤffnet, sondern auch eine gewisse Zeit uͤber offen
haͤlt, waͤhrend das aus der Cisterne herabstroͤmende Wasser den
Schmuz wegwascht, und spaͤter wieder schließt, so daß dann die Klappe
luftdicht wird, und das Aufsteigen aller uͤbelriechenden Luft
unmoͤglich macht.
Fig. 7 stellt
diesen Abtritt dar, jedoch ohne sein Gehaͤuse, d.h., Siz und Gestell sind
weggenommen. a ist das Beken; b die eiserne Buͤchse oder der Hehler, in welchen der Unrath
mittelst einer Klappe oder eines Hebel-Tellers entleert wird, c ist die Achse dieses Tellers, an deren Ende ein Hebel
mit einem Gewichte angebracht ist d, um den Teller
geschlossen, d.i. aufwaͤrts gegen den Boden des Bekens zu halten. An dem Ende
der Achse des Tellers ist zugleich ein gezaͤhnter Sektor befestigt e, der in einen Triebstok an der Seite eines kleinen
Flugrades eingreift. Ueber dem Sektor und dem Flugrade ist ein langer Hebel g, auf einer senkrechten Stuͤze h, aufgezogen, die ihm als Stuͤzpunkt dient: an
einem Ende dieses Hebels befindet sich das Gewicht i,
und an dem anderen Ende ist ein Bieget j. Dieser Hebel
wird durch eine Stoßstange k, in Bewegung gesezt, die
mit dem Size des Abtrittes in Verbindung steht, so daß, wann Jemand sich auf dem
Abtritte niedersezt, der laͤngere Arm des Hebels g, durch das Niedersteigen der Stoßstange k
niedergedruͤkt wird, und wie die Person von dem Size aufsteht, steigt der
Hebel durch die Schwere des Gewichtes i an dem
kuͤrzeren Ende gleichfalls in die Hoͤhe.
Es ist noch ein gekruͤmmter Hebel l hier
angebracht, welcher, der Deutlichkeit wegen, der Hebel mit dem Kranich-Halse
genannt wird. Der Stuͤzpunkt dieses Hebels ist auf der Achse des Flugrades
f, und dreht sich los um dieselbe. Wenn nun der
lange Arm des Hebels g, durch die Person, welche auf dem
Size sizt, niedergedruͤkt wird, so laͤuft der Buͤgel j uͤber den Schnabel des Hebels mit dem
Kranich-Halse, und bleibt, wie die punktirten Linien zeigen, in dieser Lage
so lang bis die Person wieder von dem Size aufsteht, wodurch dann die Stoßstange k und der laͤngere Arm des Hebels g wieder in ihre vorige Lage in die Hoͤhe
steigen. Da aber jezt der Buͤgel j den
kranichhalsigen Hebel gefaßt haͤlt, so hebt er, wie der laͤngere Arm
des Hebels g in die Hoͤhe steigt, diesen
kranichhalsigen Hebel gleichfalls, und da dieser mittelst eines Auges, m, mit der Achse c des
Hebel-Tellers in Verbindung sieht, oͤffnet er diesen lezteren, und
laͤßt so den Unrath aus dem Beken in den Hehler und durch diesen in den
Schlauch etc. gelangen.
Die umdrehende Bewegung, welche die Achse des Tellers auf diese Weise erhaͤlt,
dreht aber auch zugleich den gezahnten Sektor e, der auf
seiner Achse befestigt ist, und da dieser in den Triebstok eingreift, so dreht sich
auch das Flugrad f. Nachdem ferner der laͤngere
Arm des Hebels g bis zum hoͤchsten Punkte
emporgestiegen ist, schluͤpft der Schnabel des kranichhalsigen Hebels (der
eine schiefe Flaͤche bildet) aus dem Buͤgel j, und laͤßt den mit dem Gewichte beschwerten Hebel g niedersteigen, waͤhrend gleichzeitig der
gezaͤhnte Sektor aufsteigt, und die Zaͤhne des Triebstokes das Flugrad
in einer der vorigen entgegengesezten Richtung drehen. Der Zwek hiervon ist, daß der
Teller, von dem Flugrade geregelt, nicht zu schnell, sondern nur nach und nach sich
schließt, damit Zeit genug zum gehoͤrigen Abwaschen desselben uͤbrig
bleibt.
Ein Drath n verbindet den kranichhalsigen Hebel mit einem
Winkelhebel o, „(der in der Figur des
Originales nicht bezeichnet ist),“ von welchem ein anderer Drath zu
der Klappe oben in der Cisterne hinaufsteigt, damit Wasser durch die
Reinigungs-Roͤhre in das Beken herabsteigen kannSo sehr dieser Abtritt complicirt ist, so ist er doch weniger, als mancher
andere englische Abtritt, deren wir bereits so viele geliefert haben. Daß
die Beschreibung (zumal die des Tellers) und die Figur undeutlich ist, ist
nicht unsere Schuld. A. d. R..
Tafeln