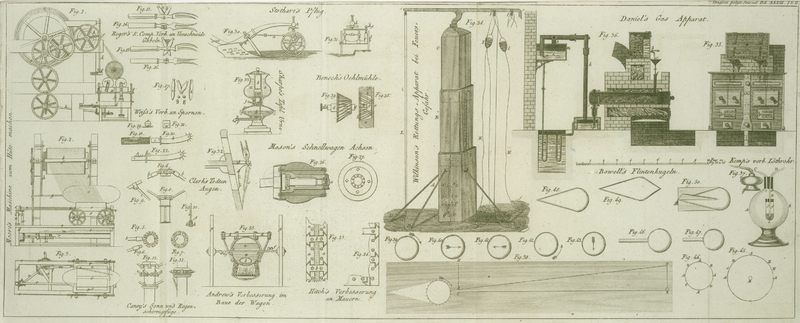| Titel: | Ueber ein verbessertes Löthrohr von Hrn. K. T. Kemp. |
| Fundstelle: | Band 33, Jahrgang 1829, Nr. X., S. 39 |
| Download: | XML |
X.
Ueber ein verbessertes
Loͤthrohr von Hrn. K. T. Kemp.
Aus dem Edinburgh New
Philosophical Journal. April 1828. S.
34.
Mit einer Abbildung auf Tab. II.
Kemp, uͤber ein verbessertes
Loͤthrohr.
Wir uͤbergehen hier die Einleitung, in welcher der Hr.
Verfasser die bekannten
Maͤngel und Nachtheile der gewoͤhnlichen Arten von
Loͤthrohr aufzaͤhlt, und gehen zur Beschreibung
seines Loͤthrohres uͤber.
„Gegenwaͤrtiges Loͤthrohr ist leicht
tragbar, fordert beinahe keine Anstrengung der Lunge, indem
eine einzige Exspiration zureicht, um zwei Minuten lang ein
Geblaͤse zu unterhalten, und nimmt wenig Raum ein. Es
besteht aus einem kugelfoͤrmigen Glase AB (Fig.
37.), dessen Hals mittelst eines
Kork-Pfropfens geschlossen ist, der mit Siegellak
vollkommen luftdicht eingesezt ist. Durch den Pfropfen
ziehen zwei Glasroͤhren Cc, Ddd, von
ungefaͤhr 1/4 Zoll im Durchmesser. Die eine
Roͤhre Cc endet
sich unter der unteren Oberflaͤche des Pfropfens bei
c, und ist, nach dem Inneren
des Gefaͤßes zu, offen. Sie ist, wie die Figur zeigt,
gekruͤmmt, und an einem ihrer Enden C in eine feine Spize
ausgezogen, durch welche die Luft ausstroͤmt, die die
Flamme zuspizt. Die andere Roͤhre Ddd, laͤuft
gleichfalls durch den Kork, endet sich aber in eine
flaschenfoͤrmige Roͤhre Ee, so, daß ihr unteres
Ende von dem Boden dieser Roͤhre Ee hinlaͤnglich
weit absteht, um die Luft, die bei D eingeblasen wird, bei dem unteren Ende d in die Roͤhre Ee ausfahren zu lassen.
Diese Roͤhre Ee
enthaͤlt etwas Queksilber, unter dessen
Oberflaͤche die Roͤhre Ee sich endet, nachdem sie
oben durch den Kork, der diese Roͤhre bei E schließt, durchging: sie ist
mittelst Siegellakes, in diesem Korke luftdicht befestigt,
in welchem zwei Oeffnungen ff eingeschnitten sind, durch welche die Luft frei
in das große Gefaͤß durch kann.
An dem Halse des Gefaͤßes AB ist eine kleine Weingeist-Lampe angebracht,
die mittelst einer Schraube gehoben oder gesenkt werden kann, so
daß die Luft, wie sie bei C
austritt, auf die Flamme wirken kann.
Bei Anwendung dieses Loͤthrohres darf nur die Lampe
mittelst der Schraube so gestellt werden, daß sie der
Roͤhre C gegenuͤber
kommt.
Wenn man nun in die Roͤhre Dd blaͤst, treibt man eine gewisse Menge Luft
in das Gefaͤß Ee, und
das Queksilber am Boden dieses Gefaͤßes wird durch die
Oeffnungen ff in das
groͤßere Gefaͤß AB herausgetrieben. Ein Theil dieses Queksilbers wird
aber, durch den Druk der Luft in dem Gefaͤße Ee auf dasselbe, in der
Roͤhre Dd empor steigen
und eine Saͤule bilden, die als Klappe wirkt, welche jede
Verbindung zwischen der aͤußeren und inneren Luft
absperrt, und jeder in den beiden Gefaͤßen enthaltenen
Luft den Ruͤkgang nach außen durch die Roͤhre Dd verwehrt, waͤhrend
dieselbe, in Folge ihrer groͤßeren Elasticitaͤt,
die sie durch ihren verdichteten Zustand erhielt, durch die
andere Roͤhre C auf die
Flamme der Lampe hinausfaͤhrt. Da nun ein paar Minuten
verstreichen, ehe die Luft in die vorige Dichtigkeit der
Atmosphaͤre zuruͤktritt, so wird dadurch ein
ununterbrochener Strom auf die Flamme in der Weingeistlampe
erhalten, und kann auch auf dieselbe fortwaͤhrend
unterhalten werden, wenn man gelegentlich in die Roͤhre
nachblaͤst: dadurch erhaͤlt der Operateur beide
Haͤnde frei, was bei Arbeiten mit kleinen
Gegenstaͤnden wichtig ist.
Das Instrument kann noch brauchbarer gemacht werden, wenn man bei
C einen Sperrhahn anbringt, und
mittelst dessen den Luftstrom regulirt; in den meisten
Faͤllen ist dieß jedoch uͤberfluͤssig.
Statt daß man die Roͤhre Ddd sich in dem Gefaͤße Ee enden laͤßt,
haͤtte man dieselbe auch in das Gefaͤß AB bis nahe an den Boden
desselben leiten, und diesen mit Queksilber uͤbergießen
koͤnnen, in welches die Roͤhre sich dann endete.
Wenn das Gefaͤß immer still an einem Orte stehen bleibt,
dient diese lezte Vorrichtung eben so gut; wenn es aber hin und
her getragen werden muß, schwingt das Queksilber sich
oͤfters vom Boden der Roͤhre weg, die
Elasticitaͤt der in dem Gefaͤße enthaltenen Luft
treibt dieselbe dafuͤr in diese Roͤhre ein, und
die Luft entweicht bei D.
Auf eben dieselbe Weise laͤßt sich auch bei dem
hydraulischen Loͤthrohre eine Klappe bilden. Die
Roͤhre, die aus dem Blasebalge kommt, kann. Statt die
gewoͤhnliche Klappe zu besizen und sich oben in dem Luftgefaͤße zu
enden, bis auf den Boden desselben
herabsteigen, wo dann, wenn Luft durch den Blasebalg eingeblasen
wird, dieselbe das Wasser aus der Roͤhre nach dem oberen
Theile des Gefaͤßes treiben wird. Hier wirkt nun das
Wasser als Klappe, und hindert den Ruͤktritt der Luft
durch die Roͤhre, waͤhrend die Luft auf die
gewoͤhnliche Weise durch die andere Roͤhre
ausgetrieben wird.
Auf diese Weise erhaͤlt man nun die einfachste Klappe von
der Welt, die nicht leicht in Unordnung geraͤth, und man
braucht nicht mehr Gewalt die Luft einzublasen, als nach der
gewoͤhnlichen MethodeHr. Kemp bemerkt bei dieser
Gelegenheit noch die sonderbare Erscheinung, daß, wenn man auf ein Queksilber-Amalgam eine
mit Wasser verduͤnnte Saͤure gießt, und
dann Metalldrathe in dieses Amalgam stekt, das
Queksilber an den Drathen alsogleich so hoch
hinauflaͤuft, als die Fluͤssigkeit in dem
Gefaͤße steht.
Tafeln