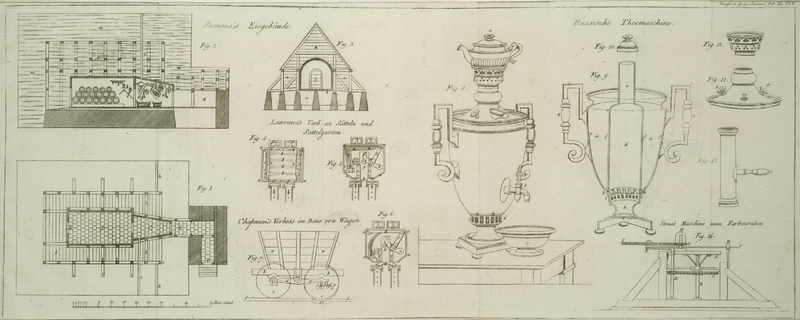| Titel: | Ueber Nuzen und Anlage von Eisgebäuden statt der bisherigen Eiskeller oder Eisgruben. Von dem Oberamtmann, Herrn Siemens, zu Pyrmont. |
| Fundstelle: | Band 40, Jahrgang 1831, Nr. LII., S. 261 |
| Download: | XML |
LII.
Ueber Nuzen und Anlage von Eisgebaͤuden
statt der bisherigen Eiskeller oder Eisgruben. Von dem Oberamtmann, Herrn Siemens, zu Pyrmont.Da wir bisher alles was auf Aufbewahrung des Eises Bezug hat, sorgfaͤltig
sammelten und in diesem Journale mittheilten (man schlage daruͤber die
Register nach), so nehmen wir auf diesen Grund keinen Anstand, die hier folgende
Abhandlung uͤber Anlage von Eisgebaͤuden, welche mit den
amerikanischen Eisbehaͤltern (polyt. Journal Bd. XXII. S. 269.) einige Aehnlichkeit
hat, aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des Gewerbfleißes
in Preußen Jahrgang 1831. S. 50. der Vollstaͤndigkeit wegen mitzutheilen.
A. d. R.
Aus den Verhandlungen des Vereins zur Befoͤrderung des
Gewerbfleißes in Preußen. 1831. 1ste Lief. S. 50.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Siemens, uͤber Nuzen und Anlage der
Eisgebaͤude.
Der Nuzen des aufbewahrten Eises fuͤr den Sommer, besonders fuͤr große
Wirtschaften, als Brauereien, Brennereien, Molkenwesen, Mezgereien u.a.m. ist
bekannt. Doch scheint dessen Nuzbarkeit bisher noch nicht in verdienter Art
gewuͤrdigt zu seyn, theils weil die Mittel der sichern Aufbewahrung des Eises
wohl zu unbekannt, oder wenigstens noch nicht angewendet, theils weil die
Nuzanwendung des Eises selbst noch nicht uͤber ihre gewoͤhnlichen
Graͤnzen hinausgeschritten ist. Sind wir so gluͤklich, Schnee oder Eis
einmal im Laufe des Jahrs vom Himmel zu erhalten, so duͤrfen wir es wahrlich
nicht wieder schmelzen lassen, ohne das Noͤthige fuͤr unsern Bedarf
fuͤr den Sommer aufzubewahren. – Um die Wirkung der Kaͤlte zu
zeigen, die das Eis waͤhrend dem Schmelzen hervorbringt, bedarf es nur des
Beispiels, daß wenn gleiche Quantitaͤten Wasser von 60° R. und Eis von
0° vermischt werden, die Temperatur des Wassers doch 0° bleibt,
obgleich nach dem arithmetischen Mittel beider Temperaturen die Waͤrme des
Wassers 35° haͤtte seyn muͤssen. Allein die freie Waͤrme
des Wassers war erforderlich, um das Eis zum Schmelzen zu bringen, ohne eine
Erhoͤhung der Temperatur der dadurch erhaltenen Wassermenge zu bedingen,
indem die Waͤrmecapacitaͤt des Wassers betraͤchtlich
groͤßer ist, als die des Eises.
Zu obigen Zweken bediente man sich bisher der Eiskeller oder Eisgruben, die man unter
der Erde anlegte und wasserfrei hielt. Waren diese Raͤume hinlaͤnglich
mit schlechten Waͤrmeleitern ausgelegt, so genuͤgten diese
Vorrichtungen wohl theilweise zu einigen Zweken, allein selten fallen die Anlagen
der Art so aus, daß das Eis darin von einem Jahr ins andere erhalten werden kann,
was dann um so empfindlicher wird, wenn die Keller nicht jaͤhrlich
nachgefuͤllt werden koͤnnen. Die Hauptursache dieses Verstoßes liegt in
der Temperatur unserer Erde selbst. Bekanntlich duͤrfen wir fuͤr die
Temperatur unserer obern Erdschichten die mittlere Temperatur der sie umgebenden
atmosphaͤrischen Luft annehmen. Diese ist fuͤr unsere Gegenden 6 bis
7° R.,Fuͤr Berlin 9,1° C. = 7,28° R. A. d. R. d. G. V. in den heißen Laͤndern Europens aber wohl 10 bis 14° R.
Koͤnnten wir den Eisraum so hinlaͤnglich mit schlechten
Waͤrmeleitern umgeben, daß die Waͤrme der Erde nicht durchzudringen
vermoͤgend waͤre, so wuͤrde das Eis sicher nicht schmelzen.
Aber eine solche Umgebung in der Erde zu schaffen wuͤrde unsaͤgliche
Kosten verursachen, und das zu verwendende Kapital sich nicht verinteressiren
koͤnnen, auch die anzuwendenden Materialien moͤchten leicht in
Gaͤhrung gerathen. Dieß brachte mich endlich auf den Gedanken, mit einen Raum
zur Eisbewahrung statt unter der Erde uͤber der Erde zu bauen; hier konnte
ich noch weiter um mich greifen. Ich baute einen Keller zur Conservirung der
Lagerbiere etc. und ein Vorrathsgewoͤlbe fuͤr alle im Sommer schwer
aufzubewahrenden Gegenstaͤnde; diese wurden dann hinlaͤnglich mit Eis
belegt, was ich mit den billigsten schlechten Waͤrmeleitern dergestalt
umhuͤllte, daß die aͤußere Waͤrme wenig oder fast gar nicht
eindringen konnte.
Ich waͤhlte zur Eisumschließung die billigsten schlechten Waͤrmeleiter,
als: Luft, Holz, Stroh, schlechtes aber troknes Heu und Spreu von Getreide, welche
leztere wegen ihrer kuͤrzern Zwischenraͤume sich sehr gut zur
Lufteinhuͤllung eignet. Sind dieß auch nicht die besten Mittel, so sind es
doch diejenigen, die dem Landwirth am naͤchsten liegen und womit er durch
eine groͤßere Anhaͤufung dasjenige bezweken kann, was in anderen
Verhaͤltnissen durch kraͤftigere aber kostbarere Nichtleiter der
Waͤrme in engeingeschlossenen Raͤumen zu bewirken seyn wuͤrde.
Zur Auffuͤhrung eines solchen Eisgebaͤudes waͤhlte ich
uͤber der Erde einen troknen Plaz und umschloß den laͤnglich
vierekigen Raum so weit, als das Eis zu liegen kommen sollte, mit einer Mauer von 6
Fuß Hoͤhe und 2 Fuß Breite, im Lichten 42 Fuß lang und 26 Fuß breit. Das
Innere dieses Raumes ließ ich auf jede 6 Fuß mit einer 1 1/2 Fuß breiten Mauer
durchziehen; auf diese Mauern sollte das Fundament des Gebaͤudes ruhen. Dieß
Fundament besteht in Balken, auf welche 2 bis 3 zoͤllige, mit Pech
uͤberzogene, Bohlen geschlossen gelegt und nachher kalfatert oder wasserdicht
geschafft werden. Hierdurch ist nun schon ein Raum mit ruhender trokner Luft, als
schlechtem Waͤrmeleiter, unter dem ganzen Gebaͤude gebildet. Es
laͤßt sich nur ein solcher hier allein anbringen, denn jeder andere
wuͤrde durch die aus der Erde aufsteigenden Duͤnste bald dem
Verderben unterworfen seyn. Zur Ableitung der Feuchtigkeit von Unten stehen die
innern Raͤume mit Kanaͤlen in Verbindung; auch ist der innere Raum 1
1/2 Fuß hoch mit Kohlen ausgestampft, am besten mit ausgebrannten Steinkohlen oder
Holzkohlengestuͤbe. Wasser, welches sich zufaͤllig sammeln
koͤnnte, findet seinen Ausweg durch eine angebrachte Roͤhre unter der
Erde zur Seite, damit die Luft unter dem Gebaͤude moͤglichst troken
gehalten werde. Auch zur Ableitung der Feuchtigkeit, die durch den Abgang des Eises
sich oberhalb der Bohlen erzeugt, ist gesorgt, dieselbe wird auf den
abschuͤssig gelegten Bohlen zur Seite geleitet und mittelst kleiner Rinnen,
die in die Bohlen gehauen, gesammelt und ebenfalls durch ein enges Rohr
auswaͤrts gefuͤhrt.
Auf obigem Fundament errichtete ich nun aus starkem eichenen Zimmerholz ein
Gebaͤude dergestalt, daß es innerhalb dem Druk eines stark beschwerten
Gewoͤlbes und von Außen ebenfalls einem starken Druk widerstehen konnte. Den
innern Raum ließ ich dann ausbauen, aus guten Baksteinen wasserdichte
Gewoͤlbe anlegen, die als Keller und Vorrathskammern dienen sollten. Die
Bohlen in diesen Gewoͤlben wurden ebenfalls mit Baksteinen oder steinernen
Platten belegt, vorzuͤglich deßwegen, um so viel als moͤglich alles
Holz einzuhuͤllen, was immer in solchen Raͤumen einen mulstrigen
Geruch verbreitet. Das uͤbrige Innere des ganzen Gebaͤudes
uͤber diesen Gewoͤlben war zur Fuͤllung mit Eis bestimmt. Das
Eis mußte nun durch die moͤglichste Einhuͤllung von den schlechten
Waͤrmeleitern entfernt gehalten werden, mit welchen es umschlossen werden
sollte, denn jede Vereinigung, selbst auch nur die der Duͤnste, wuͤrde
eine Aufloͤsung der schlechten Waͤrmeleiter, eine Gaͤhrung
veranlassen, dieß eine Waͤrmeerzeugung zur Folge haben und so das Schmelzen
des Eises progressiv befoͤrdern muͤssen. Das Aeußere des
Gebaͤudes wurde deßwegen mit einzoͤlligen eichenen Dielen benagelt. Um
jedoch jede Mittheilung der Feuchtigkeit so viel als moͤglich zu vermeiden,
war es nothwendig, die Dielen, deren Seiten 2 Zoll uͤber einander zu liegen
kommen, nicht von Unten herauf (wie gewoͤhnlich der Fall ist, um ein
Gebaͤude gegen Naͤsse von Außen zu schuͤzen), sondern von Oben
herab uͤber einander zu legen und zu nageln. Die Duͤnste vom Eis, wenn
sie sich nun auch an die Dielen ansezen, koͤnnen dann unmoͤglich nach
Auswaͤrts an die Bedekung dringen, sondern muͤssen an der inneren
Seite heruntergleiten. Die Bedekung obigen Gebaͤudes mit schlechten
Waͤrmeleitern ist nach allen Seiten hin und auch uͤber demselben 12
Fuß stark. Sie besteht, wie schon gesagt, aus den billigsten, als Stroh, Heu, Spreu,
Ruͤbsamenschoten etc., womit das ganze Gebaͤude, in einer angemessenen
Ordnung, tienenartig umlegt ist. Um diese Tiene noch mehr gegen das Eindringen
der Waͤrme und hauptsaͤchlich gegen Feuersgefahr zu schuͤzen,
wird sie mir einer Deke von Lehm uͤberzogen; und diese dann wieder mit einem
billigen Kitt, der aus Lehm, Grand, Kuhdrek, etwas Kalk, mit feinem Haͤksel
oder Spreu gemengt, besteht und statt mit Wasser, mit Mistjauche oder Guͤlle,
zu Kleister gemischt worden. Dieser Ueberzug ist so haltbar, daß das Regenwasser
wenig Einfluß darauf aͤußern kann. Um das Eindringen der Sonnenstrahlen zu
hindern und abzuhalten, wird das Ganze noch mit Kalk uͤberstrichen. Auch kann
das ganze Gebaͤude mit schnellwachsenden vielschattenden Baͤumen
umpflanzt werden.
Wir kommen nun zum Eingang in das Eisgewoͤlbe; dieser muß sehr vorsichtig
angelegt werden. Es ist bekannt, daß trokene ruhende Luft ein sehr schlechter
Waͤrmeleiter ist, und diesen koͤnnen wir auch nur allein hierbei
benuzen. Je mehr Abtheilungen also vorhanden, in denen die trokene Luft in Ruhe
bleiben kann, desto weniger leicht wird die Waͤrme bis zum Eisgewoͤlbe
dringen. Zu diesem Zwek sind drei Abtheilungen vorhanden, wovon jede wieder mit
schlechten Waͤrmeleitern geschlossen ist; naͤmlich durch
Thuͤren, die auch mit leichtem Holz versehen seyn koͤnnen, aber in der
Mitte, auf 4 bis 5 Zoll Staͤrke, mit Wolle, Haaren oder Federn
ausgefuͤttert seyn. Die vierte Thuͤr oͤffnet endlich das
Gewoͤlbe zur ersten Vorrathskammer, welche dann, nachdem die Temperatur bis
dahin durch die Abtheilungen allmaͤhlich erniedrigt worden, wenig mehr an
Kaͤlte verlieren kann. Das Ganze des Eingangs bildet ein starkes, massives,
mit Balken, Sparren und Strohdach versehenes Gebaͤude, dessen mit Dielen
belegter Boden mit Stroh gefuͤllt und festgestopft ist. Eine Roͤhre
fuͤhrt frische Luft nach dem Vorrathsgewoͤlbe; oben im Gewoͤlbe
befindet sich eine andere Roͤhre, um die dunstige Luft aufwaͤrts
abzufuͤhren. Dieser Abzug ist hier um so noͤthiger, als der
aufzubewahrenden Gegenstaͤnde in diesem Gewoͤlbe mancherlei sind. Die
Roͤhren sind gewoͤhnlich verschlossen und werden nur periodisch in
kuͤhler Zeit geoͤffnet. Unten geschieht dieß mit eigens dazu geformten
Stoͤpseln, oben aber durch eine Klappe, die mittelst einer auswaͤrts
Herabhaͤngenden Schnur aufgezogen werden kann.
Beschreibung der auf Tab. V. gegebenen Zeichnung des Eisgebaͤudes.
Fig. 1. stellt
das Gebaͤude dar, so wie die Sohle desselben auf den Bohlen ruht; Fig. 2. einen
senkrechten Laͤngendurchschnitt und Fig. 3. einen
Querdurchschnitt des Gebaͤudes.
In Fig. 3.
sieht man den Grund a mit den Mauern, auf welchen die
Balken ruhen. Der untere Theil der Raͤume ist gegen 1 1/2 Fuß hoch mit trokenen schlechten
Waͤrmeleitern, z.B. Kohlengestuͤbe oder ausgebrannten Steinkohlen,
festgestampft. Auf die Balken ist das gepechte, kalfaterte Fundament b gelegt. Der Eingang d
besteht aus drei Abtheilungen und vier doppelten Thuͤren, wovon die vierte
e das erste Eisgewoͤlbe oͤffnet. Zur
Bequemlichkeit beim Oeffnen bestehen die Thuͤren aus zweien Fluͤgeln,
die in der Mitte schraͤg zusammenschlagen, und von denen der eine
gewoͤhnlich ungeoͤffnet bleibt, sobald nicht Tonnen oder sonstiges
Geraͤth hineinzuschaffen sind. Die ersten drei Thuͤren sind mit
hoͤlzernen Thuͤrgeruͤsten umgeben und saͤmmtlich, der
Dichtigkeit wegen, mit Tuchleisten doppelt bekleidet. Die vierte Thuͤr, die
das erste Eisgewoͤlbe f oͤffnet, hat
dieselbe Einrichtung; das Thuͤrgeruͤst besteht nicht aus Holz, sondern
aus Stein, in welchem die Haken mit Blei eingegossen sind. Das Eisgewoͤlbe
ist mit guten Baksteinen gemauert, die der Feuchtigkeit widerstehen, ohne zu
zerbroͤkeln. Die Baksteine werden auf ihre schmale platte Seite vermauert und
in guten Cementkitt gelegt, der nicht die geringste Feuchtigkeit durchlassen darf.
Die Gewoͤlbe, und vorzuͤglich das Vordergewoͤlbe, was
hauptsaͤchlich zur Aufbewahrung aller moͤglichen Victualien dient,
werden mit gegen 60 bis 80 Stuͤk eiserner Haken versehen, die gleich
anfaͤnglich mit Vorsicht einzumauern und zu verwahren sind. An jeder Seite
dieses Vorgewoͤlbes befindet sich eine kleine Pforte, 3 Fuß breit, 5 Fuß
hoch, gewoͤlbt aber zugemauert, die nur in dem Fall aufgebrochen wird, wenn
das Gebaͤude mit Eis nachgefuͤllt werden soll. Zur Versicherung des
Gewoͤlbes sind die drei Quermauern oben mit eisernen Stangen und Haken
festgeklammert. Eine zweite aber einfache Thuͤr in Stein gesezt
oͤffnet in diesem Gewoͤlbe den hinteren Vorrathskeller, in welchem
Lagerbier und sonstige Fluͤssigkeiten aufbewahrt werden. In der Mauer im
Hintergrund ist das sogenannte Eispfoͤrtchen h
angebracht, woraus der taͤgliche Bedarf des Eises genommen wird. Dieses ist
ebenfalls mit einer festanschließenden Thuͤr, in Steingeruͤst gesezt,
versehen. Zu bemerken sind noch die beiden untern Roͤhren k, um die Feuchtigkeit aus den unteren Raͤumen zu
leiten, und die Luftroͤhre i, die ins
Vorrathsgewoͤlbe fuͤhrt.
Fig. 2. gibt
den Durchschnitt des Eisgebaͤudes nach seiner Laͤnge: d die beiden Vorzimmer, das Vorrathsgewoͤlbe und
der Keller zur Aufbewahrung der Fluͤssigkeiten; l
die Umgebung der Gewoͤlbe mit Eis, hier bemerkt man die Spizen der Sparren
mit der ersten Bretterflur darauf, ebenfalls die durchstehenden Hahn- und
Kehlbalken, endlich die Umgebung mit schlechten Waͤrmeleitern m, m, m und die Luftroͤhre i. In Fig.
3., die den Querdurchschnitt des innern Gebaͤudes angibt, bemerken
wir die Bauart des Sprengwerks n, um dem Druk des Gewoͤlbes
von Innen und dem Druk von Außen zu widerstehen. In dem Gewoͤlbe selbst
werden wir noch das hinterste Pfoͤrtchen h
gewahr, durch welches das Eis ausgenommen werden kann. Wie schon gesagt, muß die
Umbansung tienenartig geschehen, damit durchaus keine Feuchtigkeit einwaͤrts
dringen kann, sondern vielmehr Alles nach Außen geleitet wird. Ich habe dabei
folgende Ordnung beobachtet: an das Gebaͤude legte ich zuerst 2 Bund
Gerstenstroh, zwischen welchen ein Raum von 1 Fuß offen gelassen wurde, der mit
Spreu vollgestopft und getreten wurde. In dieser Art fuhr man fort, so lange an dem
Gebaͤude in schraͤger Richtung nach Außen hin aufzubausen, bis daß die
ganze Bansenlinie, wenn das lezte Bund Langstroh auf die 12 Fuß Breite ausgelegt
war, sich unter einem Winkel von 45 Grad nach Außen hinneigte. Das Bansen auf obige
Weise wurde vom Gebaͤude aus immer angefangen und unter dem genannten Winkel
bis 18 Fuß uͤber die Spize des Dachs damit fortgefahren. Nachdem die Tiene
sich gehoͤrig gedruͤkt und gesenkt hatte, betrug die Hoͤhe nur
noch etwa 12 Fuß uͤber dem Dach.
Wegen Aufbauung des ganzen Gebaͤudes muß ich noch einige Regeln
anfuͤhren. Man fange mit dem Bau der Grundpfeiler im Fruͤhjahr zeitig
an; sobald diese ausgetroknet sind, wird an der Balkenflur und an der Bedielung des
Fundaments gearbeitet. Die Bohlen hierzu muͤssen durchaus troken seyn, damit
sie geeignet das heiße Pech und die Kalfalterung aufzunehmen. Alsdann wird das
Gebaͤude darauf gerichtet, jedoch nur so weit bedielt, als erforderlich, um
das darin jezt aufzufuͤhrende Gemaͤuer vor Regen zu schuͤzen.
Die Gewoͤlbe werden dann in beschriebener Art darin aufgefuͤhrt; das
Gebaͤude bleibt hierauf unterwaͤrts so lange offen, bis die
Gewoͤlbe voͤllig ausgetroknet sind, wozu wohl 1 bis 2 Monate
erforderlich seyn duͤrften. Wenn dieß geschehen, so ist dann das
Gebaͤude voͤllig zu umdielen und in gehoͤriger Ordnung zu
umbansen, jedoch bleibt die hinterste Giebelseite offen, um das Gebaͤude im
Winter bequem mit Eis fuͤllen zu koͤnnen. Vortheilhafter fuͤr
die Erhaltung des Eises wuͤrde es allerdings seyn, wenn die Umbansung des
Gebaͤudes lange vorher, ehe das Eis hineingebracht wird, in Ordnung gebracht
waͤre, damit sich die Tiene gehoͤrig in ihrer Ruhe wieder
gekuͤhlt, oder so zu sagen abgelagert haben koͤnnte, denn auch das
aͤlteste und trokenste Stroh erregt aufs Neue wieder Waͤrme, sobald es
umgebanst wird, was von der Friction herruͤhren mag. Die Einbringung und
Fuͤllung des Gewoͤlbes mit Eis wuͤrde aber dann doch zu
beschwerlich fallen und man muß sich den Verlust an Eis hierbei gefallen lassen. Bei
dieser ersten Tiene ist noch zu beobachten, daß dieselbe an der Giebelseite in
schraͤger Richtung aufgefuͤhrt wird, damit die neue Banse sich auf die aͤltere
stuͤzen und ohne groͤßern Nachtheil nachgefuͤhrt werden kann.
– Zur Einbringung des Eises ist ein strenger Winter zu waͤhlen, auch
ist dieses Geschaͤft nicht waͤhrend des Thauwetters vorzunehmen, denn
die Erfahrung hat gezeigt, daß es in Hinsicht der Aufbewahrung des Eises ein großer
Unterschied ist, ob diese Arbeit waͤhrend des Frostes oder Thauwetters
geschieht.Es verdient auch darauf aufmerksam zu machen, daß man das Eis nicht sogleich
nach dem Aufhauen in den Eiskeller einfahre, sondern daß es einige Zeit in
Haufen liegen bleiben muß, um die niedere Temperatur der kalten Luft
anzunehmen, denn da, wo es mit Wasser in Beruͤhrung war, hat es nur
0° Kaͤlte, es wird aber erst nach einiger Zeit die Temperatur
der umgebenden kalten Luft annehmen. Zur Zeit von Thauwetter ist das Eis
0° kalt, also selbst im Schmelzen begriffen. A. d. R. d. G. V.
Das Eis wird im Gebaͤude mit hoͤlzernen Kloͤppeln zerschlagen.
Wenn die unteren Raͤume mit Eis gefuͤllt sind (was auch bei der
Giebeloͤffnung geschehen kann, da die Dielen auch von Unten in derselben
Ordnung, wie die fruͤhern, angenagelt werden koͤnnen, wenn man die
eine hinter die andere schiebt), so muß das Eis auf schraͤg gerichteten
Bohlen, mittelst kleiner Kasten, aufwaͤrts gezogen und in die hintern
Raͤume geschafft werden; anfaͤnglich auf den Balken, worauf die Dielen
zum Weiterziehen liegen, und nachgehends in derselben Ordnung auf den Kehlbalken
hinaus. Auf diese Weise faͤllt diese Fuͤllung mit Eis gar nicht so
schwierig aus, als sie anfaͤnglich scheinen moͤchte. Die Bebansung des
Giebels muß im Winter sehr vorsichtig ausgefuͤhrt werden, hinlaͤnglich
trokenes Stroh, Spreu etc. in Vorrath seyn und zureichende Huͤlfe, um die
ganze Arbeit in einem Tag, bei der Wahl einer hellen, trokenen, kalten Witterung,
schnell vollfuͤhren zu koͤnnen. Zur Versicherung, daß an der Scheidung
der fruͤhern und spaͤtern Banst keine Hoͤhlungen entstehen,
wird solche bei jeder Strohlage mit Spreu ausgetreten. – Dieß waͤren
die Regeln, welche bei einer Hauptfuͤllung des Gebaͤudes mit Eis zu
beobachten, welche jedoch nur bei einem strengen Winter vorzunehmen. Ist nach dem
Aufbau des Gebaͤudes der folgende Winter nicht dazu geeignet, so rathe ich,
lieber einen solchen voruͤbergehen zu lassen, als das Gebaͤude mit
schlechtem Eis zu fuͤllen. Wenn aber diese Arbeit einmal gluͤklich
vollbracht ist, so kann, bei der hier angegedenen Vorrichtung, immer eine Dauer von
6 bis 10 Jahren angenommen werden, bei welcher dann jedes Mal der Giebel losgebanst
werden muß. Kleinere Nachfuͤllungen bei maͤßigen Wintern sind deßwegen
aber auch nicht zu versaͤumen; diese geschehen indeß nur von Innen her,
theils durch das hinterste Pfoͤrtchen, theils durch die beiden kleinen
Nebenpfoͤrtchen im Vordergewoͤlbe, die dann aufgerissen werden
koͤnnen.
Jeder denkende Mann wird es leicht einsehen, daß obige Einrichtung zur Aufbewahrung
des Eises und die Beschaffenheit des Locals schon jedem Haushalt von einigem Umfang
sehr vortheilhaft seyn muß; hauptsaͤchlich wichtig ist sie fuͤr
Landwirthe, die Bierbrauerei, Brantweinbrennerei etc. besizen. Lagerbiere halten
sich waͤhrend des Sommers hoͤchst unvollkommen in unsern
gewoͤhnlichen Kellern, nur in einigen Bierkellern Sachsens, Bayerns, die
zugleich mit Eiskellern in Verbindung stehen, bleibt das Bier haltbar, doch nur so
lange, als der Eisvorrarh anhaͤlt. Sobald dieser nicht ersezt wird, gerathen
dann alle Vorraͤthe ins Verderben. Wie vortheilhaft eignet sich dagegen
unsere Vorrichtung zur Aufbewahrung aller moͤglichen Fluͤssigkeiten
und anderer Victualien, die in der Waͤrme so leicht dem Verderben unterworfen
sind; wie vortrefflich wuͤrden sich z.B. alle Obst- und Zukerweine
(als neuer Gewerbzweig fuͤr Landwirthe) in diesem Keller aufbewahren lassen!
Die Temperatur in demselben bleibt immer 0 Grad und nur dann, wenn eine Zeit lang
darin gearbeitet ist, steigt dieselbe wohl bis auf + 1 bis 2 Grad. Gehen wir nun von
der Kaͤlte-Erzeugung, die unsere Vorrichtung schafft, auf die
unmittelbare Verwendung des Eises selbst uͤber, so finden wir in unsern
Wirthschaften außerordentlichen Nuzen davon. Wie vortheilhaft ist die Anwendung des
Eises bei heißen Sommertagen in den Brennereien, um die Maische bis zum
Anstellungsgrad abzukuͤhlen. Oft ist hier ein Eimer voll genuͤgend,
die Maische zu 1 Oxhoft Brantwein gegen Saͤurung zu schuͤzen. Wie
nothwendig ist das Eis in jedem Molkenwesen; wie vortheilhaft fuͤr die
Kuͤche und uͤberhaupt den ganzen innern Haushalt!
In meinem Verhaͤltnisse hier in Pyrmont hat mir das Eisgebaͤude
wesentlichen Nuzen geschafft; meine Lagerbiere, unter der Benennung Eisbiere, sind
in der ganzen Gegend bekannt. Da mit dem Vorrathsgewoͤlbe eine Mezgerei in
Verbindung steht, so habe ich das Publicum in den heißesten Sommertagen immer mit
dem besten Fleisch versehen koͤnnen. Auch den uͤbrigen Mezgern steht
es frei, ihr Fleisch gegen maͤßigen Miethzins hier im Eishause aufzubewahren,
wovon diese um so lieber Gebrauch machten, als sie oft in den heißesten Tagen in die
Verlegenheit gerathen waren, ihr Fleisch nach dem dritten oder vierten Tag schon
wegzuwerfen. Selbst die angesehensten Brunnengaͤste senden ihre Victualien
und Medicamente zur Aufbewahrung ins Eishaus. Noch muß ich bemerken, daß in den
Eisgewoͤlben die groͤßte Reinlichkeit zu beobachten ist. Das
Vorrathsgewoͤlbe muß wenigstens immer so rein als die beste Holstein'sche
Molkenstube gehalten werden. Das Scheuern der Waͤnde und Fußboͤden mit
kaltem Wasser thut dem Eis wenig Abbruch.
Was die Kosten der Anlage betrifft, so duͤrften diese dem Landwirth wohl
weniger beschwerlich fallen, als dem Staͤdter, der Alles dazu
kaͤuflich herbeischaffen muß. Die zu verwendenden Baumaterialien behalten
auch auf die Dauer ihren Werth und koͤnnen dabei also nur die Interessen des
Kapitals in Betracht kommen. Zur Verwahrung des Eises, um es nur im Sommer, Behufs
der Brennerei, Kuͤche und Molkenwesen zu verwenden, bedarf es
natuͤrlich weniger kostspieliger Vorrichtungen. So hat sich z.B. mein Bruder,
der Oberamtmann Siemens in Lutter am Barenberge, in
seiner Wirthschaft uͤber der Erde einen Eisbehaͤlter gebaut, dessen
Umgebung aus einer doppelten Bretterwand besteht, die auf 3 Fuß breit mit
Gerstenspreu ausgefuͤllt ist. Das Eis erhaͤlt sich hier schon seit
mehreren Jahren, und es liefert diese Einrichtung den Beweis, daß das Eis auf unsere
Weise uͤber der Erde gegen das Schmelzen sicherer verwahrt ist, als auf die
bisherige Art unter der Erde. Zur Aufbewahrung des Eises fuͤr Haushaltungen,
die es bloß fuͤr Kuͤche und Molkenwesen in Anwendung bringen wollen,
rathe ich, dasselbe in doppelte Faͤsser zu paken, deren Zwischenraͤume
mit Kohlengestuͤbe ausgefuͤttert und die uͤber der Erde mit
Stroh umlegt sind. Zu diesem Zwek waͤhle man die gewoͤhnlichen
Stuͤkfaͤsser von 5 Oxhoft Gehalt und seze ein 2 Oxhoft haltendes Faß
hinein, nachdem in diesem durch den Boden, in jenem aber unten an der Seite, eine
Oeffnung gelassen, durch welche die abgehende Feuchtigkeit mittelst einer
Roͤhre abgeleitet werden kann. Diese Faͤsser, wenn sie in einem
kuͤhlen Gebaͤude angestellt werden, wo sie nur einigermaßen mit Stroh
umhuͤllt werden koͤnnen, conserviren das Eis außerordentlich. Wenn die
inneren Faͤsser mit Eis ausgestampft und so weit sie herausreichen mit
Kohlengestuͤbe umgeben sind, so werden die Eisfaͤsser mit einem Dekel
versehen, auf welchem entweder ein Sak mit Kohlengestuͤbe, oder besser noch
mit schlechten Federn gefuͤllt, zu liegen kommt, welcher dann noch ferner mit
hinreichendem Stroh uͤberdekt wird.
Tafeln