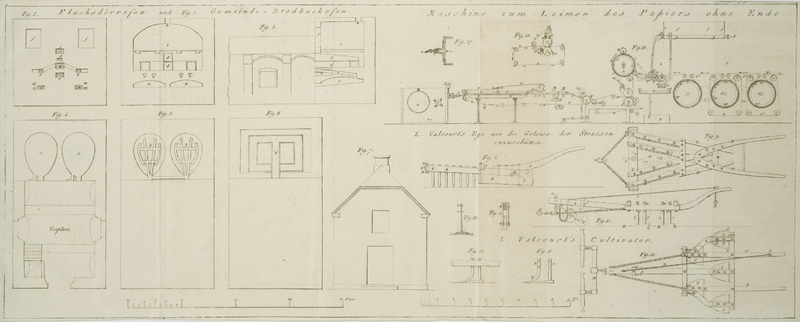| Titel: | Beschreibung eines Flachsdarrofens nebst eines Gemeinde-Brodbakofens. |
| Fundstelle: | Band 41, Jahrgang 1831, Nr. VII., S. 33 |
| Download: | XML |
VII.
Beschreibung eines Flachsdarrofens nebst eines
Gemeinde-Brodbakofens.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Beschreibung eines Flachsdarr- und Brodbakofens.
Zur Erbauung eines solchen Ofens waͤhle man entweder einen schon an sich
trokenen Plaz, oder suche das Gebaͤude durch Abzugsgraͤben,
Erhoͤhung der Grundmauer u.s.w. vor Naͤsse zu schuͤzen.
– Ein Plaz, welcher gegen die Winde geschuͤzt ist, hat vor Allem den
Vorzug. –
Die vollkommenste Feuersicherheit erzielt man durch die innere Einrichtung, deßhalb
ist es weder noͤthig, noch in vieler Beziehung gut, den Ofen außerhalb dem
Orte zu erbauen. –
Zwar nicht noͤthig, aber besonders polizeilich rathsam ist es mit einer
solchen Doͤrranstalt zum Gemeinde-Gebrauch einen Bakofen mit in
Verbindung zu bringen.
Der Doͤrrraum selbst ist eine Kammer in Quadratform von soliden Seitenmauern,
mit gewoͤlbter Deke.
Es ist noͤthig, Waͤnde und Deke moͤglichst waͤrmehaltig
zu mamen, was man dadurch erreicht, wenn
1) das Gewoͤlbe aus Ziegeln gemacht und mit Lehm
uͤberschlagen wird, und daß man die Waͤnde mit ganz schwach
gebrannten oder mit Luftziegeln aussezt, welche unter die besten
Waͤrehalter gehoͤren und in dieser Hinsicht vor den
staͤrker gebrannten Ziegeln den Vorzug verdienen;
2) wo Lehm und Ziegel nicht leicht zu haben sind, muß man
Waͤnde und Deken von Außen mit schwachen Brettern beschlagen. Da der bloß
mit Luft gefuͤllte Raum unter die besten Waͤrmehalter
gehoͤrt, so ist es gut, wenn der Bretterverschlag etwas von den
Waͤnden und dem Dekengewoͤlbe absteht.
Unten im Doͤrrraum wird der Ofen angebracht, der durchaus auf Luftheizung
eingerichtet seyn muß, wenn der Flachs bald duͤrr und moͤglichst
schoͤn werden soll.
In Schoͤnbrunn ist der Ofen von Ziegel und mit einer eisernen Platte bedekt.
Auf diese Platte ist von Ziegelstuͤken ein horizontaler Zug gemauert, der auf
der einen Seite in den Rauchfang sich oͤffnet, auf der anderen aber in den
Doͤrrraum ausgeht. Wenn nun die Platte heiß wird, so stroͤmt die Luft
kalt bei der aͤußeren Oeffnung in den Zug ein, und kommt sehr heiß bei der
inneren Oeffnung in den Doͤrrraum.
Von dem Feuerraum aus geht hier ein von Kacheln aufgesezter Rauchzug weiter in den
Doͤrrraum horizontal hinein, theilt sich, und geht getheilt mit
ungefaͤhr 1/2 Schuh Steigung und in 2 Eken sich wendend, oberhalb des
Schuͤrloches in den Rauchfang.
Diese noch unvollkommene Einrichtung, welche wegen Mangel an Zeit oder weiterer
Erfahrung nicht anders gemacht werden konnte, ist durch die Abbildungen
veranschaulicht.
Nicht bloß im Dekel des Ofens, sondern auch an den Seitenwaͤnden desselben muß
der Ofen erhizt und eine dreifache Feuerung hervorgebracht werden.
Der Ofen ist von Gußeisen, 4 Schuh lang, 1 Fuß hoch und 1 Fuß weit. Die Platten sind
1/4 bis 3/8 Zoll dik.
Bei groͤßerem Doͤrrraum muß der Ofen auch groͤßer gemacht
werden. Das Ofenthuͤrlein wird nur 8 Zoll hoch. Unter der Stelle wo das Holz
brennt, ist ein Rost wo der Aschenraum vom Boden bis an den Rost mit Mauerziegeln
konisch aufgefuͤhrt wird, doch darf der Rost nur 3/4 Theile so lang seyn, als
der Feuerraum fuͤr das Holz oder fuͤr den Torf groß ist. Der Luftkanal
zu jeder von den 3 Seiten des Ofens muß von Thon (bloßem Ziegelthon und bloß
gedoͤrrt) in einem oder zwei Stuͤken gemacht und an den Ofenplatten so
befestigt werden, daß der Ofen im Ganzen, und jede Platte fuͤr sich durch die
Hize ausgedehnt und durch die Kaͤlte zusammengezogen werden kann, ohne die
Luftkanaͤle zu beschaͤdigen.
Der Rauchkanal darf nicht von Kacheln seyn, welche zu viel Ruß, Pech und Asche
absezen, sondern aus gutem Eisenblech gefertigt werden; derselbe muß in der
Darrkammer herumgefuͤhrt werden und in einem Kamin ausmuͤnden.
Vier Fuß uͤber dem Fußboden der Doͤrrkammer werden Staͤngelchen
auf Querbalken genagelt, welche den Flachs tragen. Zwei Gelaͤnder werden
angebracht, um den Flachs anzulehnen. Auf diesem Stangenrost gehen die beiden
Eingangsthuͤrlein in die Doͤrrkammer. Bei dem einen Eingang hat der
Rost ein Fallthuͤrlein oder Fallgatter, um in den unteren Raum zu
gelangen.
Dem Ofen gegenuͤber geht durch die Deke das Zugloch aus der
Doͤrrkammer, welches mit einer nicht zu leichten eisernen Klappe zu versehen
ist. –
Erklaͤrung der Abbildungen.
Fig. 1. Ist
die Ansicht der Oefen.
Fig. 2.
Querdurchschnitt und
Fig. 3.
Laͤngendurchschnitt derselben.
Fig. 4.
Grundriß der Brodbakoͤfen.
Fig. 5.
Zuͤge derselben.
Fig. 6. Ofen
zur Flachsdoͤrre.
Fig. 7.
Aeußere Ansicht des Gebaͤudes.
In obigen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben gleiche Gegenstaͤnde.
a, Bakoͤfen. b,
Zugloͤcher der Bakoͤfen, mittelst welcher beim Baken die Hize in den
Flachsdoͤrrofen geleitet wird. c, Rost zum
Flachsdoͤrrofen, d, Ofen, durch welchen der
Flachs gedoͤrrt wird. a, Plaz, woselbst der
Flachs aufgestellt wird. f, Eingangsthuͤren zum
Aufstellen des Flachses. g, Zug zur frischen Luft, die
erhizt durch den Flachs geht und die Daͤmpft vertreibt. h, Abzugsoͤffnung der Daͤmpfe. i, Rauchoͤffnung vom Darrofen.
Einige Bemerkungen beim Flachsdoͤrren.
Beim Flachsdoͤrren ist Folgendes zu beobachten.
Der Flachs wird in der Kammer auf den Rost gebracht, daselbst aufgebunden, und auf
die Spizen ganz loker, fast senkrecht, an die Gelaͤnder gelehnt.
Wuͤrde man denselben auf die Wurzeln stellen, so wuͤrde er ungleich
doͤrren.
Das Feuer muß man schon des eisernen Ofens wegen Anfangs ganz schwach unterhalten,
und erst dann muß staͤrker geschuͤrt werden, wenn der Ofen ganz
durchwaͤrmt ist. Die Klappe in der Deke muß so lange offen gelassen werden,
bis der Flachs aufhoͤrt zu schwizen und das Feuern noͤthig ist. Erst
wenn man aufhoͤrt zu feuern wird die Klappe geschlossen.
Es kann waͤhrend des Brechens selbst mit geringem Aufwand von Brennstoff der
leer werdende Raum durch neue Beschikung von Flachs benuzt werden.
Von der dießjaͤhrigen Ernte, welche troken war, wurde der Flachs
fruͤhestens in 3, spaͤtestens in 5 Stunden im ganzen Ofen
brechbar.
Das Meiste was in einem Male gedoͤrrt wurde, waren 33 Buͤschel mit
doppelter Strohlaͤnge von hiesigem Roggenstroh gebunden, das nicht allzulang
ist.
Vom Bakofen.
Da im Bakofen besonders nach Oben Waͤrme ausstroͤmt, so ist es gut,
einen solchen unterhalb der Doͤrrkammer anzubringen.
Der hier beschriebene Bakofen weicht von den gewoͤhnlichen Hausbakoͤfen
dadurch ab,
1) daß er ein 8 Zoll hohes und 1 1/2 Fuß weites Mundloch hat,
welches durch einen Schieber, der sich nach Oben schiebt, gut verschlossen
ist;
2) daß neben dem Mundloch ein kleines Loch zur Unterhaltung eines
Leuchtfeuers befindlich ist, um den Ofen waͤhrend der Arbeit mit dem
Brode zu erhellen;
3) daß das Gewoͤlbe des Ofens moͤglichst flach, und
nicht uͤber 14 Zoll an der hoͤchsten Stelle hoch ist. Die
Woͤlbung faͤngt 5 Zoll oberhalb des Herdes an, so daß die
Seitenwaͤnde noch 5 Zoll senkrechte Hoͤhe haben;
4) steigt der Herd von Vorne nach Hinten 1 1/2 Zoll
aufwaͤrts. Vier Zugloͤcher werden ganz hinten im Ofen angelegt und
gehen uͤber der Deke desselben mit 2 Zoll Steigung auf den Fuß gegen den
Schornstein, wo sie mit gut schließenden Schiebern beliebig geoͤffnet und
verschlossen werden. Schieber sind besser, als die bei den Baͤkern
gewoͤhnlichen Dippel.
Bei der Anlage ist besonders zu beobachten:
1) daß unter dem Herde alle Feuchtigkeit abgeleitet werde.
2) Unter dem Herde darf kein feuchter Schutt, auch kein Sand,
aufgeschuͤttet werden, weil dieser die Waͤrme zu sehr ableitet. Am
besten nimmt man ganz trokenen Lehm, oder ein Geroͤll von Thonschiefer,
das recht viel Zwischenraͤume von Luft gibt, oder Schlaken, besonders
recht trokenes Kohlenloͤsch. Nur ein wenig feiner Sand ist zum Legen der
Herdziegel anzuwenden.
3) Die Seitenwaͤnde des Ofens soll man nicht unmittelbar
der atmosphaͤrischen Luft aussezen, sondern sie durch einen
verschlossenen Luftraum von den Außenwaͤnden des Gebaͤudes
trennen.
4) Weder der Herd noch die Dekenziegeln duͤrfen stark
gebrannt seyn.
5) Auf der Deke des Ofens wird der Zwischenraum zwischen den 4
Zuͤgen nicht ausgefuͤllt, sondern nur bedekt, weil der luftleere
Raum die Waͤrme haͤlt.
6) Wenn unter dem Herde 2 eiserne Anker (Schaudern) quer durch
den Ofen kommen, daß es nicht noͤthig ist, daß man das
Ofengewoͤlbe kuppelfoͤrmig fuͤhrt, sondern es kann als ein flach
gedruͤktes Tennengewoͤlb aufgesezt werden.Der vorstehend beschriebene Flachsdarrofen besteht in der Hauptsache im
Darren des Flachses mittelst erhizter Luft. Die Beschreibung ist zwar
nicht ganz deutlich, indeß finden sich Sachkenner leicht daraus. Gin
solcher ist in der Naͤhe bei Wunsiedel aufgefuͤhrt, und
soll hauptsaͤchlich zum Darren von ungerottetem Flachse dienen.
In wie ferne er sich hiezu ganz eignet, muß die Erfahrung lehren. Zum
Darren von gerottetem Flachs verdient eine solche Darranstalt in Bezug
auf Beseitigung von Feuersgefahr, besondere Empfehlung. Lezteres gilt
auch von dem Brodbakofen, als Gemeindegut, weil von einem guten Bakofen
zum Theil auch die Gewinnung eines gesunden Brods abhaͤngt. A. d.
R.
Tafeln