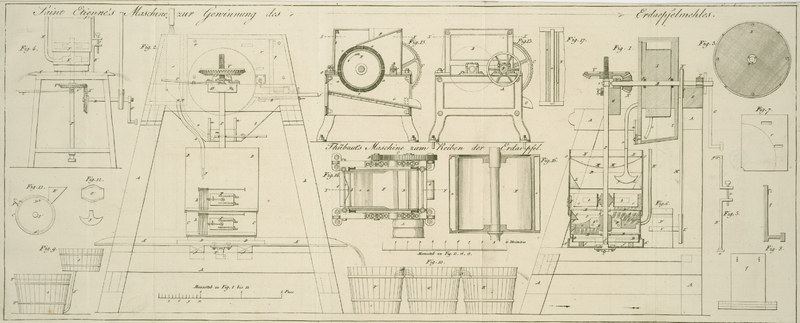| Titel: | Beschreibung eines Apparates zur Gewinnung des Erdäpfelmehles. Von. Hrn. Saint-Etienne. |
| Fundstelle: | Band 41, Jahrgang 1831, Nr. XXXII., S. 118 |
| Download: | XML |
XXXII.
Beschreibung eines Apparates zur Gewinnung des
Erdaͤpfelmehles. Von. Hrn. Saint-Etienne.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement, 1831. Fevrier S. 120.
Mit Abbildung auf Tab.
III.
Saint-Etienne, Beschreibung eines Apparates zur Gewinnung
des Erdaͤpfelmehles.
Dieser Apparat verrichtet drei verschiedene Arbeiten: 1) das Zerreiben des Erdapfels
oder die Verwandlung desselben in einen Brei; 2) das Sieben oder Auswaschen des
Breies, um das Sazmehl von feinem Parenchyme zu trennen; und 3) ein zweites
Zerreiben des Parenchymes, um dasselbe bei seinem Austritte aus dem mechanischen
Siebe zu puͤlvern, damit alles Sazmehl aus demselben ausgezogen werden
kann.
Die Vereinigung dieser drei Arbeiten in einem einzigen Apparate hat den Vortheil, daß
dadurch an Handarbeit, an Ausgaben und an Raum bedeutend erspart wird, und daß die
Operationen selbst abgekuͤrzt werden, was um so wichtiger ist, als der
Erdapfelbrei durch laͤngeres Verweilen an der Luft braun wird, und dann diese
Farbe auch dem Sazmehle mittheilt.
Der Apparat, welcher in Fig. 1 und 2. Taf. III. im
senkrechten Durchschnitte und im Aufrisse, von Vorn gesehen, dargestellt ist, ruht
auf einem festen und gehoͤrig altgebrachten Gestelle AA. Er besteht aus drei Faͤchern oder
cylindrischen, hohlen metallenen Stuͤken, welche zusammen ein mechanisches
Sieb, Waͤscher oder Sieber (laveur ou tamiseur) genannt, und zwei
verbesserte mechanische Siebe bilden.
Das erste dieser Siebe dient zur Scheidung des Sazmehles von seinem Parenchyme, d.h.
Zum Auswaschen und Sieben des Breies; das zweite und dritte sind dazu bestimmt, das
seine Parenchym und alle Unreinigkeiten abzuscheiden, welche dem oberen Siebe
entschluͤpft seyn konnten.
Die drei hohlen Cylinder, aus welchen das neue Sieb zusammengesezt ist, bestehen: 1)
aus einem Ringe aus geschmiedetem Eisen, auf welchen ein Haar- oder anderes
Sieb E gestellt wird, welches das feine Parenchym
zuruͤkhalten soll; 2) aus einem zweiten Ringe oder hohlen Cylinder C, auf welchen das Tuch des oberen Siebes kommt; und 3)
aus einem dritten Cylinder B von der Form des zweiten.
Diese drei uͤber einander gestellten und in einander gefuͤgten
Cylinder bilden den Koͤrper des mechanischen Siebes. Man kann noch eine
groͤßere Zahl derselben anbringen, und feinere Gewebe anwenden, wenn man ein
noch reineres Sazmehl erhalten will; allein je zahlreicher und enger diese Gewebe seyn werden, um so
langsamer wird nothwendig die Arbeit gehen.
Zwei Oeffnungen, welche in den Cylindern BC
angebracht sind, und die durch die eisernen, mit Leder gefutterten, Thuͤrchen
FF verschlossen werden, gestatten dem
Parenchyme oder Marke einen Ausweg.
Die Metallgewebe wuͤrden, wenn sie nicht so theuer waͤren, wegen der
Regelmaͤßigkeit ihres Gewebes zur Benuͤzung bei den Sieben den Vorzug
verdienen; der Erfinder wendete neuerlich einen eigenen Zeug aus Haaren, Crinoline genannt, bei seinen Sieben an, und fand, daß
derselbe nicht bloß in Hinsicht auf Dauerhaftigkeit, sondern auch in Hinsicht auf
Wohlfeilheit, allen bisher angewendeten Zeugen vorzuziehen ist.
Die Luftroͤhre H dient dazu, der Luft Ausgang zu
verschaffen, die comprimirt wird, wenn der Raum zwischen den beiden Sieben mit
Fluͤssigkeit angefuͤllt ist.
Der Brei und das Wasser erhalten, wenn sie in das Sieb gebracht sind, darin wohl eine
schnelle kreisfoͤrmige Bewegung; allein, wenn die Fluͤssigkeit durch
die Centrifugalkraft der Agitatoren ein wenig zu stark bewegt wird, so dringt sie
gegen die innere Wand des Siebes und verbreitet sich nach Außen. Um diesen
Uebelstand zu vermeiden, ersann der Erfinder die Stuͤke LL, welche er Ablenker
(déviateurs) nennt; diese brechen die
kreisfoͤrmige Stroͤmung der Fluͤssigkeit, und bringen den Brei
bestaͤndig wieder in die Mitte des Siebes zuruͤk. Ist nun die ganze
Oberflaͤche des Tuches bedekt, so durchdringt das Wasser, welches wie ein
Regen darauf faͤllt, dasselbe, und reißt das Sazmehl mit sich durch das
Gewebe. Damit das Sazmehl sich von dem Gewebe abloͤse, muß man dasselbe sehr
stark erschuͤttern; diese Erschuͤtterungen werden nun hervorgebracht,
wenn der durch die Agitatoren in kreisfoͤrmige Bewegung gesezte Brei gegen
die Ablenker schlaͤgt.
Der Halskragen M, der aus Leder oder aus
gewoͤhnlichem Zeuge besteht, hat gleichen Durchmesser mit dem Siebe; in
seinem Mittelpunkte befindet sich eine Oeffnung, durch welche der Brei und das
Wasser, das zum Auswaschen desselben dient, gehen; er hat an seinem Umfange eine
Randleiste oder einen Umschlag N, durch welchen er in
der Hoͤhe gehalten wird. Der Kreis O des
Halskragens paßt in den Cylinder des oberen Siebes B,
und ruht, 2–3 Zoll vom Rande entfernt, auf kleinen Stuͤzen, die an der
inneren Wand des Cylinders angebracht sind. Dieser Kreis wird so in seiner Stellung
befestigt, daß der Halskragen durch die Gewalt der Stroͤmung der
Fluͤssigkeit nicht von seinem Plaze entfernt werden kann.
Die Buͤchse Q, Fig. 3., welche dazu
dient, das Gewebe des Siebes im Mittelpunkte, durch welchen der senkrechte Wellbaum P geht, festzuhalten, besieht aus zwei Scheiben, von
denen die eine aus Kupfer, die andere aus Eisen verfertigt ist. Diese Stuͤke,
welche an allen ihren Flaͤchen auf der Drehbank abgedreht seyn
muͤssen, muͤssen vollkommen an einander passen; sie werden durch
Schrauben aufeinander festgehalten.
Das mechanische Sieb wird, nachdem es mit allen den so eben beschriebenen
Stuͤken versehen ist, auf den Behaͤlter A'A'
Fig. 2.
gebracht, welcher auf vier Lagerhoͤlzern ff
steht. Dieser Behaͤlter nimmt das Wasser aus dem Siebe auf, und bringt es in
die Gefaͤße, Fig. 9 und 10., in welchen sich das
Sazmehl absezt. Er ruht auf zwei hoͤlzernen Stuͤzen, die mit zwei
Falzen versehen sind, welche die Fuͤße a der vier
mit Schrauben versehenen Spannungsklammern, B' Fig. 5.
aufnehmen, die zur Spannung der Gewebe und zur Befestigung der Siebe dienen, und die
sich mit einem kleinen Winkelhaken g enden. In der
Mitte des Behaͤlters befindet sich eine Regulirschraube T, auf welcher der senkrechte Wellbaum ruht und sich
dreht; diese Schraube dient auch dazu um die beiden Winkelraͤder, V und X mit einander in
Verbindung zu sezen.
Die Agitatoren, welche in Fig. 1 und 4. mit JK und jk
bezeichnet sind, werden durch den senkrechten Wellbaum P, der durch dieselben laͤuft, in Bewegung gesezt. Sie bestehen aus
einer Huͤlse JK, mit metallenen Schaufeln,
bb; an dieser Huͤlse bringt man einen
dreiekigen Zapfen an, der in einer Vertiefung des Wellbaumes P gleitet. Die Schaufeln sind durch die beweglichen, aus Holz oder Metall
bestehenden, mit Buͤrsten besezten, Fluͤgel cc verlaͤngert. Die Bestimmung dieser
Agitatoren ist: 1) den Brei stark gegen die Ablenker L
zu schlagen, um durch die kreisfoͤrmige und bestaͤndige Bewegung alles
Sazmehl abzuscheiden, welches noch in demselben enthalten ist; denn wenn der Brei
auf diese Weise nach allen Richtungen umgekehrt wird, so bietet er alle seine
Oberflaͤchen der Wirkung des Wassers, welches darauf faͤllt, dar; 2)
durch eine leichte Reibung ihrer Fluͤgel auf der Oberflaͤche des
Tuches E, den Durchgang des Wassers mit dem Sazmehle
durch das Gewebe zu beguͤnstigen; und 3) endlich, das Parenchym, nachdem es
all sein Sazmehl abgegeben, durch die Thuͤren F,
aus dem Inneren des Siebes hinauszuschaffen. Die Zahl dieser Agitatoren wechselt von
Einem bis zu dreien, der erste befindet sich uͤber dem Tuche des oberen
Siebes B, der zweite auf jenem des Siebes C, und so fort, wenn noch mehrere Siebe vorhanden sind.
Diese Agitatoren tragen auch eine umgekehrte Buͤrste d, um auch von Unten das Tuch des oberen Siebes zu reinigen.
Der senkrechte Wellbaum P, Fig. 1., wird direct durch
die Achse
R der Reibe in Bewegung gesezt; er endigt sich in die
gestaͤhlte Spize S, die sich in einer Pfanne der
Regulirschraube T dreht. Soll der Wellbaum in einem
mechanischen Armsiebe ohne Reibe (siehe Fig. 4.) arbeiten, so wird
unter dem Behaͤlter A''A'' das wagerechte
Winkelrad V' angebracht, welches durch ein anderes
Winkelrad X' getrieben wird; dieses leztere befindet
sich an einem liegenden Wellbaums R', der durch eine
Kurbel g', in Bewegung gesezt wird.
Zwischen dem wagerechten Rade V und der Unterlage Y ist an dem senkrechten Wellbaume P ein rollenfoͤrmiger Ring i angebracht, der die Gabel des Aushebhebels U
aufnimmt.
Der Vorhang h, Fig. 2., welcher aus Leder
oder starkem Zeuge gemacht ist, wird vor den Thuͤren des Siebes angebracht,
damit der beim Siebe beschaͤftigte Arbeiter nicht ganz mit Mark besprizt
wird, wenn dieses schnell aus dem Siebe herauskommt.
Fig. 1. zeigt
in I einen Cylinder oder eine Reibe aus Ulmenholz, die
sich auf ihren Zapfen YY dreht, und welche
zwischen zwei starken Schraubenmuͤttern pp
festgehalten wird, mittelst welcher sie gerade an jener Stelle befestigt werden
kann, an welcher sie arbeiten soll. Auf der Oberflaͤche dieses Cylinders und
an seinem ganzen Umfange sind Furchen angebracht, die zur Aufnahme von
Saͤgeblaͤttern aus Gußstahl bestimmt sind. Diese
Saͤgeblaͤtter koͤnnen sehr leicht eingesezt und wieder
herausgenommen werden, ohne daß sie jedoch von selbst, durch die drehende Bewegung
allein, aus ihrer Stelle gerathen koͤnnten.
Hr. Saint-Etienne bringt
zwischen dem Reiber und den Seiten des Kastens t, Fig. 2., gut
zugerichtete eiserne Platten r. Fig. 7., an. Dadurch
kommen die Enden des Reibers sehr nahe an die beiden Stuͤke, und die Platten
koͤnnen die ganze Laͤnge des Cylinders beherrschen, ohne irgend etwas
zu schaden. Diese Platten verursachen, da sie nicht anschwellen koͤnnen, gar
keine Reibung und verhindern allen Verlust.
Der bewegliche Schieber g
Fig. 8.,
welcher aus Holz oder Eisen besteht, ist oben an eine Eisenstange befestigt, welche
die Entfernung des Kastens unterhaͤlt. Er naͤhert sich den
Zaͤhnen der Reibe bis auf einige Linien, und wird durch ein Gewicht in dieser
Lage erhalten, welches an dem Ende einer Schraube, die die gewoͤhnlichen
Federn ersezt, angebracht ist. Er nimmt die ganze Laͤnge des Cylinders ein,
und muß immer vollkommen frei in seinen Bewegungen seyn.
Das hoͤlzerne Verbindungs- oder Beruͤhrungsstuͤk j, Fig. 2., ist an dem
Querriegel des Gemaͤuers A befestigt, und nimmt
den Raum zwischen den Bogen oder dem Halse der Reibe ein; man kann dasselbe, wenn
man darauf schlaͤgt, nach Belieben gegen die Zaͤhne der Reibe treiben,
welcher leztern es immer sehr nahe stehen muß, wenn das Zerreiben vollkommen werden soll. Um
dieses Verbindungsstuͤk ohne Schlag den Zaͤhnen der Reibe so viel als
moͤglich zu naͤhern, wurde eine Schraubenmutter unter demselben
angebracht, welche die Schraube k aufnimmt.
An dem vorderen Theile des Kastens l, Fig. 2., welcher den Brei
aufnimmt, ist eine Oeffnung angebracht, die durch ein kleines Schuzbrett, m, zum Theile geschlossen wird; dieses Schuzbrett wird
von Tragleisten, nn, gehalten, und kann durch den
Hebel o aufgezogen werden, um dem Breie Ausgang zu
gestatten, wenn man denselben in das mechanische Sieb B
bringen will.
Fig. 2.,
welcher sich hinter der Reibe und in der Hoͤhe derselben befindet, muß gerade
so viel Wasser enthalten, als zum Auswaschen einer bestimmten Menge Breies
erforderlich ist. An dem Boden dieses Behaͤlters befinden sich zwei Klappen,
uu, durch welche das Wasser ausfließt; ein
Theil desselben begibt sich durch die Roͤhre v
auf den Grund des Kastens, um daselbst den Brei schneller herauskommen zu machen;
der andere Theil faͤllt durch die Roͤhre x, welche sich in das faͤcherfoͤrmige Stuͤk y endigt, direct auf das Sieb. Dieser
Wasserbehaͤlter s wird selbst wieder durch einen
groͤßeren und hoͤher angebrachten Behaͤlter gespeist. (Siehe
die Roͤhre z, Fig. 2.).
Die Reibe, welche zum Zermalmen des Parenchymes dient, Fig. 11., hat die Form
einer runden Buͤchse, und besteht aus zwei Scheiben aus Gußeisen C'C', welche mittelst Schrauben an einem Ringe von
demselben Durchmesser befestigt sind. In dieser Buͤchse befindet sich ein
gefurchter Cylinder oder eine Reibe D', die mit sehr
fein gezahnten Stahlblaͤttern bewaffnet ist. Die Achse l' dieses Cylinders geht durch die beiden Boͤden oder Platten, und
diese dienen derselben als Pfannen. Das eine Ende der Achse traͤgt eine Rolle
L', uͤber welche der Riemen M' laͤuft, der mit der Rolle N', die an dem Wellbaume P
der Reibe R angebracht ist, in Verbindung steht.
Die Parenchymreibe hat drei Oeffnungen: in E', F' und G', Fig. 11. Die Oeffnung E', auf welcher ein kleiner Trichter angebracht ist,
nimmt das Parenchym bei seinem Austritte aus dem Siebe auf. Jene bei F' dient zum Ausspuͤlen, und gestattet auch dem
Parenchyme einen Abzug, wenn dieses in zu großer Menge auf die Reibe faͤllt;
hat dieses Parenchym jedoch hier eine bestimmte Hoͤhe erreicht, so geht es
uͤber und faͤllt in den Trichter E'
zuruͤk, aus welchem es neuerdings und wiederholt auf die Reibe gelangt. Nach
einigen Sekunden ist das Parenchym vollkommen zerkleinert; man laͤßt es dann
bei der unteren Oeffnung G' heraus, und schließt diese
darauf, um die Operation wieder von Neuem zu beginnen. Um die Zerkleinerung des Parenchymes zu
erleichtern, muß man einen kleinen Strahl Wasser in den Trichter E' fließen lassen.
Das Parenchym von einem Sester oder Mezen Erdaͤpfel kann noch 1–2
Kilogr. Sazmehl geben.
Der bewegliche metallene Ueberlaͤufer O', Fig. 12., wird
in die Einschnitte gebracht, welche sich an den Beruͤhrungspunkten der beiden
Behaͤlter Q'Q' befinden. Er dient dazu, daß
die Fluͤssigkeiten von einem Gefaͤße in das andere uͤberfließen
koͤnnen, ohne daß etwas von demselben verloren geht.
Das Verfahren, welches der Erfinder befolgt, um zu bewirken, daß sich das Sazmehl
schneller und unter Anwendung einer geringeren Zahl von Gefaͤßen zu Boden
sezt, besteht darin, daß er das, mit Sazmehl beladene. Wasser bei seinem Austritte
aus dem Siebe in ein Gefaͤß N. 1., Fig. 9., fallen
laͤßt, welches an seinem Boden mit einer Roͤhre S', die in das Gefaͤß N. 2.
fuͤhrt, versehen ist. Da das Sazmehl durch seine eigene Schwere gegen den
Boden trachtet, so kann man das Niederfallen desselben dadurch beschleunigen, daß
man ein oder mehrere Gewebe aus Metall, Haar, Seide oder Canevaß als Hinderniß gegen
das Aufsteigen anbringt; diese, in einem eisernen Reifen gehaltenen, Gewebe werden
bei T'U' befestigt.
Mit dieser, so eben beschriebenen, Maschine kann man, wenn dieselbe durch eine
anhaltende und zwei Pferden gleich kommende Kraft in Bewegung gesezt wird, in Einer
Stunde gleichzeitig oder einzeln 12–1500 Kilogrammen Erdapfel zermalmen und
sieben; die, Maschine arbeitet so viel, als zehn mit Sieben beschaͤftigte
Arbeiter, und gibt, verglichen mit den fruͤher gebraͤuchlichen
Methoden, einen Mehrertrag von 2 bis 3 p. C.
Man wirft die Erdaͤpfel, nachdem sie vorher gut abgewaschen worden, in den
Trichter Fig.
2. Die Reibe verwandelt dieselben in Brei, der sich auf dem Boden des
Kastens l, in einer Quantitaͤt von 2, 3 oder 4 Eimer anhaͤuft. Dann
wird, indem man auf den Hebel o druͤkt, das
Schuzbrett m geoͤffnet, und folglich durch die
Roͤhre v, 1 oder 2 Eimer Wasser aus dem
Wasserbehaͤlter eingelassen, damit der Austritt des Breies in das Sieb BB schneller vor sich gehe. Das in dem
Behaͤlter noch zuruͤkgebliebene Wasser laͤßt man darauf durch
den faͤcherfoͤrmigen Leiter x in das Sieb
laufen. Ist alles Wasser aus dem Behaͤlter ausgelaufen, so oͤffnet man
die Thuͤre F des oberen Siebes, um das Parenchym
herauszulassen, welches in demselben auf seinem Gewebe BB zuruͤkblieb. Ist diese Thuͤre wieder geschlossen, so
verfaͤhrt man auf gleiche Weise mit dem unteren Siebe, aus welchem man
gleichfalls das zuruͤkgebliebene Parenchym auslaͤßt. Das grobe und
feine Parenchym kommt, wenn es aus den Sieben BC tritt, in den
kleinen Trichter E' der Parenchymreibe, Fig. 11., um dort eine
vollkommene Zerkleinerung zu erleiden. Sind alle Thuͤren des mechanischen
Siebes wieder geschlossen, so beladet man die Maschine neuerdings, und faͤhrt
auf die angegebene Weise mit der Arbeit fort. Das Wasser, welches zum Abwaschen und
Sieben des Breies gedient hat, und in welchem das Sazmehl enthalten ist, gelangt aus
dem Behaͤlter A'A' in das Gefaͤß P', Fig. 10., oder in die
Gefaͤße 1, 2 Fig. 9., in welchen sich das Sazmehl absezt. Dieser Bodensaz bildet sich
in den Gefaͤßen von Fig. 9. wegen des Gewebes
T'U' schneller, als in jenen von Fig. 10.; allein das
Wasser laͤuft mittelst des metallenen, beweglichen Ueberlaͤufers
bestaͤndig von einem Gefaͤße in das andere. Das Wasser darf, wenn es
aus der lezten Kufe kommt, gar kein Sazmehl mehr enthalten.
Erklaͤrung der Figuren auf Taf. III.
Fig. 1.
Senkrechter Durchschnitt der Maschine zum Zermalmen und Sieben der Erdapfel zum
Behufe der Sazmehlgewinnung, mit allen ihren einzelnen Theilen.
Fig. 2. Aufriß
derselben von Vorn.
Fig. 3 Das
Sieb im Grundriß.
Fig. 4.
Durchschnitt eines mechanischen Siebes ohne Reiber, welches mit den Armen bewegt
wird.
Fig. 5.
Spannungsklammer.
Fig. 6.
Einrichtung der Parenchymreibe in Verbindung mit dem Zermalm- und
Siebapparate.
Fig. 7.
Gewoͤlbte Platte aus Gußeisen, welche einen Theil der Reibe umgibt.
Fig. 8.
Beweglicher Schieber von Vorn und von der Seite.
Fig. 9 und
10.
Behaͤlter, in welche das mit Starkmehl beladene Wasser gelangt.
Fig. 11. Die
Parenchymreibe fuͤr sich allein.
Fig. 12.
Metallenes Stuͤk, welches auf die Behaͤlter 10 gebracht, und Ueberlaͤufer genannt wird.
Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren auch dieselben
Gegenstaͤnde.
AA, Gestell, auf welchem der ganze Apparat
ruht.
BB, Oberer eiserner Cylinder, der das erste Sieb
enthaͤlt.
CC, Unterer Cylinder, in welchem sich das zweite
und dritte Sieb befindet.
DD, Ring aus geschmiedetem Eisen, in den der
Cylinder C eingefuͤgt wird.
E, Haarsieb.
F, Thuͤren, mit Leder gefuͤttert, zum
Austritte des Parenchymes.
G, Kurbel, mit welcher die Reibe und die Agitatoren
gedreht werden.
H, Luftroͤhre fuͤr den Austritt der
zwischen den beiden unteren Sieben enthaltenen Luft.
I, Reibe mit Saͤgeblaͤttern, welche sich
uͤber dem Siebapparate befindet.
J, Huͤlse, welche an dem Wellbaume P angebracht ist, und die oberen Agitatoren
traͤgt.
K, Huͤlse, die den unteren Agitator
traͤgt.
LL, Stuͤke, welche die kreisfoͤrmige
Stroͤmung der Fluͤssigkeit brechen, und Ablenker genannt werden.
M, Halskragen aus Leder oder Zeug, auf den der Brei bei
seinem Austritte aus dem Zermalmapparate faͤllt.
N, Ring des Halskragens.
O, Umschlag, welcher den Halskragen
zuruͤkhaͤlt, und ihn am Ausgleiten hindert.
P, Senkrechter Wellbaum, an dem die Agitatoren befestigt
sind.
Q, Kupferne Buͤchse, in der Mitte des Siebes E, durch die der Wellbaum P
geht.
R, Wellbaum, der die Reibe traͤgt.
S, Zapfen des Wellbaumes P.
T, Regulirschraube unter dem Wellbaume P, welche ein Pfanne hat, in der sich der Zapfen S dreht.
U, Aushebhebel.
V, Großes, horizontales Winkelrad, an dem Wellbaume P angebracht.
X, Winkeltriebrad an dem Wellbaume R, welches das vorhergehende Rad bewegt.
YY, Zapfen des Wellbaumes R.
Z, Anwellen der Zapfen YY.
A'A', Trog, in welchen das mit Sazmehl beladene Wasser
faͤllt.
B', Spannungsklammer.
C', Platten, zwischen welchen sich die Parenchymreibe
befindet.
D', Parenchymreibe.
E', Trichter derselben.
F', Roͤhre fuͤr den Durchgang des
Ueberlaͤufers.
G', Kurbel des kleinen Siebapparates.
H', Luftroͤhre desselben.
I', Achse der Parenchymreibe.
J'K', Agitatoren des kleinen Apparates.
L', Rolle an der Achse I'
der Parenchymreibe.
M', Riemen, der uͤber die Rolle und uͤber
jene N am Wellbaume R
laͤuft.
O', Metallenes Stuͤk, Ueberlaͤufer
genannt.
P', Q', R', Kufen, in welche das Wasser mit dem Sazmehle
gelangt.
S', Roͤhre, welche die obere Kufe 1, Fig. 9., mit
der unteren Kufe 2 in Verbindung sezt.
T', U' Siebe in dieser lezteren Kufe.
a, Fuß der Spannungsklammer, Fig. 5.
b, Metallene Schaufeln der Agitatoren.
c, Bewegliche, mit Buͤrsten besezte
Fluͤgel, die an den Schaufeln b angebracht
sind.
d, Umgekehrte Buͤrste zum Reinigen des Siebes E von Unten.
e, Spannungsschraube.
ff, Lagerhoͤlzer des Troges A'A'. g, Haken der Spannungsklammer. h, Lederne Vorhange vor den Thuͤren FF.
i, Ring, der den Aushebhebel aufnimmt.
j, Verbindungsstuͤk.
k, Schraube dieses Stuͤkes.
l, Kasten, der den Brei aufnimmt.
m, Schuzbrett.
nn. Tragleisten, in welchen sich dieses auf und ab
bewegt.
o, Hebel zum Oeffnen und Schließen des Schuzbrettes.
pp, Schraubenmutter um die Reibe I anzuziehen.
q, Beweglicher Schieber aus Holz.
r, Gewoͤlbtes Stuͤk aus Metall, welches
die Reibe umgibt.
s, Wasserbehaͤlter.
t, Kasten, in welchem sich die Reibe dreht.
uu, Klappen des Behaͤlters s.
v, Roͤhre, welche das Wasser leitet, das den Brei
auf das Sieb treibt.
x, Roͤhre, welche Wasser auf das Sieb gießt.
y, Faͤcherfoͤrmiges Ende dieser
Roͤhre.
z, Roͤhre, welche zu einem hoͤheren
Behaͤlter gehoͤrt.
Anhang.
Hr. Mallet erstattete im Namen
einer Specialkommission, die aus den HHrn. Bouriat, Labarraque, Francoeur und Vallot bestand, der Société d'encouragement einen sehr vortheilhaften Bericht
uͤber den Apparat des Hrn. St.
Etienne, der in dem Februarhefte des Bulletin
de la Société d'encouragement S. 116. abgedrukt ist. Wir
geben hier, mit Hinweisung auf das, was bereits im XXXVIII. Bande des polyt.
Journales S. 450. uͤber diesen
Apparat gesagt wurde, folgenden kurzen Auszug aus diesem Bericht. Hr. Saint-Etienne verfertigt
seine Apparate (an welchen eigentlich die mechanischen Siebe seine Erfindung sind,
da die Reibe dieselbe, wie die von Burette angegebene
ist) von zwei verschiedenen Groͤßen. An jenen erster Groͤße hat die
Reibe 65 Centimeter im Durchmesser, und 22 1/2 Centimeter in der Laͤnge; die
Hoͤhe des Siebes betraͤgt 65, sein Durchmesser 54 Centim. An den
Apparaten zweiter Groͤße sind diese Verhaͤltnisse wie 49 zu 25 und wie
64 zu 49 Centimeter. Die Preise der verschiedenen Apparate des Hrn. Saint-Etienne (der rue de la Colombe. N. 4., quartier de la Cité) wohnt, sind folgende:
Einfaches mechanisches Sieb, welches in
Einer Stundemit 4 Sester oder Mezen arbeitet
600 Fr.
Mechanisches Sieb mit zwei Faͤchern,
welches in EinerStunde mit 6 Sester arbeitet
1000 –
Reibe mit einem mechanischen Siebe zu zwei
Faͤchernvon zweiter Groͤße, und in Einer Stunde mit6
Sester arbeitend
1500 –
Reihe mit einem mechanischen Siebe zu zwei
Faͤchern,von erster Groͤße und mit einer Reibe
zumZerkleinen des Markes oder Parenchymes, in EinerStunde mit
8–10 Sester arbeitend
2000 –
Die Commission begab sich, um die Maschine arbeiten zu sehen, zwei Wal in die
Brauerei des Hrn. Houlette, wo
mit einer Maschine zweiter Groͤße Erdapfelstaͤrkmehl gewonnen wird.
Der Versuch, dem dieselbe am 7. Julius beiwohnte, begann um 10 Uhr 36 Minuten mit 8
Hectoliter Erdaͤpfel, von welchen ein jeder ungefaͤhr 65 Kilogrammen
wog. Um 8 Uhr 38 Minuten waren die zwei ersten Kilogramme zermalmt, und das Sieben
begann; diese leztere Operation war um 11 Uhr 14 Minuten beendigt, was 36 Minuten
fuͤr 8 maliges Sieben oder fuͤr das Sieben von 8 Hectoliter, jeden zu
65 Kilogrammen oder im Ganzen fuͤr 520 Kilogrammen gibt. Man kann also mit
diesem Apparate in einer Stunde 866 Kilogramme zerreiben und sieben, und da die
Zeit, waͤhrend welcher in einer Starkmehlfabrik gearbeitet wird, 10 Stunden
betraͤgt, so kann man die Fabrikation in einem Tage auf 8660 Kilogrammen (133
Hectoliter oder 61 1/2 Sester oder Mezen) bringen. Die zwei Werde, welche bei diesem
Versuche angespannt waren, schienen sehr ermuͤdet zu werden; allein die Art,
nach welcher dieselben angespannt waren, war auch aͤußerst schlecht und
fehlerhaft; auch mußten die beiden Pferde zugleich die Speisepumpe in Gang sezen.
Das Wasser wurde auf 24 Meter gehoben, und betrug 43 Liter in Einer Minute; dieß gibt, wenn man 800
Einheiten fuͤr die wirkliche Arbeit eines der Pferde waͤhrend 6
Stunden annimmt, die Haͤlfte der nuͤzlichen Arbeit eines Pferdes. Ein
Weib war damit beschaͤftigt die Erdaͤpfel in den Kasten zu werfen, und
ein einziger Mann leitete den Apparat. Aus den Beobachtungen mehrerer
Staͤrkmehlfaͤbrikanten, welche bei dem Versuche gegenwaͤrtig
waren, geht hervor, daß das Parenchym ganz ausgezogen oder erschoͤpft war.
Hr. Houlette, der den Winter
1829/30 uͤber mit diesem Apparate arbeitete, erklaͤrte, daß er,
waͤhrend seiner ganzen Arbeit, im Durchschnitte 25 Kilogrammen getroknetes
oder gebeuteltes Staͤrkmehl aus einem Sester oder Mezen von 140 bis 145
Kilogrammen, also 17 bis 18 p. C., erhielt, nach Abzug alles Verlustes auf dem
Speicher und beim Beuteln. Das Parenchym, welches man aus dem Apparate des Hrn.
Saint-Etienne
erhaͤlt, ist viel feiner, als jenes aus den gewoͤhnlichen Handsieben,
indem es mit weit groͤßerer Kraft herausgepeitscht wird; es wird daher feiner
zertheilt und dadurch mehr geeignet, das Sazmehl abzugeben. Ein anderer Vortheil des
Apparates des Hrn. Saint-Etienne besteht darin, daß er von Jedermann, ohne alle
vorhergegangene Uebung dirigirt werden kann; weder Hr. Houlette, noch seine Brauknechte, welche er dazu
braucht, arbeiteten vorher je damit. Es ergibt sich also aus den Untersuchungen der
Commission, daß durch diesen Apparat in einer Werkstaͤtte, in welcher 140 bis
150 Hectoliter verarbeitet werden, wenigstens die Arbeit von fuͤnf
Menschenhaͤnden erspart wird; daß die Producte desselben regelmaͤßiger
und schoͤner sind; daß die Arbeit viel leichter zu leiten und daß ein weit
kleinerer Raum fuͤr die Manipulation erforderlich ist, als dieß
fruͤher der Fall war. Die Commission schlaͤgt daher vor, dem Hrn.
Saint-Etienne
fuͤr seine Erfindung eine Medaille zu verleihen.
Tafeln