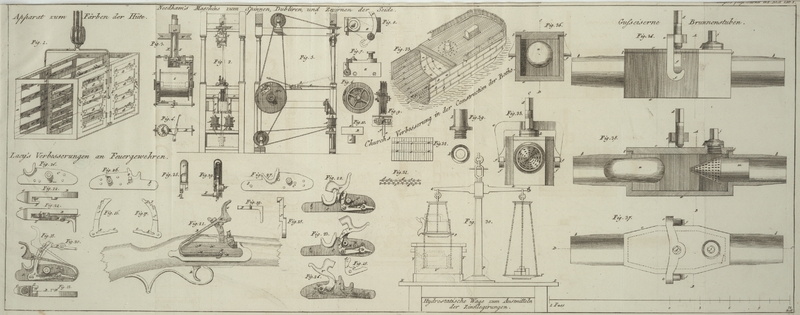| Titel: | Ueber gußeiserne Stuben für Wasserleitungen; von Hrn. Zuber-Karth. |
| Fundstelle: | Band 42, Jahrgang 1831, Nr. LXVII., S. 257 |
| Download: | XML |
LXVII.
Ueber gußeiserne Stuben fuͤr
Wasserleitungen; von Hrn. Zuber-Karth.
Aus dem Bulletin de la Société industrielle de
Mulhausen, N. 20. S. 541.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Zuber-Karth, uͤber gußeiserne Stuben fuͤr
Wasserleitungen
Wir verdanken dem Ingenieur Faesch zu Basel die
Mittheilung von gußeisernen Brunnenstuben, welche von ihm mit Erfolg bei den
Wasserleitungen der Stadt Basel angewandt wurden und die gegenwaͤrtig auch
bei den unseligen eingefuͤhrt sind.
Diese Stube besteht aus einer laͤnglichen Buͤchse a
Fig. 34, welche an jedem Ende in
eine kurze Roͤhre b ausgeht, die in die
Roͤhren der Wasserleitung eingelassen ist, leztere moͤgen nun aus
Gußeisen oder Holz verfertigt seyn. Ein Dekel c wird auf
dieser Buͤchse mittelst einer Drukschraube d und
eines eisernen Bandes e befestigt, welches sich in zwei
Haken f endigt, die durch Vorspruͤnge g, welche an den beiden Seiten der Buͤchse a angeschraubt sind, festgehalten werden. Der Dekel ist
außerdem mit einer Oeffnung h von ungefaͤhr 1
Zoll Durchmesser versehen, welche die Gestalt einer Tubulatur hat und mit einem
Schraubenpfropf j verschlossen wird; man kann auf diese
Tubulatur eine messingene Roͤhre k schrauben, um
noͤtigenfalls dem Wasser in der Leitung einen Ausgang zu verschaffen. Wenn
man zwischen den Dekel und die Buͤchse ein Stuͤk Filz I oder Leder, mit Talg getraͤnkt, bringt, so
schließt er hermetisch genug, um einen starken Druk des Wassers aushalten zu
koͤnnen. Endlich bringt man in das Innere der Buͤchse an der dem
Wasserstrome entgegengesezten Seite, einen hohlen, durchloͤcherten kupfernen
Kegel m an, welcher die Unreinigkeiten aller Art, die
das Wasser bis an diese Stelle mit sich fuͤhrt, zuruͤkhalten soll. Wir
haben diese Stuben in einer Entfernung von beilaͤufig 100 Meter (310 Fuß)
angebracht und koͤnnen versichern, daß sie fuͤr die Unterhaltung und
Beaufsichtigung der Wasserleitung außerordentlich nuͤzlich und bequem sind.
Zeigt sich ein Verlust, ohne daß man ihm auf die Spur kommen kann, so braucht man
nur die Wassermenge, welche bei jeder Stube geliefert wird, zu messen, um die beiden
Stuben, zwischen welchen der Verlust Statt findet, auszumitteln; zu diesem Ende
oͤffnet man die Stube und ersezt den hohlen kupfernen Kegel m durch einen massiven Pfropf n, welcher die ganze Oeffnung, durch welche das Wasser auslauft, gut
verschließt; man legt den Dekel auf die Buͤchse und schraubt auf die
Tubulatur eine gekruͤmmte Roͤhre, durch die alles Wasser, welches die
Leitung liefert, abgelenkt wird; man hat bei diesem Verfahren nur die
Vorsichtsmaßregel zu beobachten, daß man die Laͤnge der auf die
Buͤchse geschraubten Roͤhre nach dem Niveau, in welchem sich die
besagte Stube befindet, graduirt, so daß der Druk des Wassers bestaͤndig sich
gleich erhalten wird. Auf dieselbe Art verfaͤhrt man wenn eine Ausbesserung
nothwendig wird, d.h. an Statt in diesem Falle die ganze Leitung zu leeren, was ohne
diese Stuben geschehen muß, laͤßt man sie an der Stelle, welche dem Orte, wo
die Ausbesserung geschehen muß, zunaͤchst liegt, auslaufen, wodurch man den
Vortheil erlangt, daß man den ganzen Theil der Leitung, wo keine Ausbesserung
vorgenommen wird, in seinem gewoͤhnlichen Zustande von Druk erhalten kann;
dieser Vortheil ist hoͤchst schaͤzbar, besonders wenn der Druk des
Wassers stark ist, weil sich in diesem Falle unvermeidlich Luft in einigen Theilen der Leitung
ansammelt, so oft man sie leert und neuerdings fuͤllt, wodurch
gewoͤhnlich viel Schaden verursacht wird, weil jene Luft stark
zusammengedruͤkt ist und daher leicht Spruͤnge und Verlust entstehen.
Der Vortheil, daß man vermittelst der in jeder Stube angebrachten
durchloͤcherten Kegel, die in die Leitung gelangten, Unreinigkeiten aufhalten
kann, ist ebenfalls sehr schaͤzbar.
In den verschiedenen Figuren bezeichnen dieselben Buchstaben die naͤmlichen
Gegenstaͤnde.
Fig. 34,
Aufriß von Vorne.
Fig. 35,
Aufriß von der Seite.
Fig. 36,
Querdurchschnitt nach AB.
Fig. 37,
Horizontale Projection.
Fig. 38,
Laͤngendurchschnitt der Fig. 34, nach CD, wobei man den Pfropf n und den Kegel m ganz sieht.
Fig. 39,
Aufriß und Grundriß der messingenen Basis der Auslassungsroͤhre.
Tafeln