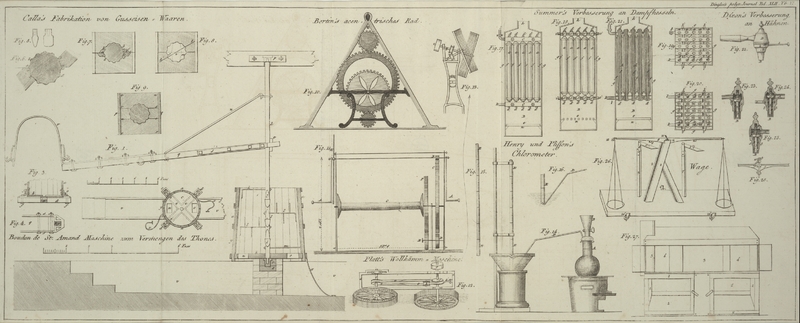| Titel: | Verbesserungen an der Maschine zum Kämmen der Wolle und anderer Faserstoffe, auf welche sich John Platt, Barchentweber zu Salford bei Manchester, Grafschaft Lancaster, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 10. Novbr. 1827 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 42, Jahrgang 1831, Nr. XCIX., S. 357 |
| Download: | XML |
XCIX.
Verbesserungen an der Maschine zum Kaͤmmen
der Wolle und anderer Faserstoffe, auf welche sich John Platt, Barchentweber zu Salford bei Manchester,
Grafschaft Lancaster, in Folge einer von einem Fremden erhaltenen Mittheilung, am 10. Novbr. 1827 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Mai 1831, S.
68.
Mit einer Abbildung auf Tab. VI.
Platt, Verbesserungen an der Maschine zum Kaͤmmen der
Wolle
Diese Maschine ist so eingerichtet, daß die Wolle mittelst zwei sich umdrehender,
kreisfoͤrmiger Kaͤmme oder Hecheln gekaͤmmt wird,
waͤhrend diese Operation bisher durch die Haͤnde des
Wollkaͤmmers verrichtet wurde. Der Mechanismus, durch welcher diese sich
drehenden Kaͤmme in Bewegung gesezt werden, wird nicht als ein Theil des
Patentes betrachtet; im Gegentheile man kann dieselben auf irgend eine andere, von
der in der Zeichnung gegebenen verschiedenen Art und Weise treiben lassen. Den
Hauptgegenstand des Patentes bilden bloß die eigene Construction der Kaͤmme
und die relative Stellung derselben zu einander.
Fig. 12 ist
eine horizontale Darstellung der Maschine, welche aus einem vierekigen eisernen
Rahmen oder Gestelle a, a besteht, der, wie der
Endaufriß Fig.
13 zeigt, von Fuͤßen getragen wird. b
und c sind zwei Wellen oder Spindeln, von denen eine
jede einen der kreisfoͤrmigen Kaͤmme dd traͤgt. Diese Wellen oder Spindeln b,
c sind nicht horizontal, sondern unter einem spizigen Winkel gegen den
Horizont, und so gestellt, daß sie sich kreuzen. Die kreisfoͤrmigen
Kaͤmme, welche an den Wellen befestigt sind, drehen sich daher unter
betraͤchtlichen Winkeln mit einer Senkrechten, und so gegen einander, wie sie
in Fig. 13
dargestellt sind.
Die kreisfoͤrmigen Kaͤmme sind in der Form gewoͤhnlicher,
duͤnner, hoͤlzerner Raͤder mit Armen oder Speichen gearbeitet,
und die Radbuͤchse wird mittelst einer Schraube an der Welle befestigt. Die
Spizen oder Hecheln sind in die Flaͤche des Randes eingesezt, und diese
Kaͤmme werden mittelst des gedrehten Riemens ee, der uͤber die, an jeder Spindel angebrachte, Rolle f laͤuft, in entgegengesezten Richtungen gedreht,
und durch ein, an dem Ende der Spindel oder Welle b
befindliches Band und den Treiber g getrieben.
Waͤhrend die Kaͤmme rund herum gehen, muͤssen sie sich auch
langsam einander naͤhern; dieß geschieht dadurch, daß die Zapfenlager der
Welle c in Geleisen ruhen, und mithin hin und her
gleiten koͤnnen, so daß die Welle c und ihr
kreisfoͤrmiger Kamm gegen den Kamm an der Welle oder Spindel b
gebracht werden kann. Diese hin und her gleitende Bewegung schlaͤgt der
Patent-Traͤger vor, durch eine Schraube ohne Ende und eine an dem
unteren Theile des Gestelles angebrachte (in Fig. 12 aber nicht
dargestellte) Schneke zu bewirken, durch welche die Welle c gradweise nach einer seitlichen Richtung bewegt wird, waͤhrend
der gedrehte Riemen e, der die beiden Wellen oder
Spindeln mit einander verbindet, und c in Folge der
Umdrehung von b bewegt, bei der Annaͤherung der
beiden Kaͤmme gegen einander mittelst der schweren Rolle h, welche mit dem Hebel i
zusammenhaͤngt, in gehoͤriger Spannung erhalten wird.
Wird nun diese Maschine in Thaͤtigkeit gesezt, und will man mit derselben
Wolle kaͤmmen; so bringt man eine gehoͤrige Menge roher Wolle zwischen
die Spizen oder Hecheln der kreisfoͤrmigen Kaͤmme; so wie nun diese in
eine schnelle drehende Bewegung gesezt werden, so werden die losen Enden der Wolle
durch die Centrifugalkraft nach der Richtung der Radii weggeschleudert, und von den
Spizen oder Hecheln des anderen, sich umdrehenden Kammes gefangen, und dadurch die
Fasern ausgezogen und in gerade Richtung gebracht werden.
Die Operation muß begonnen werden, waͤhrend sich die Kaͤmme in der
groͤßten Entfernung von einander befinden; so wie sich dieselben einander
langsam naͤhern, werden die Enden oder Fasern der Wolle von den Spizen in
groͤßerer Tiefe gehalten werden, bis die Kaͤmme an einander gekommen
sind, waͤhrend welcher Zeit die ganze Laͤnge der Wollfasern glatt
angekaͤmmt und aus dem Kamme gezogen worden seyn wird, so daß man dann nur
mehr mit der Hand die kurze, verworrene Wolle, oder den Ruͤkstand, welcher in
den Kaͤmmen bleibt, mit der Hand zu entfernen, und demselben neuerdings
fuͤr eine neue Operation mit frischer Wolle zu versehen braucht.
Der Patent-Traͤger nimmt folgende drei Dinge als seine Erfindung in
Anspruch: 1) die Construction der kreisfoͤrmigen Kaͤmme; 2) die
schiefe Richtung, in welcher sie gegen einander gestellt sind, und in welcher sie
sich umdrehen, und 3) die Vorrichtung, durch welche die Kaͤmme einander
genaͤhert werden, und auf die Fasern der Wolle wirken.
Tafeln