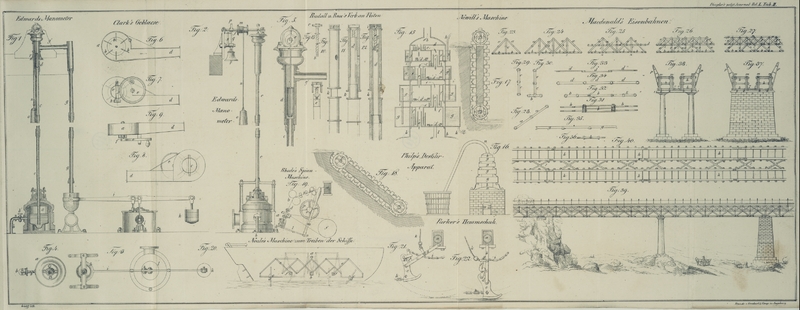| Titel: | Verbesserungen an den Destillir- und Rectificir-Apparaten, auf welche sich Edward Dakin Philp, Chemiker in Regent-Street, Westminster, am 29. November 1828 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 50, Jahrgang 1833, Nr. XXV., S. 106 |
| Download: | XML |
XXV.
Verbesserungen an den Destillir- und
Rectificir-Apparaten, auf welche sich Edward Dakin Philp, Chemiker in
Regent-Street, Westminster, am 29. November
1828 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of Arts 1833. Supplement, S.
138.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Verbesserungen an den Destillir- und
Rectificir-Apparaten.
Der Apparat des Patenttraͤgers besteht in einer Vorrichtung, welche auf den
Destillirhelm aufgesezt werden soll, und durch welche die Weingeistdaͤmpfe
besser als auf irgend eine andere Weise von dem Gehalte an Wasser befreit werden
sollen.
Man sieht diesen Apparat in Fig. 15 von Außen, auf
einen Destillirapparat oder einer Destillirblase aufgesezt. Fig. 16 zeigt dessen
innere Einrichtung in einem etwas groͤßeren Maßstabe, a ist der Scheitel der Destillirblase, von welchem die cylindrische
Roͤhre b, b, b gleichsam als Helm emporsteigt.
Diese Roͤhre ist durch horizontale Scheidewaͤnde d, d, d, d, d in mehrere Faͤcher cccc, dergleichen der Patenttraͤger vier
vorschlaͤgt, abgetheilt. Alle diese Faͤcher koͤnnen nur durch
die Oeffnungen e, e, e, e mit einander communiciren, und
diese Oeffnungen sind durch Wasser geschuͤzt.
Innerhalb der Faͤcher c werden naͤmlich
durch die umgekehrten, cylindrischen Buͤchsen f, f, f,
f innere Kammern gebildet. Der Dampf gelangt, nachdem er aus der
Destillirblase emporgestiegen, und in das untere Fach c
eingetreten, in das Innere der Kammer f, und zwar durch
Oeffnungen, welche sich an dem unteren Theile der umgestuͤrzten
Buͤchse befinden. Die Buͤchsen koͤnnen daher auch auf
Fuͤßen in den Faͤchern stehen, damit Dampf frei aus jedem Fache in die
in ihm befindliche umgestuͤrzte Buͤchse gelangen kann.
Jedes Fach ist mit einem cylindrischen Gefaͤße gg umgeben, welches zum Behufe der Abkuͤhlung des Dampfes und der Beschleunigung seiner
Verdichtung mit Wasser gefuͤllt ist. Dieses Wasser gelangt durch die
Roͤhre h in das oberste der Gefaͤße, und
aus diesem dann durch die Roͤhren iii nach
und nach in alle unteren, um endlich bei k wieder
abzufließen.
Der Gang der Destillation bei diesem Apparate ist nun folgender: Der aus der
Destillirblase emporsteigende Dampf geht durch die untere Oeffnung e in dem Helme b in das
untere Fach c, wie dieß durch Pfeile angedeutet ist. In
diesem Fache wird er zum Theil durch das in dem umgebenden Behaͤlter
enthaltene Wasser abgekuͤhlt, und dabei wird ein Theil der mit ihm
vermischten Wasserdaͤmpfe verdichtet, so daß dieselben als
Fluͤssigkeit zu Boden fallen, und durch die Roͤhre l wieder in die Destillirblase zuruͤkfließen,
waͤhrend die Alkoholdaͤmpfe durch die im Boden der Buͤchse f befindlichen Oeffnungen mm, und dann durch die Roͤhre e nach
der durch Pfeile angedeuteten Richtung in das zweite Fach c emporsteigen. Hier wird der Dampf neuerdings wieder durch das in dem
umgebenden Behaͤlter befindliche kalte Wasser abgekuͤhlt, und weiter
verdichtet, so daß der waͤsserige Theil auf den Boden der Faͤcher
faͤllt, und durch die Wasserverbindung in das untere Fach abfließt,
waͤhrend die Alkoholdaͤmpfe durch die Oeffnung e in das naͤchst obere Fach weiter emporsteigen. Und so geht es
fort, bis der Alkoholdampf endlich an den Scheitel des Destillirhelmes gelangt, und
von hier in hoͤchst rectificirtem Zustande durch die Roͤhre und in den
Wurm oder die Schlangenroͤhre stroͤmt, in welcher er endlich zu einer
reinen geistigen Fluͤssigkeit verdichtet wird.
Der Patenttraͤger beschraͤnkt sich auf keine bestimmte Zahl und
Groͤße der Faͤcher, Buͤchsen und Gefaͤße.
Das London Journal bemerkt hierzu ganz richtig, daß
dieser Destillirapparat dem Principe und dem Baue nach dem von Saintmarc erfundenen Apparate (Polyt. Journ. Bd. XXIV. S. 465) und dem Yandall'schen Refrigerator (Polyt. Journ. Bd. XXIV. S. 372) aͤußerst
aͤhnlich ist, und daher nicht viel Neues darbietet.
Tafeln