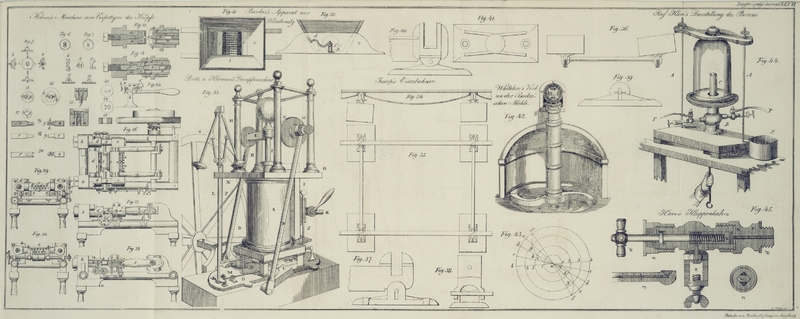| Titel: | Verbesserungen an den metallenen Oehren oder Oehsen der Knöpfe, auf welche sich John Holmes, Mechaniker von Birmingham, Grafschaft Warwick, am 4. Mai 1833 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 50, Jahrgang 1833, Nr. LXXIX., S. 350 |
| Download: | XML |
LXXIX.
Verbesserungen an den metallenen Oehren oder
Oehsen der Knoͤpfe, auf welche sich John Holmes, Mechaniker von Birmingham, Grafschaft
Warwick, am 4. Mai 1833 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. September 1833, S.
69.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Verbesserungen an den metallenen Oehren der
Knoͤpfe.
Meine Erfindung, sagt der Patenttraͤger, besteht darin, daß ich an Scheiben
oder Stuͤken aus duͤnnem Metalle, welche die Ruͤken oder
unteren Flaͤchen der Knoͤpfe bilden, eigens geformte
Erhoͤhungen anbringe, die die Oehren oder Oehsen der Knoͤpfe bilden
sollen; oder darin, daß ich diese Oehren oder Oehsen aus Scheiben oder Metallplatten
forme, welche die ganze Substanz irgend einer Art von Knoͤpfen, die keine
flache Oberflaͤche erfordern, bilden; oder darin, daß ich die Oehren oder
Oehsen aus duͤnnen Stuͤkchen Metallblech verfertige, welche
Stuͤkchen nicht mit dem Ruͤken der Knoͤpfe aus einem
Stuͤke bestehen, sondern durch eine Loͤthung, einen Kitt, oder auf
irgend eine andere Weise mit dem Ruͤken oder irgend einem anderen Theile der
Knoͤpfe verbunden werden, die Knoͤpfe moͤgen mit Florentin
uͤberzogen seyn oder aus irgend einem Metalle, aus Perlmutter, Horn,
Elfenbein, Holz oder einer anderen Substanz bestehen.
Da die Gestalt oder Form meiner verbesserten Oehren einige Veraͤnderungen
erleiden kann, so will ich zuerst jene Form beschreiben, der ich den Vorzug vor
allen uͤbrigen gebe, und welche sich auf der Metallscheibe, die den
Ruͤken des Knopfes bildet, erhebt; 2) werde ich einige zwekmaͤßige
Veraͤnderungen in der Form dieser Oehre am geben; 3) werde ich zeigen, wie
die Oehren nicht aus einem Stuͤke mit den Scheiben oder Ruͤken
verfertigt, sondern erst spaͤter durch eine Loͤthung, einen Kitt oder
auf eine andere Weise damit verbunden werden; 4) werde ich die Werkzeuge und Bunzen,
deren man sich zur Verfertigung dieser Oehren bedient, beschreiben, und 5) endlich
die ganze Maschinerie, deren ich mich bediene, obschon ich mich gerade nicht auf die
genaue Befolgung der Einrichtung dieser Maschine beschraͤnke, da man sich
wohl auch einer gewoͤhnlichen Fluͤgel- oder
Hebel-Ausschlagpresse hierzu bedienen kann.
In Fig. 1 sieht
man eines meiner verbesserten Oehren eines Knopfes, welches hier aus der den
Ruͤken des Knopfes bildenden Metallscheibe geformt ist. Fig. 2 ist eine
Seitenansicht desselben Knopfes, in welcher man durch dieses Oehr sieht. In Fig. 3 sieht
man dasselbe Oehr endwaͤrts. Fig. 4 ist ein
Durchschnitt durch das Oehr und die Scheibe nach der punktirten Linie AB
Fig. 1,
waͤhrend
Fig. 5 einen
eben solchen Durchschnitt nach der punktirten Linie CD
vorstellt. Alle diese Figuren, so wie die spaͤter noch zu beschreibenden
Oehre, und die zu deren Verfertigung dienenden Instrumente sind in der
Haͤlfte ihrer wirklichen Groͤße gezeichnet.
Man wird aus diesen Zeichnungen ersehen, daß die Oehren oder Oehsen aa hier dadurch gebildet sind, daß sie zum Theil aus dem
Wen b geschnitten und dann emporgetrieben werden. Sie
werden hierbei mittelst eigener Instrumente oder Bunzen so geformt und
gedruͤkt, daß der Scheitel der Oehren abgerundet ist, wie man bei c sieht; die Raͤnder des Metalles werden ferner
so abgedreht, daß sie den Faden, mittelst welchem sie angenaͤht werden, nicht
abschneiden. Man wird ferner bemerken, daß, da die Faden beim Annaͤhen nur
durch eine einzige Oeffnung gehen koͤnnen, und da diese Oeffnung
uͤberall abgerundet ist, die Faden saͤmmtlich in dem Mittelpunkte des
Oehres bleiben werden, und daß diese Form der Oehren also eine viel genauere
Befestigung des Knopfes an den Kleidern zulaͤßt. Die Enden des Oehres oder
die Theile so, welche sich aus der Scheibe oder aus dem Ruͤken b erheben, sind beinahe kreisrund, damit kein Metallrand
gegen die Seiten des Knopfloches gerichtet ist. Wenn das Oehr daher angenaͤht
ist, so bildet es in Verbindung mit den Faden eine runde Befestigung, in Folge deren
das Oehr das Knopfloch nicht abnuͤzt oder ausfranst: die Faden fuͤllen
naͤmlich, wenn der Knopf gehoͤrig angenaͤht worden, die
Oeffnung durch das Ohr beinahe aus, und vollenden also jenen Theil des Kreises, der
bei der Bildung der halbmondfoͤrmigen Theile des Oehres mittelst der Bunzen
oder Model aus demselben herausgeschafft wurde. Meine Absicht ist daher, daß die
inneren Raͤnder des Oehres so viel als moͤglich von den Faͤden,
durch welche der Knopf an den Zeug angenaͤht ist, weggekehrt seyn soll; daß
die Außenseite des Oehres eine solche Form haben soll, daß sie dem Knopfloche
uͤberall abgerundete Oberflaͤchen darbietet; und daß der Faden die
durch das Oehr gehende Oeffnung so ausfuͤllen soll, daß eine runde
Befestigung des Knopfes an dem Kleide entsteht. Der Ruͤken der in diesen
Figuren abgebildeten Knoͤpfe hat hier jene Form, die er an jenen
Knoͤpfen zu haben pflegt, welche mit Florentin oder einem anderen Fabrikate
uͤbers zogen, oder mit Metallblaͤttchen belegt werden sollen, wo dann
die Raͤnder dieses Blaͤttchens oder Ueberzuges uͤber die
schiefen Raͤnder der Ruͤken gebogen und geschlossen werden.
In Fig. 6 sieht
man ein Oehr, an welchem der Ausschnitt in der Metallscheibe oder in dem
Ruͤken nicht halbkreisfoͤrmig oder halbmondfoͤrmig ist, wie ihn
Fig. 1
zeigte, sondern an welchem derselbe durch eine parallele Rippe an dem Model und eine
entsprechende Furche in
dem Bunzen erzeugt wurde. Fig. 7 ist eine andere
Form von Oehr, dessen Seiten dadurch gebildet werden, daß sowohl die Seiten des
Models, als jene des Bunzens gerade laufen. Diese Art von Oehren runde ich durch
eigene, spaͤter zu beschreibende Bunzen oder Instrumente ab, damit dieselben
die Faden nicht abschneiden. In Fig. 8 steht man ein
verbessertes Oehr, an welchem bloß Theile ff des
Ruͤkens des Knopfes mit dessen Enden verbunden sind. Oehren dieser Art eignen
sich vorzuͤglich fuͤr solche Knoͤpfe, an denen ein metallener
Ueberzug von den schraͤgen Kanten der Enden eingeschlossen wird;
uͤbrigens kann das Oehrstuͤk auch auf eine andere Weise mit der
Vorderflaͤche des Knopfes verbunden werden. Fig. 9 zeigt ein aus einer
kleinen Metallscheibe gg gehobenes Oehr, welches an die
den Knopf bildende Metallplatte geloͤthet, oder auf eine andere Weise daran
befestigt werden kann. Fig. 10 stellt ein
anderes, zu gleichem Zweke dienendes Oehr vor, an welchem bloß die metallenen Theile
hh an dem Ruͤken des Knopfes
angeloͤthet oder auf sonstige Weise daran befestigt werden; so kann man z.B.
ein ringfoͤrmiges, den Ruͤken des Knopfes bildendes Stuͤk
daruͤber anbringen, und dieses dann auf die beschriebene Weise an dem
vorderen Theile des Knopfes befestigen. Fig. 11 ist ein Oehr,
welches aus einer Metallplatte mit schraͤg abgeschnittenem Rande gebildet
ist, und welches sich hauptsaͤchlich fuͤr Knoͤpfe aus
Perlmutter, Horn, Holz, Papier oder anderen Substanzen eignet. In dem Ruͤken
des Knopfes befindet sich zur Aufnahme des Metallblaͤttchens ein
schwalbenschwanzfoͤrmiger Ausschnitt, in welchen das Metallblaͤttchen
mit schraͤg abgeschnittenem Rande gedrukt, und dann auf gewoͤhnliche
Weise darin festgemacht wird, wie dieß aus Fig. 12 ersichtlich.
Nachdem ich hiermit die verschiedenen Formen meiner verbesserten Oehren beschrieben,
will ich nun zur Beschreibung der Werkzeuge, Bunzen oder Model uͤbergehen,
durch welche ich den Ruͤken oder die Ruͤkenplatte aus einem
Metallbleche ausschneide, und zugleich auch dem Oehre die gehoͤrige Form
gebe. Fig. 13
ist ein Laͤngendurchschnitt durch ein Paar solcher Model oder Matrizen und
Bunzen, an welchem beide einzeln fuͤr sich dargestellt sind. Fig. 14 ist ein
aͤhnlicher Durchschnitt; nur sind hier die beiden Theile mit einander
verbunden, und in jenem Augenblike dargestellt, in welchem das Oehr gebildet wird,
nachdem die Ruͤkenplatte des Knopfes aus dem Metallbleche ausgeschnitten
worden. Fig.
15 ist eine Ansicht des Bunzens von Vorne; Fig. 16 ist eine
aͤhnliche Ansicht des Gegenmodels oder der Matrize, a ist der eigentliche Bunzen oder das Schneidinstrument, und b das Widerlager, durch dessen kreisfoͤrmigen
Rand die Metallplatte aus dem Bleche ausgeschnitten wird. c ist eine in dem Bunzen a angebrachte Patrize, auf welche der
Knopfmacher seinen Namen graviren lassen kann. Diese Patrize sieht man in Zig. 17
von Vorne und aus dem Bunzen herausgenommen, d ist der
Gegenmodel oder die Matrize fuͤr den Bunzen c Man
wird hieraus ersehen, daß die Patrize und Matrize in Verbindung mit dem Bunzen und
dem Widerlager die Metallplatte in jene Form druͤken, die fuͤr den
Ruͤken des Knopfes erforderlich ist. Die hier abgebildete Form ist jene, die
sich fuͤr solche Knoͤpfe eignet, welche mit Florentin oder mit einer
duͤnnen Metallplatte uͤberzogen werden sollen. e ist der Bunzen, welcher das Oehr ausschneidet; er ist in der Matrize
befestigt, schneidet durch die Metallplatte, und bildet, so wie sich die Model
einander naͤhern, das Oehr, indem er die Platte in den in der Patrize c befindlichen Ausschnitt treibt, in welchem sie mit dem
Ende eines anderen Bunzen oder einer anderen Patrize f
in Beruͤhrung kommt. Diese leztere Patrize l ist
in dem Bunzen a befestigt, und druͤkt den oberen
Theil des Oehres in den Ausschnitt g der sich in dem
Ende des Bunzen e befindet, so daß das Oehr auf diese
Weise seine abgerundete Form erhaͤlt, waͤhrend der uͤbrige
Theil des Oehres zugleich in jene Form gepreßt wird, die in Fig. 1 bis 5 dargestellt ist. Die
Enden dieser die Form gebenden Bunzen oder Model paffen in und uͤber
einander, wie man aus den einzelnen Figuren jener Bunzen ersehen wird, die zur
Fabrikation der zuerst beschriebenen Art von Oehren bestimmt sind. Fig. 18 stellt die Bunzen
einzeln und aus den Modeln herausgenommen dar; Fig. 19 ist ein
Laͤngendurchschnitt derselben, waͤhrend sie in Fig. 20 vom Scheitel her
dargestellt sind. Der scharfe Rand der in dem Bunzen e
befindlichen Einziehung h kommt mit den schneidenden
Raͤndern der hervorragenden Rippe i des Models
oder der Patrize c in Beruͤhrung, und schneidet
dadurch so viel von dem Metalle durch, als erforderlich ist. Der Rand k dieser Patrize gibt den aͤußeren Enden des
Oehres eine kugelfoͤrmige Gestalt, waͤhrend die Bunzen das Metall
emportreiben und auf diese Weise das Oehr bilden. u, u
sind Loͤcher, welche durch die Matrize d gehen,
und die zum Durchgange der Stifte dienen, wenn das fertige Oehr oder
Ruͤkenstuͤk des Knopfes aus der Matrize ausgestoßen werden soll. Am
Ruͤken der Bunzen und der Model sind Stellschrauben angebracht, mittelst
welcher dieselben regulirt, und gegenseitig in die gehoͤrige Stellung
gebracht werden koͤnnen.
Obschon ich die Bunzen, die zum Formen meiner verbesserten Lehren bestimmt sind, als
in Verbindung mit jenen Bunzen und Rodeln dargestellt habe, die zum Ausschneiden und
Formen der Metallscheiben, welche den Ruͤken der Knoͤpfe bilden,
bestimmt sind, so beschraͤnke ich mich doch nicht auf diese einzige Methode dieselben
anzuwenden. Die flachen Blaͤttchen oder Scheiben, welche fuͤr den
Ruͤken der Knoͤpfe bestimmt sind, koͤnnen naͤmlich in
einer eigenen Ausschlagpresse ausgeschnitten, hierauf in derselben oder in einer
anderen Presse geformt, und dann der Einwirkung jener Bunzen, die meine verbesserten
Oehren formen und die zu diesem Zweke in einer gehoͤrigen Presse befestigt
worden, ausgesezt werden. Dieser lezteren Methode die Oehren und die Ruͤken
der Knoͤpfe zu formen, gebe ich hauptsaͤchlich dann den Vorzug, wenn
diese Theile aus solchen Metallen erzeugt werden sollen, die zwischen dem Formen der
Ruͤken und dem Formen der Oehren angelassen werden muͤssen. Fig. 21 ist
ein Durchschnitt durch ein Paar Model, in welchen bloß die Oehren geformt werden,
nachdem die Ruͤkenplatten der Knoͤpfe bereits in einer anderen Presse
ausgeschnitten worden. In diesem Falle sind die Patrizen und Matrizen e und f in den
Fuͤhr- oder Leitungsstuͤken m und
n aufgezogen, mittelst welcher sie gegenseitig in
gehoͤriger Stellung gegen einander erhalten werden; d.h. die Patrize c ist in dem Fuͤhrstuͤke n aufgezogen und wirkt gegen die vordere Flaͤche
des Fuͤhrstuͤkes m. Die Blaͤttchen
oder Ruͤken der Knoͤpfe koͤnnen mit Huͤlfe der
Haͤnde, oder auf irgend eine andere Weise in die Model gebracht werden, und
wenn das Oehr vollendet ist, so kann dasselbe mittelst Staͤben, die durch die
Loͤcher u, u gehen, aus dem unteren Model
ausgetrieben, und hierauf mit den Haͤnden oder auf irgend eine andere Weise
entfernt werden.
Wenn meine verbesserten Oehre aus Eisen oder einem Metalle geformt werden sollen,
welches zu bruͤchig ist, als daß das Oehr emporgetrieben, und mit einem Male
in den Matrizen und Patrizen vollendet werden koͤnnte, so schneide ich vorher
das Ruͤkenblaͤttchen der Knoͤpfe aus, und treibe hierauf,
nachdem ich dasselbe angelassen, jenen Theil des Metalles, der das Oehr bildet,
empor, und zwar in die in Fig. 22 dargestellte
Form; d.h. ich drehe die Raͤnder des Metalles nicht ab, um auf diese Weise
das Durchschneiden der Faden zu verhindern. Wenn die Metallblaͤttchen hierauf
neuerdings wieder angelassen worden, so biege ich die Raͤnder in die in Fig. 7
dargestellte Form. Dieß geschieht mittelst gehoͤriger Bunzen oder Model in
einer anderen Presse oder mittelst einer Kneipzange und eines Bunzens, wie Fig. 23 zeigt,
welche eine Seitenansicht eines kleinen Apparates zum Umbiegen der Raͤnder
des Oehres mit der Hand vorstellt. a ist die obere Wange
einer Kneipzange, die an dem Kopfe des Pfostens b
befestigt ist. Die untere Wange c wird von dem Ende des
Hebels oder Griffes d gebildet, der seinen
Stuͤzpunkt in dem Pfosten b hat. e ist ein kleiner Bunzen, welcher durch ein
Fuͤhrloch in dem
Kopfe des Pfostens geht, und der mit dem einen Ende in die Wangen der Kneipzange
hineinragt, waͤhrend er sich mit dem anderen Ende gegen das Stuͤk f stemmt, welches durch ein Gelenk mit dem Hebel d verbunden ist, und sich durch eine in dem Kopfe des
Pfostens befindliche Spalte bewegt. Dieses Stuͤk f hat an der dem Ende des Bunzen zunaͤchst gelegenen Seite eine
schiefe Flaͤche, welche bei ihrem Herabsteigen den Bunzen vorwaͤrts
gegen den Scheitel des bei g befindlichen Oehres treibt,
wenn die Kneipzange durch das Herabdruͤken des Hebels d geschlossen wird; und dieser Bunzen in Verbindung mit den Wangen der
Kneipzange gibt dem Oehre die erforderliche Form, wie man sie bei h und in Fig. 7 in groͤßerem
Maßstabe sieht. Die Feder i wirkt auf einen in dem
Bunzen e befestigten Stift, und bringt denselben wieder
in seine fruͤhere Stellung zuruͤk, wenn die Wangen nach der Bildung
des Oehres wieder geschlossen werden. In Fig. 24 und 25 sieht man
die Model und Bunzen, durch welche die Spalten in die Scheiben Fig. 6 geschnitten werden,
von Vorne und im Durchschnitte.
Die Maschine oder der Apparat, dessen ich mich bei meiner Fabrikation bediene, ist
nun folgender. Ich nehme ein Metallblech von 30 bis 40 Fuß Laͤnge, und von
gehoͤriger Dike und Breite; dieses Blech rolle ich auf eine Walze auf, welche
uͤber der Maschine angebracht wird, so daß das Blech leicht in, die Maschine
gezogen werden kann, je nachdem dieß zum Speisen der Bunzen und der Model
erforderlich ist. Fig. 26 ist ein Grundriß einer Maschine, an welcher eine beliebige Anzahl
von Bunzen und Modeln in Reihen aufgezogen werden kann; in der Zeichnung sind 11
Aufsaͤze von solchen Bunzen und Modeln dargestellt, wie sie unter Fig. 13 bis
20
beschrieben und abgebildet worden. Fig. 27 ist eine
Seitenansicht, und Fig. 28 ein Laͤngendurchschnitt durch die Maschine. Fig. 29 und
30 sind
Querdurchschnitte durch dieselbe zwischen den Bunzen und den Matrizen hindurch. Fig. 29 zeigt
die Matrizen, so wie sie der Vorderseite der Bunzen gegenuͤber aussehen; in
Fig. 30
sieht man sie hingegen von der entgegengesezten Seite. aa sind die Bunzen; bb die Matrizen, welche
reihenweise in den Stahlplatten c, c aufgezogen sind.
Diese Stahlplatten sind mittelst versenkter Schrauben und Schraubenmuttern an zwei
starken Staͤben d und e befestigt; die Bunzen und Model werden durch Platten an ihrer Stelle
erhalten, welche an die vordere Flaͤche der Stahlplatten geschraubt sind, und
gegen die Halsringe der Bunzen und der Model druͤken. Die Staͤbe d, e sind beide an den Fuͤhr- oder
Leitungsstiften g, g aufgezogen, und diese Stifte sind
in den Haͤuptern h, h des Gestelles befestigt,
und gehen durch die an den Enden der Staͤbe befindlichen Verdikungen.
Der Stab d befindet sich unbeweglich an den
Leitungsstiften, indem er durch Schraubenmuttern und Schrauben, welche durch Oehren,
die an deren Verdikungen gegossen sind, gehen, an den Haͤuptern h, h befestigt ist. Der Stab e hingegen gleitet frei an den Leitungsstiften gg hin und her, so wie derselbe bei den Umdrehungen der Kurbelwelle durch
den Krummhebel oder die Kurbel ii und die Verbindungsstangen jj nach Ruͤkwaͤrts und Vorwaͤrts bewegt wird.
Das Metallblech, aus welchem die Oehre gebildet werden sollen, wird, wie oben gesagt
worden, uͤber der Maschine angebracht. Sein Ende wird, wie bei aa ersichtlich, herabgezogen, zwischen der
Leitungsstange und der Luͤftungsplatte k
durchgefuͤhrt, und dann zwischen die Speisungswalzen ll gebracht, welche nach jeder Operation der Bunzen durch ihre Umdrehungen
eine neue Portion von dem Metalle zwischen die Bunzen und die Model ziehen. So wie
sich die Matrizen vorwaͤrts gegen die Bunzen bewegen, so kommen sie zuerst
mit dem Metallbleche in Beruͤhrung, und wenn sie nun hierbei jenen Druk
erzeugt haben, durch welchen die Scheiben ausgeschnitten werden, so werden die
ausgeschnittenen Stuͤke von den Matrizen gegen die Enden der Bunzen
getrieben. Damit sich aber das Blech nach Vorwaͤrts bewegen kann, so ist der
Wagen, der die Achsen der Speisungswalzen traͤgt mit der Fuͤhrstange
und der Luͤftungsplatte so eingerichtet, daß er sich mittelst des Stiftes in
schieben kann. Dieser Stift bewegt sich in einer Spalte, oder in einem Fenster des
Schieberstuͤkes n, in welchem die Achse der
Speisungswalze ll ruht. Der Schieber n wird durch schwalbenschwanzfoͤrmige
Fuͤhrstuͤke, die man in Fig. 30 sieht, an seinem
Plaze in dem Gestelle der Maschine erhalten.
Wenn die Matrizen bis in die Naͤhe des Metallbleches vorgetreten sind, so
kommt der Stift m mit jenem Ende des Fensters oder der
Spalte in dem Stuͤke n in Beruͤhrung,
welches den Bunzen zunaͤchst liegt, und treibt so den Wagen mit den
Speisungswalzen und der Luͤftungsplatte, so wie auch das Metallblech
vorwaͤrts, waͤhrend die Model durch die Wirkung der Winkelhebel
gleichfalls hervorgetreten sind. Wenn nun die Scheiben ausgeschnitten und die Oehren
emporgetrieben worden, so wird das Metallblech auf den Bunzen zuruͤkbleiben,
und wenn der Stab e zuruͤkkehrt, so werden die
vollendeten Ruͤkenstuͤke und Oehre durch die Austreibstifte und
Stangen oo, welche durch den Stab e und durch die fruͤher erwaͤhnten Loͤcher in den
Matrizen gehen, aus den Matrizen ausgetrieben werden. Diese Austreibstifte sind
stationaͤr oder unbeweglich zwischen den Stangen pp angebracht, und diese lezteren sind an den Pfosten qq aufgezogen, welche sich, wie Fig. 26, 28 und 29 zeigen, an dem
Querriegel des Gestelles
befinden. Unmittelbar nachdem dieß geschehen, kommen die stifte in mit den anderen
Enden des in den Stuͤken n befindlichen Fensters
in Beruͤhrung, und ziehen die Speisungswalzen ll
zugleich mit der Luͤftungsplatte k und dem
Metallbleche von den Bunzen zuruͤk in die Stellung, die aus den Zeichnungen
ersichtlich ist.
In diesem Augenblike erfolgt hierauf die Speisung der Maschine mit dem Metallbleche,
indem der gekniete Zapfen r, der sich an dem Ende der
Kurbelwelle befindet, mit dem gebogenen Ende der von den Pfosten tt getragenen Schieberstange s in Beruͤhrung kommt. So wie sich nun die Kurbelwelle dreht, so
treibt dieser Zapfen r die Stange s vorwaͤrts und bewirkt dadurch, daß der Zahn oder Sperrkegel u, welcher sich an ihrem entgegengesezten Ende befindet,
das Sperrrad v um einen oder mehrere Zaͤhne
vorwaͤrts treibt. Da nun aber dieses Sperrrad an dem Ende der Achse einer der
Walzen l befestigt ist, so wird es diese Walze in
Bewegung sezen; und da ferner an den anderen Enden der Achsen der Speisungswalzen
ein Paar Getriebe angebracht ist, so werden sich beide Walzen zugleich drehen, und
folglich das Metallblech in die Maschine herabziehen. Man wird bemerken, daß die
Pfosten, welche die Luͤftungsplatte und die Fuͤhrungsstange tragen,
von den Achsen der Speisungswalzen gefuͤhrt werden, und folglich die hin und
her gleitende Bewegung derselben theilen; und daß die Austreibstifte o so zwischen den Stangen p
gestellt werden koͤnnen, daß sie mit den Matrizen oder Gegenmodeln
correspondiren. An der Stange s befindet sich ein
stellbarer und schiebbarer Aufhaͤlter x, welcher mit dem Hinteren Pfosten t in Beruͤhrung kommt, und die Stange s hindert zu weit zuruͤkzugleiten, so daß
folglich die Quantitaͤt Metallblech, welche in die Maschine geschafft wird,
durch den Sperrkegel und das Sperrrad nach der verschiedenen Groͤße der
Bunzen und Model regulirt wird. Im Falle das Gewicht des Stabes c der die Matrizen fuͤhrt, zu sehr auf seine
Lager, die Fuͤhr- oder Leitungsstifte gg,
druͤken sollte, bringe ich unter den Verdikungen dieses Stabes kleine
Reibungsrollen yy an, welche auf den stellbaren Lagern
oder Flaͤchen zz laufen, und durch welche die
Fuͤhrstifte zum Theil von dem Gewichte des Grabes b befreit werden koͤnnen, so daß die Reibung auf diese Weise
bedeutend vermindert wird.
Tafeln