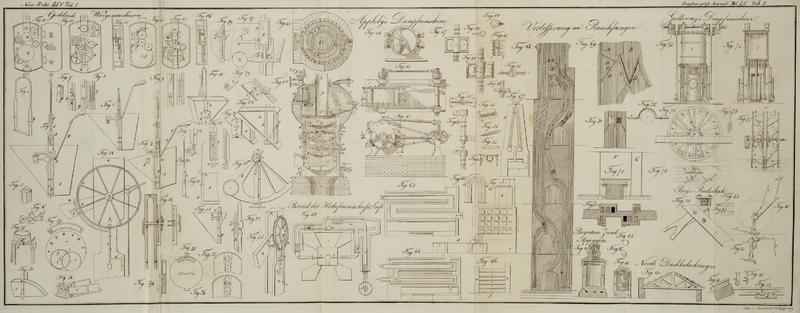| Titel: | Verbesserungen an Dampf- und anderen Maschinen worauf sich Edwin Appleby, Eisengießer von Doncaster, in der Grafschaft York, am 29. Januar 1833 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. I., S. 2 |
| Download: | XML |
I.
Verbesserungen an Dampf- und anderen
Maschinen worauf sich Edwin Appleby, Eisengießer von
Doncaster, in der Grafschaft York, am 29. Januar 1833 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem Repertory of
Patent-Inventions. Oktober 1834, S. 193.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Appleby's Verbesserungen an Dampf- und anderen
Maschinen.
Meine Erfindungen bestehen: 1) In einem solchen Baue des Kessels einer Dampfmaschine,
daß die Feuerstelle und der untere Theil des Feuerzuges dergestalt mit Wasser
umgeben sind, daß die durch das Wasser emporsteigenden Feuerzuͤge gestatten,
daß der aus dem Feuer entwikelte Strom Flamme und erhizter Luft bei seinem
Emporsteigen abwechselnd divergirt und convergirt. Durch diese abwechselnden
Verduͤnnungen und Verdichtungen, so wie durch zahlreiche Zuruͤkwerfung
kann naͤmlich dem Wasser die moͤglich groͤßte Menge
Waͤrmestoff mitgetheilt werden, wenn der heiße Strom auch nur eine kleine
Streke Raum durchzieht; auch entweicht dabei nicht mehr Waͤrmestoff durch den
Rauchfang, als zur Erzeugung eines guten Luftzuges eben erforderlich ist.
2) In einer Speisung des Kessels mit Wasser von einer Drukpumpe her durch eine
Roͤhre, in der mittelst eines Hebels ein Sperrhahn geoͤffnet und
geschlossen wird. Der Hebel wird durch einen auf der Wasserflaͤche des
Kessels befindlichen Schwimmer in Bewegung gesezt. In einem außer dem Kessel
gelegenen Theile der Roͤhre befindet sich eine Klappe, die durch ein Gewicht
herabgedruͤkt wird, welches mehr als hinreichend ist, um dem Druke des
Dampfes in dem Kessel zu widerstehen. Diese belastete Klappe wird gehoben, und
gestattet, daß alles Wasser, welches die Pumpe liefert, entweichen kann.
3) Darin, daß innerhalb dem Kessel, und in Beruͤhrung mit dem Feuerzuge etwas
unter dem gewoͤhnlichen Wasserstande das geschlossene Ende einer
Sicherheitsroͤhre angebracht wird, welche aus einem Metalle oder einem
Metallgemische besteht, welches bei einer Temperatur, die etwas hoͤher ist
als die hoͤchste Temperatur des Wassers, schmilzt. Das andere Ende der
Sicherheitsroͤhre wird offen gelassen, und mit seinem Halse in einer Pfeife,
einer Trompete oder einer
anderen, an der aͤußeren Seite des Kessels angebrachten Laͤrm
machenden Vorrichtung befestigt. So wie daher das Wasser unter das geschlossene Ende
der Sicherheitsroͤhre herabsinkt, wird dasselbe durch die Hize des Feuerzuges
geschmolzen werden; der Dampf wird dann durch die Pfeife oder durch die sonstige
Vorrichtung austreten, und durch den Laͤrm, den er auf diese Weise
verursacht, andeuten, daß das Feuer unmittelbar geloͤscht werden muß.
4) In der Befestigung zweier gefluͤgelter oder blattfoͤrmiger Kolben an
einer Welle, die sich in der Achse des arbeitenden Cylinders einer Dampfmaschine
dreht. Diese Fluͤgel ragen aus entgegengesezten Seiten der Welle hervor, und
machen in zwei geschiedenen Kammern beilaͤufig 3/8 einer Umdrehung um die
Achse des Cylinders. Die Faͤcher in dem Cylinder werden durch zwei
keilfoͤrmige Scheidewaͤnde gebildet. Indem sich die Welle durch
Stopfbuͤchsen, welche sich in den Enden des Cylinders befinden, bewegt, und,
indem an dem einen Ende der Welle ein Winkelhebel befestigt ist, wird die
schwingende Bewegung des Fluͤgelpaares mittelst einer Verbindungsstange an
einen an der Hauptwelle der Maschine befindlichen Krummhebel fortgepflanzt. Bei
dieser Einrichtung wird durch die Veraͤnderung der Stellung des schwingenden
Krummhebels, welche zum Theil auf die Veraͤnderung der Stellung des
kreisenden Krummhebels folgt, eine gleichmaͤßigere Wirkung auf die Hauptwelle
hervorgebracht; waͤhrend diese Veraͤnderung der Stellung auf den Druk
des Dampfes auf den Kolben keinen Einfluß ausuͤbt. Die Steuerung (leverage) wird hiebei vermindert, und die Kraft des
Treib-Krummhebels vermehrt, wenn die Steuerung des getriebenen Hebels
reducirt wird, und also eine groͤßere Kraft zu dessen Betrieb erforderlich
ist. Auf diese Weise wird sehr viel von jener Unregelmaͤßigkeit vermieden,
die erfolgt, wenn eine im Vergleiche gleichmaͤßige Kraft eines Kolbens, der
sich der Laͤnge nach in einem Cylinder bewegt, auf die wechselnde Steuerung
eines kreisenden Krummhebels wirkt. Ich brauche daher ein kleineres Flugrad, um den
Krummhebel uͤber die Mittelpunkte zu fuͤhren.
5) In der Erzeugung einer aͤhnlichen gleichmaͤßigen Wirkung auf den
Hauptkrummhebel durch eine solche Verbindung zweier schwingender,
fluͤgelfoͤrmiger Kolben und eines Paares concentrischer Wellen, daß
sich die eine Welle zum Theil in der anderen bewegt, und daß der eine Fluͤgel
an einer Welle befestigt ist, welche durch eine in dem einen Ende des Cylinders
befindliche Stopfbuͤchse geht, waͤhrend der andere Fluͤgel an
einer anderen Welle angebracht ist, welche durch die an dem entgegengesezten Ende
des Cylinders befindliche Stopfbuͤchse geht. Ferner in der Befestigung eines
Krummhebels an jeder
Welle, damit die schwingenden Bewegungen der Kolben mittelst zweier
Verbindungsstangen auf die beiden, an der Hauptwelle befestigten, kreisenden
Krummhebel uͤbergetragen werden. Hiedurch wird es moͤglich, daß die
beiden Kolben gleichzeitig auf die Hauptwelle wirken, waͤhrend sie sich beide
gegen diese Welle hin bewegen oder sich davon entfernen. In diesem Falle braucht der
Cylinder nicht durch Scheidewaͤnde in zwei Kammern getheilt zu seyn, indem
die Kolben in allen Stellungen gegenseitig an einander graͤnzen. Soll das
Flugrad entbehrlich gemacht werden, so werden die zusammengehaͤngten Kolben
in zwei Faͤchern eines Cylinders angebracht, damit sie auf Winkelhebel
wirken, welche unter rechten Winkeln an der Hauptwelle befestigt sind.
6) Darin, daß ich den arbeitenden Ventilen der Dampfmaschine eine cylindrische Form
gebe, und daß sie sich in halb-cylindrischen Lagern bewegen, von denen jedes
auf dem der Laͤnge nach liegenden Boden eine lange, schmale, in den
arbeitenden Cylinder fuͤhrende Oeffnung hat, wodurch von der
Dampfroͤhre her durch das Ventil eine Communication mit dem Cylinder, und
abwechselnd von dem Cylinder her durch das Ventil eine Communication mit der
Austrittsroͤhre eroͤffnet wird. Der Wechsel wird durch eine
schwingende Bewegung des Ventils erzeugt, in Folge deren die lange, schmale, in der
Seite des Ventiles befindliche Spalte bald die Muͤndung der
Dampfroͤhre, bald die Muͤndung der Austrittsroͤhre umschließt.
Das Ventil wird mittelst eines auf dasselbe druͤkenden und durch
Stellschrauben regulirbaren Dekels fest auf sein Bett angehalten, ohne daß es jedoch
dadurch in der Freiheit seiner Bewegung gehindert waͤre. Das Ventil braucht
bei dieser Einrichtung kein dampfdichtes Gehaͤuse; das Auslassen ist zu jeder
Zeit bemerkbar, und das Ventil ist leicht schluͤpfrig zu erhalten und
auszubessern.
7) In einer Liederung der Stopfbuͤchse einer Dampfmaschine mit einem Strike,
der eine Windung um die Kolbenstange macht, waͤhrend die beiden Enden dieses
Strikes bei zwei Fugen austreten, die in entgegengesezten Richtungen in dem Rande
der Stopfbuͤchse und in deren Dekel angebracht sind. Diese Ausschnitte in der
Stopfbuͤchse und in ihrem Dekel entsprechen der halben Dike des Strikes.
Beide Enden des Strikes sind an einer Feder befestigt, wodurch der Strik
bestaͤndig so gespannt erhalten wird, daß er die Kolbenstange mit solcher
Spannung umfaßt, daß kein Dampf entweichen kann, und daß dabei doch keine zu große
Reibung entsteht.
8) Endlich in dem Baue einer Maschine, welche mittelst meiner schwingenden,
fluͤgelfoͤrmigen Kolben und in Verbindung mit gewoͤhnlichen
Haͤhnen anstatt mit schwingenden Ventilen durch den hydrostatischen Druk des Wassers in Bewegung
gesezt wird. Alles dieß wird aus den beigefuͤgten Zeichnungen und aus der nun
folgenden Erlaͤuterung derselben deutlich werden.
Fig. 40 ist
ein senkrechter Durchschnitt durch die Mitte meines Dampfkessels, und eine Ansicht
der Theile, welche uͤber diesen Durchschnitt hinaus sichtbar sind.
Fig. 41 ist
ein horizontaler Durchschnitt des Kessels von A nach B in Fig. 40, mit einer
Ansicht der unter dem Durchschnitte befindlichen Theile.
Fig. 42 ist
eine Seitenansicht einer Dampfmaschine mit meinen zwei fluͤgel- oder
blattfoͤrmigen Kolben. Diese Kolben sind an einer Welle befestigt, die sich
innerhalb eines in zwei Faͤcher getheilten Cylinders schwingen, und welche
mit vieren meiner schwingenden Ventile in Verbindung stehen. Das untere Fach und die
dazu gehoͤrigen Klappen sind im Durchschnitte dargestellt; ein Theil des
Gestelles ist weggebrochen.
Fig. 43 ist
ein Grundriß dieser Maschine.
Fig. 44 zeigt
die keilfoͤrmige Scheidewand von der Seite her.
Fig. 45 ist
ein Laͤngendurchschnitt durch die Mitte derselben.
Fig. 46 ist
ein senkrechter Durchschnitt durch den Cylinder und die Klappen einer schwingenden
Dampfmaschine, welche aus zwei zusammengehaͤngten Kolben und Wellen, die mit
zweien meiner schwingenden Klappen in Verbindung gebracht sind, bestehen.
Fig. 47 ist
eine Seitenansicht des an der Welle befestigten Kolbenpaares; eine Wange ist
weggenommen, um die Anwendungsart einer metallischen Liederung zu zeigen.
Fig. 48 gibt
eine Ansicht des Kolbenpaares vom Rande her mit der Fuge, in welche die Liederung zu
liegen kommt.
Fig. 49 zeigt
ein Paar zusammengehaͤngter Kolbenwellen; eine Wange ist weggenommen, damit
man die Form jener metallenen Liederung sehe, welche sich am besten fuͤr
diese Art von Kolben eignet.
Fig. 50 zeigt
dieselben Kolben vom Rande her; man sieht hier die Fuge, in welche die Liederung zu
liegen kommt.
Fig. 51 gibt
eine Seitenansicht der Gelenke; es sind Vorspruͤnge an dieselben angegossen,
und an diesen Vorspruͤngen werden die Kolben befestigt, an denen zur Aufnahme
derselben Zapfenloͤcher angebracht sind.
Fig. 52 zeigt
diese Gelenke vom Rande her.
Fig. 53 ist
eine perspectivische Ansicht des Lagers, in welchem sich das Ventil schwingt; man
sieht hier, daß die langen, schmalen Oeffnungen zur Erhaltung der Staͤrke des
Cylinders durch eine Scheidewand in zwei Laͤngen getheilt sind.
Fig. 54 gibt
eine perspectivische Ansicht des Schwungventiles, an welchem die Fuge oder der
Ausschnitt, den Oeffnungen in dem Lager entsprechend, gleichfalls in zwei
Laͤngen abgetheilt ist.
Fig. 55 ist
ein Grundriß des Dekels, womit das Ventil auf sein Lager angedruͤkt erhalten
wird.
Fig. 56 ist
eine Seitenansicht der Strikliederung und der Federn.
Fig. 57 ist
ein horizontaler Durchschnitt durch einen Theil der Stopfbuͤchse und des
Dekels, um die Strikliederung bloßzulegen.
An allen diesen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben und gleiche Zahlen auch auf
gleiche Gegenstaͤnde.
a ist das Aschenloch und die Grundlage des Kessels. b sind die Roststangen. c
die zum Feuer fuͤhrende Oeffnung. d das
aͤußere Gehaͤuse des Kessels, welches aus ausgewalztem,
zusammengenietetem Eisenbleche besteht, e, f und g ist das innere Gehaͤuse des Kessels, welches
aus Guß- oder Schmiedeisen besteht, und welches die Feuerstelle und den
Feuerzug bildet. Der untere Theil e ist aus einem
Stuͤke geformt, und hat am Grunde einen hervorstehenden Rand, womit er an
einen aͤhnlichen vorspringenden Rand des aͤußeren Gehaͤuses
gebolzt wird. Der zweite Theil f besteht gleichfalls aus
einem Stuͤke; dieses wird auf das untere Stuͤk e gebolzt, waͤhrend das dritte Stuͤk g wieder auf das zweite oder mittlere Stuͤk gebolzt wird.
Fuͤr kleine Kessel gewahrt ein inneres gußeisernes Gehaͤuse
hinlaͤngliche Staͤrke; fuͤr groͤßere Kessel oder wo ein
starker Druk Statt finden soll, ist hingegen ein schmiedeisernes Gehaͤuse
vorzuziehen. h ist eine Fortsezung oder
Verlaͤngerung des Feuerzuges gegen den Rauchfang; die Verbindung desselben
mit dem Strike g erhaͤlt durch einen Reifen,
welcher uͤber die beiden, zusammenstoßenden, kegelfoͤrmigen Enden
faͤllt, Festigkeit und Dichtheit. Eine aͤhnliche Verbindungsart kann
auch zwischen dem Stuͤke h und der weiteren
Fortsezung des Feuerzuges benuzt werden; denn auf diese Weise laͤßt sich das
Stuͤk h durch bloßes Abheben der Reifen nach
Belieben entfernen, ohne daß der uͤbrige Theil des Feuerzuges in Unordnung
geraͤth. Man kann daher auch leicht zu dem Inneren des Stuͤkes g gelangen, um dasselbe reinigen zu koͤnnen. i ist der Reifen, welcher die Verbindungsstellen der
einzelnen Stuͤke des Feuerzuges umgibt. j ist die
an dem aͤußeren Kesselgehaͤuse angebrachte Sicherheitsroͤhre
und Pfeife. k sind drei linsenfoͤrmige
Faͤcher oder Kammern; von jeder dieser Kammern gehen drei Roͤhren aus,
welche sich in Randstuͤke endigen, die Oeffnungen gegenuͤber, welche
mit den Oeffnungen der Roͤhren correspondiren, an das innere
Kesselgehaͤuse gebolzt sind. Das in den linsenfoͤrmigen Raͤumen
enthaltene Wasser steht also vermoͤge dieser Einrichtung mit dem in dem
uͤbrigen Theile des
Kessels enthaltenen Wasser in freier Communication. Die Ringe, welche die
Raͤnder dieser Kammern oder Faͤcher bilden, koͤnnen zugleich
mit den drei hervorragenden Roͤhren am wohlfeilsten aus Gußeisen, die
Boden- und Dekelplatten hingegen aus Eisenblech, welches durch Bolzen mit den
eben erwaͤhnten Ringen verbunden wird, verfertigt werden. Ich
beschraͤnke mich uͤbrigens weder auf die Anwendung von Gußeisen, noch
auf die linsenfoͤrmige Gestalt, indem der Boden sowohl als der Dekel flach
oder concav seyn koͤnnen, und indem sich saͤmmtliche Theile eben so
gut aus Schmiedeisen und aus Kupfer verfertigen lassen. l,
l sind zwei einander gegenuͤberliegende Oeffnungen, von denen die
eine durch das aͤußere und die andere durch das innere Gehaͤuse des
Kessels geht, und welche beide mit Thuͤrchen verschlossen sind, die durch
Schrauben und Querstangen an Ort und Stelle erhalten werden. Zwei Paare solcher
Oeffnungen reichen hin, um an alle Stellen, welche weder von Oben durch Abheben des
Rauchfanges h, noch von Unten durch Ausheben einiger
Roststangen zugaͤnglich sind, eine Buͤrste bringen zu koͤnnen,
mit der sich alle Theile gehoͤrig reinigen und kehren lassen. m sind Oeffnungen, welche in dem aͤußeren
Gehaͤuse des Kessels angebracht und durch Thuͤrchen verschlossen sind,
die durch Schrauben und Querstaͤbe an ihrer Stelle erhalten werden. Durch
diese Oeffnungen erhaͤlt man zu dem Inneren des Kessels Zutritt, um allen
Unrath und alle festen Theile, die sich allenfalls darin ansammelten, entfernen zu
koͤnnen. Neun solche Oeffnungen reichen, wenn sie den neun von den drei
Kammern oder Faͤchern ausgehenden Roͤhren gegenuͤber angebracht
sind, hin, um den beschriebenen Kessel in allen seinen Theilen reinigen zu
koͤnnen. n ist ein Hahn, bei welchem man das
Wasser ablassen kann. p sind zwei Eichhaͤhne. r ist die in die Maschine fuͤhrende
Dampfroͤhre. s die Roͤhre, welche von der
Speisungspumpe herfuͤhrt. t der Hahnarm und der
Schwimmer, der die Speisung des Kessels mit Wasser regulirt. u ein durch punktirte Linien angedeutetes Ventil, welches das
uͤberschuͤssige Wasser ablaͤßt. v
der Hebel und das Gewicht, womit das Ventil belastet ist. w die Roͤhre, die das uͤberschuͤssige Wasser
ableitet.
In Fig. 42 und
43 ist 1
die Basis oder die Bodenplatte der auf einem Ziegelgemaͤuer ruhenden
Dampfmaschine. 2 das Gestell, welches die Zapfenlager der Wellen traͤgt. 3
sind diese Zapfenlager. 4 ist die Hauptwelle und 5 der Krummhebel an dieser
Hauptwelle. 6 die Verbindungsstange. 7 der Krummhebel an der Kolbenstange. 8 der
arbeitende Cylinder. 9 die keilfoͤrmigen Scheidewaͤnde, durch welche
das Innere des Cylinders in zwei Faͤcher abgetheilt ist, von denen das untere
offen, das obere hingegen geschlossen dargestellt ist, obschon sie beide als
Gegenstuͤke zu betrachten sind. 10 (Fig. 44 und 45) ist die
Liederungsfuge fuͤr die Liederung an der Kolbenstange. 11
Scheidewaͤnde in der Liederungsfuge, die derselben mehr Staͤrke geben,
damit sie dem Druke der Liederung zu widerstehen vermag. Diese Scheidewaͤnde
endigen sich in geringer Entfernung von der Kolbenstange in duͤnne
Raͤnder, so daß die Liderung durch die ganze Laͤnge der Fuge ganz und
ununterbrochen ist. 12 ist ein Dekel mit Stellschrauben, welcher der Liederung
folgt; diese Liederung kann aus Hanf bestehen, und an dem Theile, welcher sich an
der Kolbenstange reibt, mit Metall besezt seyn oder nicht. 13 (Fig. 42, 43, 47 und 48) Ist die Kolbenstange.
14 sind die beiden gefluͤgelten oder blattfoͤrmigen, an der
Kolbenstange befestigten Kolben. 15 die Liederungsfuge und die um den Rand der
Fluͤgel oder Blaͤtter laufende Liederung. 16 die Keile und die Federn,
womit die Liederung herausgetrieben wird. 17 (Fig. 42, 43, 53, 54 und 55) sind die
Schwingventile. 18 die Lager, in denen sich die Ventile schwingen. 19 die aus der
Dampfroͤhre in das Lager fuͤhrende Oeffnung. 20 die aus dem Lager in
den Cylinder fuͤhrende Oeffnung. 21 die von dem Lager in die
Austrittsroͤhre fuͤhrende Oeffnung. 22 der in dem Ventile befindliche
Laͤngenausschnitt, wodurch abwechselnd zwischen der Dampfroͤhre und
dem Cylinder, und zwischen dem Cylinder und der Austrittsroͤhre die
Communication hergestellt wird. 23 der Dekel und die Stellschrauben, womit das
Schwingventil auf sein Lager angedruͤkt wird. 24 (Fig. 42 und 43) die Hebel
und Verbindungsstangen, womit die Ventile in Bewegung gesezt werden. 25 sind die
Handsteuerung und die Excentrica. 26 sind die vorspringenden Raͤnder des
Cylinders und der Dampf- und Austrittsroͤhren. 27 die Dekel oder
Thuͤrchen, welche die beiden Enden der Faͤcher des Cylinders
einschließen. 28 (Fig. 46, 49, 50, 51 und 52) ist der arbeitende Cylinder ohne Scheidewaͤnde. 29 ist die
innere Kolbenstange, welche man in Fig. 49 zum Theil durch
punktirte Linien als in der aͤußeren befindlich dargestellt sieht. 30 die
aͤußere aus einem Stuͤke gegossene Kolbenstange mit einem Theile des
doppelten Gelenkes und seinem Vorsprunge. 31 ein anderer Theil des doppelten
Gelenkes mit seinem Vorsprunge. 32 das einfache, an der inneren Kolbenstange
befestigte Gelenk mit seinem Vorsprunge. Diese Vorspruͤnge sind in Fig. 46, 49 und 50 durch
punktirte Linien angedeutet; in Fig. 51 und 52 aber
ausgefuͤhrt zu sehen. 33 (Fig. 46) sind die
Dampfroͤhren und die Eintrittsmuͤndungen in die Ventile. 34 die
Austrittsroͤhren und die von den Ventilen herfuͤhrenden
Muͤndungen. 35 die Oeffnungen in dem Cylinder. 36 die Kolben, welche gegen
die Enden hin an Dike zunehmen, damit sie in dem Augenblike, in welchem sich das Dampfventil
oͤffnet, den zwischen den Kolben befindlichen Raum beinahe ausfuͤllen,
so daß bei der Veraͤnderung des Hubes nur wenig Dampf verloren geht. Eine
Wiederholung der Beschreibung der Ventile, Randstuͤke der Roͤhren und
anderer Theile ist hier nicht noͤthig, indem dieselben bereits bei Fig. 42, 43, 53, 54 und 55 beschrieben
wurden; eben so wenig bedarf es einer Zeichnung der Krummhebel und der
Verbindungsstangen. Es genuͤgt, wenn wir bemerken, daß sich an der
aͤußeren Kolbenstange an dem einen Ende des Cylinders und an der inneren
Kolbenstange an dem anderen Ende des Cylinders ein Krummhebel befinden muß, und daß
auch zwei Verbindungsstangen erforderlich sind, durch welche die gleichzeitige
Bewegung der Kolben an die beiden an der Hauptwelle befindlichen Krummhebel
uͤbergetragen wird. Soll das Flugrad unnoͤthig gemacht werden, so
muͤssen die Kolben, Fig. 42,
zusammengehaͤngt und an ein Paar Kolbenstangen angebracht und veranlaßt
werden, auf zwei Krummhebel zu wirken, die unter rechten Winkeln an der Hauptwelle
befestigt sind. 37 in Fig. 56 und 57 ist die
Strikliederung. 38 sind die Federn, durch welche die Strikliederung gespannt
erhalten wird. 39 die Stopfbuͤchse. 40 der Dekel derselben. 41 die
Kolbenstange. 42 in Fig. 49 sind duͤnne messingene Waͤscher, welche zwischen
die Gelenke gelegt werden; wenn sich dieselben mit der Zeit abnuͤzen, und
wenn sie daher die Raͤume nicht mehr ausfuͤllen, so koͤnnen sie
entfernt und durch dikere ersezt werden. 43 (Fig. 50) sind
duͤnne, den Teleskoproͤhren aͤhnliche Roͤhrchen, welche
in die zwei Gelenke eingesezt und gegen andere vertauscht werden, wenn sie sich so
abgenuͤzt haben, daß sie den Raum nicht mehr ausfuͤllen.
Die Maschine, so wie ich sie hier beschrieben habe, ist, wenn sie mit Dampf von einem
Druke von zwei Atmosphaͤren und ohne Verdichtung betrieben wird, auf
Erzeugung einer Kraft von 10 bis 12 Pferden berechnet. Jeder verstaͤndige
Maschinenbauer wird die Dimensionen groͤßerer oder kleinerer Maschinen, der
Dampf mag verdichtet werden oder nicht, zu berechnen wissen. Werden meine Kolben an
einer Wasserdrukmaschine angebracht, so wird gleichfalls jeder Mechaniker, der sich
auf den Bau solcher Maschinen versteht, die der gegebenen Wasserhoͤhe und der
zu vollbringenden Arbeit entsprechenden Dimensionen zu berechnen wissen.
An den groͤßeren Kesseln vermehre ich die Zahl und den Durchmesser der
linsenfoͤrmigen Kammern, damit der aufsteigende Strom von Flammen und
erhizter Luft noch oͤfter und starker ausgedehnt und wieder zusammengezogen
wird; damit diese Ausdehnungen und Contractionen, so wie die daraus folgenden
Reverberationen der Groͤße des Ofens entsprechen, und damit auf diese Weise alle jene Hize, die
nicht durchaus zur Erzeugung des gehoͤrigen Zuges im Rauchfange erforderlich
ist, erfolgreich verwendet wird.
Als meine Erfindungen nehme ich, wie gesagt, die acht oben angefuͤhrten Punkte
in Anspruch.Wir haben diese acht Punkte, die den sogenannten Claim des Patenttraͤgers bilden, oben so viel als
moͤglich woͤrtlich in's Deutsche uͤbertragen, wobei wir
nur bedauern, daß Vieles davon undeutlich und selbst mit Beihuͤlfe
der Zeichnung unverstaͤndlich ist. Unsere Leser werden die Schuld
hievon nicht uns zur Last legen, wenn wir ihnen sagen, daß sich selbst der
Herausgeber des Originals uͤber die Undeutlichkeit beklagt, und daß
diese Claims im Originale nach aͤchter
Advocaten- und Patentmethode ohne alle andere Unterscheidungszeichen,
als Comma's gegeben sind, damit man ja viele Dinge deuten koͤnne, wie
man sie eben gedeutet haben will. A. d. R.
Tafeln