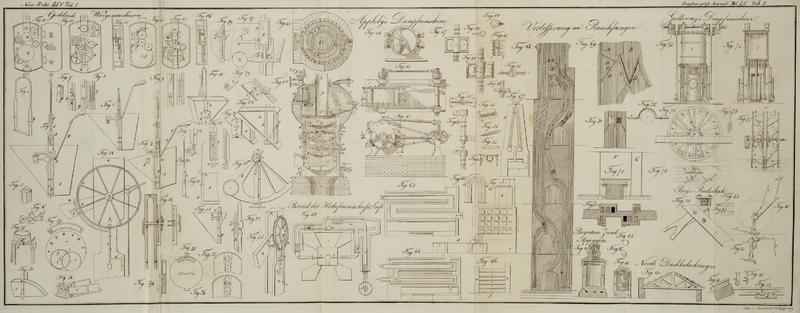| Titel: | Verbesserungen an den Maschinen zum Wägen, und in der Art und Weise die von den Wäge- und Meßapparaten vollbrachten Operationen zu ermitteln, zu registriren und anzuzeigen, worauf sich Robert Hendrik Goddard, Gentleman von Woolwich, in der Grafschaft Kent, am 27. Februar 1834 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. VI., S. 25 |
| Download: | XML |
VI.
Verbesserungen an den Maschinen zum
Waͤgen, und in der Art und Weise die von den Waͤge- und
Meßapparaten vollbrachten Operationen zu ermitteln, zu registriren und anzuzeigen,
worauf sich Robert Hendrik Goddard, Gentleman von Woolwich,
in der Grafschaft Kent, am 27. Februar 1834 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of
Arts. September 1834, S. 63.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.Die Bezeichnungen der einzelnen Theile der Vorrichtungen des
Patenttraͤgers sind an einigen Figuren ziemlich unvollstaͤndig.
Wir haben an einigen so viel als moͤglich nachzuhelfen gesucht, und
hoffen, daß die Figuren jedem Mechaniker verstaͤndlich seyn werden,
obschon sich dieß von der Patentbeschreibung selbst leider nicht durchgehends
sagen laͤßt. A. d. R.
Goddard's Verbesserungen an den Maschinen zum Waͤgen
etc.
Die Erfindungen des Patenttraͤgers sind dazu bestimmt, den Betrug beim
Waͤgen, Messen und Zahlen verschiedener Arten von Artikeln zu verhindern, was
durch folgende beide Wege erreicht wird. Der Erfinder verfertigt naͤmlich: 1)
Waͤgen, welche so eingerichtet sind, daß die auf der Waagschale befindlichen
Substanzen nicht abgegeben werden koͤnnen, sobald deren Quantitaͤt zu
groß oder zu klein ist, oder sobald sich uͤberhaupt nicht die
gehoͤrige Quantitaͤt auf der Waagschale befindet. Zur genauen
Bestimmung, Registrirung und Andeutung der Zahl der Operationen, welche die
Waͤge-, Meß- oder Zaͤhlapparate vollbrachten, bringt er
an diesen Maschinen 2) einen Mechanismus an, welcher durch die Bewegungen der
Apparate waͤhrend des Wagens, Messens oder Zaͤhlens in
Thaͤtigkeit versezt wird, so daß auf diese Weise die Person, welche sonst auf
die Operationen Acht hat, und dieselben aufzeichnet, uͤberfluͤssig
wird. Der Patenttraͤger bemerkt, daß sich seine Verbesserungen besonders auf
das Waͤgen von Steinkohlen, Salz etc. beim Ausladen derselben aus den
Schiffen beziehen, und daß er in den beigefuͤgten Zeichnungen deßhalb seine
Erfindungen auch an jenen Waagschalen angebracht zeigte, deren man sich in London
gewoͤhnlich zum Waͤgen der Steinkohlen bedient. Es versteht sich
uͤbrigens von selbst, daß mit seinen Apparaten eben so gut auch verschiedene
andere Substanzen gewogen werden koͤnnen. Die gegenwaͤrtig
gebraͤuchlichen Waagschalen sind von zweierlei Art: die einen sind ekig oder
beinahe keilfoͤrmig, und eine derselben wird mit Achsen in einen eisernen, an
dem einen Ende des Waagebalkens aufgehaͤngten Buͤgel
eingehaͤngt. So wie nun die Waagschale mit der gehoͤrigen
Quantitaͤt Kohle etc. beladen ist, laͤßt man einen Druͤker los,
wodurch sie in Folge ihrer eigenthuͤmlichen Form umschlagt, die Kohle
ableert, und hierauf wieder in ihre fruͤhere Stellung zuruͤktritt, in
der sie sich von selbst befestigt. Die andere Art von Waagschalen hat eine
aͤhnliche Form und wird gleichfalls an dem Buͤgel befestigt; sie
entleert aber ihren Inhalt durch ein Thuͤrchen, welches durch einen
Druͤker geoͤffnet und wieder geschlossen wird. Beide Arten von
Waagschalen erfordern die ausschließliche Aufsicht des sogenannten Waͤgers,
der das Gewicht regulirt, und jede Operation aufzeichnet. Alle diese Verrichtungen
dieses Waͤgers besorgt die neue Vorrichtung mit groͤßter
Genauigkeit.
Fig. 1 ist
eine Seitenansicht einer Waagschale von erster Art, an der jene Vorrichtung
allgebracht ist, womit der erste Zwek der Erfindung des Patenttraͤgers
erreicht wird. Die Waagschale ist hier leer. Fig. 2 zeigt denselben
Apparat in kleinerem Maßstabe, und zwar im Umschlagen zum Behufe des Entleerens der
Waagschale begriffen. Fig. 3 zeigt die
Waagschale in der Stellung, welche sie hat, wenn sie zu stark beladen und so
gesperrt ist, daß sie nicht eher abgeleert werden kann, als bis die
uͤberschuͤssige Quantitaͤt Kohle entfernt worden. Fig. 4 gibt
eine Ansicht des Buͤgels allein.
A ist die Waagschale, die an Achsen aufgehaͤngt
ist, welche sich in dem Buͤgel B drehen. a ist ein Druͤker, welcher sich um einen in der
Waagschale befestigten Zapfen dreht; an seiner unteren Seite befindet sich ein
Zapfenloch, welches zur Aufnahme des Federriegels b
bestimmt ist, der an der Seite der Waagschale befestigt, und in Fig. 5 einzeln fuͤr
sich abgebildet ist. Mittelst dieser Vorrichtung wird verhindert, daß sich die
Waagschale umdrehe, bevor sie durch den spaͤter zu beschreibenden Mechanismus
losgemacht wird. C ist eine Stange, welche an einem
fixirten Balken aufgehaͤngt ist, und welche durch Zapfenlager geht, die sich
an der Seite der Waagschale befinden. Diese Stange traͤgt den Mechanismus,
der die Waagschale frei macht, so wie auch jenen, welcher das Umschlagen hindert,
sobald sich nicht genau die bestimmte Quantitaͤt Kohlen auf der Waagschale
befindet. D ist ein belasteter Hebel, den man in Fig. 6 einzeln
abgebildet sieht, und der sich an der Stange C um eine
Achse dreht; an ihm befinden sich die Zapfen c, durch
welche der Druͤker frei gemacht wird, wenn die Waagschale die
gehoͤrige Quantitaͤt Kohle enthaͤlt. An diesem Hebel befindet
sich auch noch ein anderer Zapfen d, der in Verbindung
mit dem Hemmer (preventer) e, sobald er mittelst der Stange C herab bewegt
wird, das Freiwerden des Druͤkers verhindert, im Falle die Waagschale eine
groͤßere, als die geeignete Quantitaͤt enthaͤlt. E ist ein an der Stange C
befestigtes Gehaͤuse, welches eine um eine Roͤhre g gewundene Feder enthaͤlt. Diese Roͤhre
wird an ihrem oberen Ende von einem auf die Feder f druͤkenden
Halsstuͤke getragen; das andere Ende der Roͤhre geht in das
Halsstuͤk h uͤber, auf welchem die an der
Waagschale befestigte Schlinge oder der Ring i ruht,
sobald die Waagschale zu sehr belastet ist. j ist ein
aͤußeres Gehaͤuse, welches an der Stange C
befestigt ist, und das Ganze einschließt. Alle diese Theile sieht man in Fig. 7, 8 und 9 am besten,
indem diese Figuren den Federapparat von Außen und im Durchschnitte zeigen. Wenn das
aͤußere Gehaͤuse abgenommen ist, so arbeitet der Apparat folgender
Maßen. Wenn die Schale leer ist, oder wenn sich nicht die gehoͤrige
Quantitaͤt auf derselben befindet, so heben die an dem anderen Ende des
Waagebalkens befindlichen Gewichte die Waagschale in die Stellung empor, in der man
sie in Fig. 1
und 7 ersieht;
d.h. der Schwanz k des Druͤkers a kommt an die Seite des aͤußeren
Gehaͤuses j, und der Ring i in die Naͤhe des Scheitels des Gehaͤuses E. So wie sich die Waagschale aber fuͤllt, sinkt
dieselbe und der Druͤker so weit herab, bis der Schwanz k an dem Ende des Gehaͤuses j voruͤber gegangen, wo dann der aus dem
Druͤker hervorragende Arm l zwischen die Zapfen
c und o gelangt. m ist ein aus der Waagschale hervorragender
Aufhaͤlter (interceptor) m, gegen welchen sich der Zapfen n schiebt,
bis die Waagschale weit genug herabgesunken, oder bis sich der Druͤker a und der Hebel d in einer
Linie befinden, wie Fig. 2 und 3 zeigt. Ist dieß der
Fall, so befindet sich die gehoͤrige Quantitaͤt Kohle auf der
Waagschale; der Hebel D ist nun frei geworden, und indem
man den Griff F herabdruͤkt, wird das
laͤngere Ende des Hebels D emporgehoben, wodurch
der Zapfen c veranlaßt wird, auf den Arm l des Druͤkers zu wirken, und denselben so
emporzuheben, wie man ihn in Fig. 2 sieht. Dadurch wird
die Schale frei, sie schlaͤgt um und entleert ihren Inhalt; so wie man den
Griff aber loslaͤßt, wirb das an dem Ende des Hebels D befindliche Gewicht dieselbe wieder in ihre fruͤhere Stellung
zuruͤkfuͤhren.
Sollte zu viel Kohle in die Waagschale gebracht worden seyn, so wird der auf dem
Halsstuͤke der Roͤhre E ruhende Ring i, indem er die Feder f
zusammendruͤkt, bewirken, daß dieselbe herabsinkt; und durch diese Bewegung
wird der an dem Halsstuͤke h befindliche
Aufhaͤlter e in die aus Fig. 3 und 9 ersichtliche Stellung
herab gelangen: d.h. er wird hinter dem Zapfen c
hervorragen, und dadurch den Hebel D sperren und dessen
Bewegung verhindern. So wie jedoch die uͤberschuͤssige
Quantitaͤt Kohlen wieder von der Waagschale entfernt wird, wird die Feder f den Aufhaͤlter wieder emporheben und den Hebel
frei machen. Der Zapfen o bewirkt, daß der
Druͤker auf keine andere Weise, als durch den Hebel D befreit werden kann. p ist ein an der Waagschale befindlicher
Schraubenschluͤssel, womit der Haken q des
Griffes festgehalten werden kann, wenn der Apparat nicht benuzt wird. Statt die
Stange C mit Ketten aufzuhaͤngen, wie man dieß
aus der Zeichnung ersteht, kann man dieselbe auch bis zu dem fixirten Balken
verlaͤngern, und ihr unteres Ende mit dem Verdeke des Schiffes in Verbindung
bringen.
Der Apparat oder die Vorrichtung zur Erreichung des zweiten Theils der Erfindung des
Patenttraͤgers ist in einem Gehaͤuse enthalten, zu welchem der
Arbeiter keinen Zutritt hat, und welches mit einer der Achsen der Waagschale in
Verbindung gebracht ist. Die Bewegungen, welche die Waagschale beim Umschlagen und
Ausleeren der Kohle macht, sezen den zum Aufzeichnen und Registriren dienenden
Apparat in Thaͤtigkeit.
In Fig. 10
sieht man bei G diesen Apparat mit der Waage in
Verbindung gebracht, und mittelst eines Riegelhakens und Schlosses an dem
Buͤgel B befestigt. Fig. 11 zeigt den Apparat
fuͤr sich allein und in groͤßerem Maßstabe; sein Dekel oder das zu
demselben fuͤhrende Thuͤrchen ist geoͤffnet, damit man das
Innere sehen koͤnne. Fig. 12 ist eine
aͤhnliche Ansicht, an der jedoch die Zifferblaͤtter abgenommen sind,
damit das Raͤderwerk um so deutlicher sichtbar werde. Fig. 13 ist ein
senkrechter Durchschnitt durch den Apparat mit geschlossenem Dekel oder
Thuͤrchen.
Im Ruͤken des Gehaͤuses befindet sich eine Oeffnung, welche zur
Aufnahme des vierekigen Endes der Achse der Waagschale, welches aus dem an der
Waagschale befindlichen Halsstuͤke hervorragt, dient. Dieses vierekige Ende
paßt in eine entsprechende Oeffnung in der Achse a,
welche sich in dem Gehaͤuse in Zapfenlagern dreht. An dieser Achse oder Welle
befindet sich ein Federdaͤumling b, welcher, so
wie sich die Waagschale umschlagt, zugleich mit der Welle a bewegt, und auf dem Kreisbogen, den er hiebei beschreibt, mit einem
Zahne des achtzaͤhnigen Sperrrades c in
Beruͤhrung kommt, wodurch dasselbe um den achten Theil seines Umfanges
umgedreht wird. Wenn hiedurch aufgezeichnet worden, daß eine Operation oder
Entleerung der Waagschale vollbracht worden, so kehrt der Daͤumling mit der
Waagschale A wieder in seine fruͤhere Stellung
zuruͤk, indem das Federgelenk desselben nachgibt, so daß sein Ende
uͤber dem Ruͤken des naͤchstfolgenden Sperrzahnes weggleiten
kann. Das Zuruͤkkehren des Rades c wird durch
einen Sperrkegel d verhindert. An der Welle des
Sperrrades c befindet sich ein Getrieb mit acht Zahnen
e, welches in ein Rad mit 60 Zaͤhnen f eingreift; und an der Welle dieses lezteren befindet
sich ein Getrieb mit 7 Zahnen g, welches in ein Rad mit
112 Zahnen eingreift. Hinter diesem Rade ist eine kreisrunde Scheibe i
angebracht, auf der sich in gleichen Entfernungen von einander 4 Zapfen befinden,
auf welche ein aus dem aͤußeren Rande des Zifferblattes k des Rades h
hervorstehender Zahn einwirkt. Die Wellen aller dieser Raͤder und Getriebe
drehen sich in dem Gehaͤuse in fuͤr sie bestimmten Zapfenlagern.
Der Apparat arbeitet auf folgende Weise. Wenn die Welle der Waagschale A das Raͤderwerk auf die beschriebene Weise in
Bewegung sezt, so wird jeder Hub auf dem Zifferblatte l
des Sperrrades c, auf welchem 8 Hube oder eine Tonne
eingezeichnet sind, angedeutet werden. Mittlerweile wirkt das Getrieb g des Rades f auf die
Zaͤhne des Rades h, und veranlaßt dasselbe zu
Umdrehungen und zur Andeutung der Tonnen auf dem Zifferblatte k. Hat das Rad h eine Umdrehung gemacht, so
wird der Zeiger auf dem Zifferblatte andeuten, daß 112 Tonnen abgewogen wurden. So
wie sich das Zifferblatt einer Umdrehung annaͤhert, kommt der an demselben
befestigte Zapfen mit einem der Zapfen der Platte i in
Beruͤhrung, und bewegt dadurch dieselbe allmaͤhlich, bis die auf dem
Zifferblatte m verzeichnete Zahl 112 der in dem
Thuͤrchen oder Dekel des Apparates befindlichen Oeffnung gegenuͤber
erscheint, wo dann der an dem Zifferblatte befindliche Zapfen bis zur
naͤchsten Umdrehung auf die Zapfen zu wirken aufhoͤrt.
Das Rad f dient auch dazu, um auf eine hoͤrbare
Weise anzudeuten, wenn 7 Tonnen uͤber die Waagschale gegangen. Es dreht
naͤmlich ein Rad n, durch welches ein Federweker
o aufgewunden wird. Die Zaͤhne des Rades n ragen bloß an der einen Haͤlfte uͤber
die Breite des Rades f hinaus, und an dieser
Haͤlfte ist ein Theil der Zaͤhne weggenommen, wie man in Fig. 13 bei
p sieht. Sobald das Rad f einen Umgang vollbracht hat, wird durch die Unterbrechung der
Zaͤhne an der einen Haͤlfte eine Hemmung und eine Luke erzeugt,
waͤhrend welcher das Rad n ablaufen kann. q ist ein Hammer, der auf die Gloke des Wekers
schlaͤgt.
Um die an jedem Tage vollbrachte Arbeit, oder die von dem Schiffe an verschiedene
Barken abgegebenen Quantitaͤten bemessen zu koͤnnen, greift das
Zahnrad r, welches 42 oder irgend eine andere durch 7
theilbare Anzahl von Zaͤhnen hat, in die Zaͤhne des Rades h. s ist ein an der Welle von r befestigtes Zifferblatt, welches mit Zahlen, die von 0 bis 42
fortlaufen, bezeichnet ist; diese Zahlen sieht man durch Oeffnungen, welche sich in
einer beweglichen, in dem Thuͤrchen oder Dekel angebrachten Platte befinden.
Das Zifferblatt s bewegt sich mit dem Rade h; am Anfange einer jeden Tagesarbeit oder beim Beginnen
des Beladens einer jeden Barke wird die Oeffnung auf o gedreht, und so wie die gewuͤnschte Zahl an der Oeffnung
erscheint, ist die Arbeit vollbracht.
In dem oberen Theile des Gehaͤuses und in Zusammenhang mit der Welle a ist ein kleiner Zaͤhlapparat u angebracht, damit, wenn ja an dem Hauptapparate ein
Fehler vorgeht, dieser hier verbessert werde. Dieser Apparat besteht aus einem
achtzaͤhnigen Sperrrade 1, auf welches ein an der Welle a befindlicher Daͤumling wirkt. An der Spindel
dieses Rades 1 befindet sich ein achtzaͤhniges Getrieb 3, welches in das mit
56 Zahnen versehene Rad 4 eingreift. An der Welle oder Spindel dieses lezteren ist
ein siebenzaͤhniges Getrieb 5 angebracht, welches in ein mit 49 Zahnen
ausgestattetes Rad 6 eingreift; und an der Welle dieses lezteren Rades befindet sich
endlich das zehnzaͤhnige Getrieb 7, welches in ein anderes, mit 49
Zaͤhnen beseztes Rad eingreift. An dem Sperrrade 1 ist ein Sperrkegel und ein
Faͤnger angebracht. Auf den Raͤdern befindet sich eine Platte mit drei
Zifferblaͤttern und Zeigern, welche andeuten, wie weit die Arbeit
fortgeschritten ist.
Fig. 14, 15 und 16 sind
aͤhnliche Darstellungen eines Apparates, welcher dieselben Resultate gibt,
dessen Bewegung aber etwas von jener, die oben bei Fig. 11, 12 und 13 beschrieben wurde,
verschieden ist. Gleiche Theile sind hier auch durch dieselben Buchstaben
angedeutet. Das Halsstuͤk a, der Daͤumling
b und das Sperrrad c
sind dieselben, wie an obigem Apparate. An dem Rade c
ist ein Daͤumling e angebracht, der bei jeder
Umdrehung das naͤchstfolgende Rad f in Bewegung
sezt, indem er auf einen der sieben Zapfen wirkt, die in gleichen Entfernungen von
einander im Umfange des Rades angebracht sind. An dem Rade f befindet sich ein Daͤumling g, der
auf aͤhnliche Weise auf die Zapfen des naͤchstfolgenden Rades h wirkt, so daß sich bei jedem Umgange des Zifferblattes
k ein Resultat von 196 Tonnen ergibt. Soll die
Maschine eine noch groͤßere Anzahl von Operationen registriren, so kann man
noch eine kreisrunde Platte, wie jene bei i in Fig. 12,
anbringen, an der sich eine gegebene Anzahl von Zapfen befindet, auf welche das
Zifferblatt k einwirkt.
Fig. 17, 18 und 19 zeigen eine
Methode jene betruͤgerischen Angaben zu verhindern, die dadurch
hervorgebracht werden koͤnnten, daß die Waagschale umgestuͤrzt wird,
waͤhrend sie leer oder nicht ganz gefuͤllt ist. An dem Buͤgel
B ist das Gehaͤuse p befestigt, welches man aus den Figuren 20, 21 und 22, in denen
die Waagschale fuͤr sich allein abgebildet ist, deutlicher ersieht. In diesem
Gehaͤuse befindet sich eine starke Feder q, die,
wie man aus Fig.
23 sieht, auf dem Boden desselben ruht. r ist
eine durch den Boden des
Gehaͤuses und durch die Feder gehende Stange, an deren oberem Ende sich ein
Halsstuͤk s befindet, welches auf den Scheitel
der Feder q druͤkt. An dem unteren Ende dieser
Stange ist ein Ring oder ein Zapfenlager t angebracht,
in welchem sich die Achse der Waagschale dreht, wie Fig. 24 zeigt. Man sieht
hier auch eine vierekige Schraubenmutter u, welche in
das in der Waagschale B angebrachte Fenster paßt, und
sich darin hin und her schiebt. v ist der vierekige
Theil der Achse der Waagschale, welcher in die Oeffnung der ersten Welle a des Registrirapparates paßt. Diese Welle ist hier, wie
man aus Fig.
25 und 26 ersieht, in ein Zapfenloch w eingesezt,
welches zu diesem Behufs in dem Gehaͤuse angebracht ist. Auf diese Weise ist
die Waagschale an der Feder q aufgehaͤngt; wenn
sie daher leer oder nur zum Theil belastet ist, so wird ihre Achse in Folge ihrer
Verbindung mit der ersten Welle des Registrirapparates diese leztere Welle und ihren
Federdaͤumling, wie Fig. 25 zeigt, so
emporheben, daß sie nicht auf das erste Sperrrad wirken kann. Bei dieser Einrichtung
kann also nur dann etwas gezaͤhlt oder aufgezeichnet werden, wenn die
Waagschale gehoͤrig belastet ist. Die Feder gestattet, daß die Waagschale,
ihre Achse und der Daͤumling im Falle der gehoͤrigen Belastung bis auf
den Grund des Fensters w herabsinken kann, wo dann auf
die oben beschriebene Weise die Einwirkung auf das erste Sperrrad Statt findet.
Hiebet wird jedoch eine Abaͤnderung der Einrichtung des Druͤkers und
des Hemmers noͤthig, obschon auch hier dieselben Theile angewendet werden,
weßhalb sie auch mit denselben Buchstaben bezeichnet sind, wie in Fig. 1, 2 und 3. Der Druͤker a ist umgekehrt, und der Federriegel b steigt so weit herab, daß er mit demselben in
Beruͤhrung kommt. Wenn die Waagschale emporgehoben ist, so koͤnnen der
Druͤker und der Riegel nicht mitwirken (s. Fig. 17); die Waagschale
ist daher mittelst eines anderen Zapfens y an der
inneren Seite der Waagschale in gehoͤriger Stellung befestigt (siehe Fig. 17 und
21). z ist ein an der Waagschale befestigter Federriegel,
welcher derselben gestattet, beim Zuruͤkkehren wieder ihre fruͤhere
Stellung einzunehmen; er hindert jedoch das Umschlagen derselben, bis der Riegel b, wie in Fig. 18, in den Bereich
des Druͤkers a kommt, wo dann der Federriegel z aufgehoͤrt hat, mit dem an dem Buͤgel
B befindlichen Zapfen y
in Beruͤhrung zu stehen, so daß der Druͤker a also seine oben beschriebene Wirkung ausuͤben kann. Auch der
Aufhaͤlter (interceptor) e muß eine veraͤnderte Stellung erhalten; er befindet sich
naͤmlich an der entgegengesezten Seite der Stange c, und durch das aus der Waagschale hervorragende Stuͤk * gegen
Beschaͤdigungen durch den Zapfen d
geschuͤzt. Es erhellt von selbst, daß die Zapfen c, o
hier ober und nicht unter dem Hebel D angebracht werden
muͤssen.
Fig. 27 und
28 zeigen
den Zaͤhl- und Registrirapparat G an der
zweiten Art der im Eingange erwaͤhnten Waagschalen angebracht. A ist die Waagschale und B
der Buͤgel. In der Naͤhe des Grundes der schiefen Flaͤche,
welche den Ruͤken der Waagschale bildet, ist ein Eisenblech oder eine Art von
Rost a angebracht, der sich, wie Fig. 29 zeigt, mit
Halsstuͤken oder Zapfen in den beiden Seiten der Waagschale bewegt. An diesem
Bleche oder Roste befindet sich ein Gegengewicht c,
welches, wenn es noͤthig seyn sollte, durch eine Feder unterstuͤzt
wird, um ersteres leichter in seiner Stellung zu erhalten. Wenn die Waagschale mit
Kohlen gefuͤllt ist, so druͤkt das Blech oder der Rost a gegen das Thuͤrchen, und so wie dieses
geoͤffnet wird, so wird ersteres durch die Entleerung des Inhaltes in die aus
Fig. 29
ersichtliche Stellung herabgedruͤkt; sind die Kohlen jedoch entleert, so
nimmt das Blech in Folge des angebrachten Gegengewichtes wieder seine
fruͤhere Stellung ein, wo das Thuͤrchen dann geschlossen werden kann.
Das vierekige Ende der Achse b des Bleches oder Rostes
a wird in die erste Welle des Registrirapparates
eingesezt, wodurch man also hier dieselben Resultate erhaͤlt, wie bei der
zuerst beschriebenen Art von Waagschalen. Bei der Anwendung des Apparates an dieser
Art von Waagschalen ist jedoch die Ordnung der Raͤder und des Mechanismus
eine umgekehrte.
Fig. 30 zeigt
eine Waagschale, so wie man sich ihrer gewoͤhnlich zum Waͤgen des
Salzes, beim Ausladen von Schiffsladungen und in vielen anderen Faͤllen
bedient, und an der obiger Apparat G gleichfalls mit
gutem Erfolge angebracht werden kann. Die Waagschale A
ist in einem Buͤgel B aufgehaͤngt, und
dreht sich beim Entleeren um eine Achse, von welcher die erforderliche Bewegung an
den Registrirapparat fortgepflanzt werden kann.
Fig. 31 zeigt
den Registrirapparat an einer Vorrichtung angebracht, die zum Messen irgend einer
Art von Gegenstaͤnden dient. A ist das an dem
Bande B befestigte Maaß; der Arm C hat bei D einen Zapfen oder eine Achse, die
sich in dem Tische E in Zapfenlagern dreht. An dem Ende
dieser Achse ist der Registrirapparat G angebracht, der
die Bewegungen des Maaßes beim Entleeren des Inhaltes desselben aufzeichnet.
Fig. 32 zeigt
einen Trog, wie man sich desselben gewoͤhnlich bedient, um Kanonenkugeln,
Kaͤse, Saͤke oder sonstige Artikel, die man uͤber schiefe
Flaͤchen hinabzulassen pflegt, um sie von einem Orte zum anderen zu schaffen,
hinein zu thun. A ist eine an der Achse B eingehaͤngte Fluͤgelthuͤre. An
jenem Ende des Troges C, an welchem die Guͤter
gewoͤhnlich abgegeben werden, hat die Achse B ein
vierekiges Ende, welches zur Aufnahme des Registrirapparates dient. D, D sind Stifte oder Zapfen, welche durch
Loͤcher gehen, die in den Stufen E, die das Ende
der Seiten des Troges bilden, angebracht sind. Es sind mehrere dergleichen
Loͤcher in diesen Stuͤken angebracht, damit man die Zapfen, je nachdem
es noͤthig ist, hoͤher oder niedriger stellen kann. F, F sind Oeffnungen in diesen Stuͤken E, durch welche die Achse B
geht. G ist ein Loch in dem Boden des Troges mit Zapfen,
durch welche die Muͤndung des Endes je nach Bedarf verkleinert oder erweitert
werden kann, indem die Gewinde H ein Zusammenziehen oder
Ausbreiten der Enden gestatten. Die Achse der Fluͤgelthuͤre ruht auf
dem Zapfen D. An dem vierekigen Ende der Achse ist der
Registrirapparat angebracht, der jedes Mal in Thaͤtigkeit kommt, sobald etwas
durch die Thuͤre geht.
Weitere Verbesserungen an den Vorrichtungen zum Waͤgen sieht man in Fig. 33, 34 und 35. Sie
bestehen in der Anwendung von Registrirapparaten und anderen Vorrichtungen zur
Bestimmung und zum Registriren des Gewichtes von Karren und Wagen mit ihrer Ladung
im Großen sowohl als im Detail, so wie auch zum Aufzeichnen der vollbrachten
Operationen. a, a sind Saͤulen oder Tragpfosten
fuͤr die Waage; b, b ist der belastete Hebel,
welcher sich um den Stuͤzpunkt oder um die Achse c dreht, die sich mit den Halsstuͤken d,
d in Zapfenlagern dreht, welche sich, wie man aus Fig. 36 sieht, in den
Saͤulen oder Pfosten befinden. Eines dieser Halsstuͤke ragt hervor,
und dient zur Aufnahme der Nabe des Rades e, e, welches
an demselben aufgezogen ist. Von der Nabe dieses Rades geht die vierekige Welle f, f aus, die zur Aufnahme des Registrirapparates dient,
wie dieß aus dem Durchschnitte in Fig. 36 erhellt. Das Rad
e muß leicht und groß seyn, und sowohl an dem
aͤußeren als an dem inneren Umfange des Reifens mir einer der Groͤße
entsprechenden Anzahl kleiner scharfer Zaͤhne versehen seyn. g ist ein an dem Hebel b
befestigter Federbolzen oder Riegel, an dessen Ende sich Zahne befinden, welche den
am aͤußeren Umfange des Rades e angebrachten
Zahnen entsprechen. h ist ein anderer aͤhnlicher
Federbolzen, welcher jedoch an der Saͤule oder dem Pfosten angebracht ist,
und dessen Zahne den an dem inneren Umfange des Rades e
befindlichen Zahnen entsprechen. Die Zaͤhne des Bolzens g werden mittelst der Feder dieses lezteren mit dem
Umfange des Rades in Beruͤhrung erhalten, waͤhrend die Feder des
Bolzens h die entgegengesezte Wirkung hervorbringt, so
daß die Zahne dieses Bolzens außer Beruͤhrung mit den Zaͤhnen des
Rades bleiben. i ist eine Stange, welche an der Platform
voruͤbergeht; ihr oberes Ende steht mit dem Arme des Hebels k in
Verbindung, waͤhrend von dem anderen Ende dieses Hebels eine Stange l auslaͤuft, welche in der Saͤule oder in
dem Pfosten ihr Lager hat, und von der sich um den vierten Theil des Umfanges des
Rades e herum ein Arm m
erstrekt. An diesem Arme m bewegt sich der Bolzen g, je nachdem der Hebel b
gehoben oder gesenkt wird. Die Stange l steht auch mit
dem Federbolzen h in Verbindung.
Fig. 34 zeigt
die Bewegung der Bolzen g und h zur Zeit, wo sich ein Wagen auf der Platform der Waage befindet. Der
Bolzen g befestigt das Rad e
an dem Hebel b, indem seine Zaͤhne mit jenen am
aͤußeren Umfange des Rades in Beruͤhrung stehen, waͤhrend der
Bolzen h von den Zaͤhnen des inneren Umfanges
zuruͤkgewichen ist. So wie nun die Stange i
angezogen wird, kommt der Hebel k in Thaͤtigkeit,
und es tritt folgende Wirkung ein. Die Feder des Bolzens g wird vorwaͤrts getrieben, so daß dessen Zaͤhne das Rad
festhalten; durch dieselbe Bewegung werden die Zaͤhne des Bolzens h von den am inneren Umfange des Rades befindlichen
Zaͤhnen zuruͤkgezogen. So wie aber das Gewicht wieder von der Platform
entfernt wird, so nimmt der Hebel b, wieder seine
ruhende Stellung ein, wobei er das Rad e mit sich
fuͤhrt, und also dasselbe veranlaßt einen Kreisbogen zu beschreiben, der mit
dem auf die Platform gebrachten Gewichte im Verhaͤltnisse steht. Wenn nun
hierauf die Stange i nachgelassen wird, so weicht der
Bolzen g von den Zahnen des aͤußeren Umfanges des
Rades zuruͤk, waͤhrend die Zaͤhne des Bolzens h bis zur naͤchstfolgenden Operation mit den
Zahnen des inneren Umfanges in Beruͤhrung bleiben. Der Registrirapparat ist
an der Achse f des Rades e
befestigt, und durch dessen Bewegung, d.h. durch die rotirende Bewegung des Rades
e, waͤhrend es mit dem Bolzen g in Beruͤhrung steht, wird die Operation
verzeichnet.
Da das Rad e eine Kreisbewegung, und nicht bloß, wie an
der obigen Maschine eine Bewegung durch einen Kreisbogen hat, so ist in dem Baue des
Registrirapparates eine kleine Abaͤnderung noͤthig, um denselben auch
hier anwendbar zu machen. In Fig. 37 ist n ein Zifferblatt, an dessen Achse sich eine vierekige
Oeffnung befindet, die zur Aufnahme der Achse f des
Rades e dient. o ist ein
Getrieb mit 10 Zaͤhnen, welches in das 100 zaͤhnige Rad p eingreift, und an der Welle dieses Rades p befindet sich q,
gleichfalls ein Getriebe mit 10 Zaͤhnen, welches in ein anderes Rad r eingreift. Die Zahl der Zaͤhne dieses Rades
richtet sich danach, wie weit man das Zaͤhlen treiben will. Wenn nun der
Registrirapparat mit dem Rade e in Verbindung gebracht
worden, so tritt folgende Wirkung ein. Das Rad e haͤngt,
wie oben gezeigt worden, von der Bewegung des Hebels b
ab; und so wie dieser Hebel je nach dem auf die Platform gebrachten Gewichte
emporgehoben wird, und so wie er bei der Entfernung dieses Gewichtes wieder in seine
fruͤhere Stellung zuruͤkkehrt, so muß nothwendig in denselben Radien
auch eine entsprechende Bewegung des Zifferblattes n
erfolgen; die Registrirung des Gewichtes geschieht also je nach der Zahl der
Zaͤhne des Rades e, die in Folge der Statt
gehabten Bewegung voruͤbergegangen sind. Den Index und einen Theil des
Zifferblattes sieht man in Fig. 37 auch in einem
groͤßeren Maaßstabe.
Das Registriren der verschiedenen Betrage der einzelnen Waͤgeprocesse in ihrer
respectiven Ordnung wird auf folgende Weise vollbracht. A ist ein in Fig. 35 und 36
ersichtliches Trommelrad, welches an der Welle f
aufgezogen ist, und sich mit dem Rade a umdreht. u, u ist ein langer Streifen aus Pergament oder aus
einer anderen Substanz, an dessen beiden Enden sich ein Gewicht befindet, und der
ein oder mehrere Male um die Trommel t laͤuft; er
geht durch Oeffnungen, welche in hervorragenden Zapfen, die ihm als Fuͤhrer
dienen, zu diesem Behufe angebracht sind. In dem dem Hebel b zunaͤchst liegenden Zapfen, und dem fuͤr den
Pergamentstreifen bestimmten Ausschnitte gegenuͤber ist an dem Hebel b eine kleine Oeffnung angebracht; eben so ist in dem
Bogen dieser Oeffnung ein kleiner Einfall v angebracht.
Wenn nun der Hebel b emporsteigt, so steigt auch der
Einfall mit ihm empor; beim Zuruͤkkehren dreht sich das Trommelrad in
entsprechendem Maaße, und dadurch steigt das an dem einen Ende des
Pergamentstreifens angebrachte Gewicht w empor,
waͤhrend das an dem anderen Ende angebrachte Gewicht x herabsinkt. So wie sich nun der Zapfen oder Einfall v in Folge der Ruͤkkehr des Hebels in seine
ruhende Stellung der Saͤule oder dem Tragpfosten a naͤhert, faͤllt er in die in den Leitungszapfen
angebrachte Oeffnung y, und schlaͤgt ein Loch aus
dem Pergamente aus. Da bei jedesmaliger Operation immer dasselbe geschieht, so wird
die Zahl der Operationen durch die Zahl der ausgeschlagenen Loͤcher
angedeutet; das Verhaͤltniß der Entfernungen dieser Loͤcher von
einander zu dem Umfange des Rades bestimmt beilaͤufig ihre respective
Quantitaͤt in der Ordnung, in welcher das Wagen Statt fand, wie man aus einer
zu diesem Behufe abgefaßten Scala entnehmen kann. Das Registriren der Zahl der Wagen
oder Karren, die uͤber die Platform gingen, geschieht mittelst des Apparates
z, welcher an dem vierekigen Ende der Achse c des Hebels b angebracht
ist. Dieser am Ruͤken der Saͤule oder des Tragpfostens befindliche
Apparat besteht bloß aus dem ersten Theile des Registrirapparates, so wie er oben fuͤr die
Waagschale beschrieben worden. Er hat naͤmlich eine aͤhnliche Welle
a mit einem Daͤumlinge b (Fig.
38), welcher auf ein Sperrrad c wirkt, an
welchem eine beliebige Anzahl von Zahnen angebracht ist. Da der Hebel b hier, wie an der Waagschale A, bloß einen Kreisbogen beschreibt, so wird bei jeder Operation bloß eine
Zahl registrirt.
Fig. 39 ist
ein theilweiser Durchschnitt, woraus man den vor dem Trommelrade t befindlichen Registrirapparat ersieht.
Tafeln