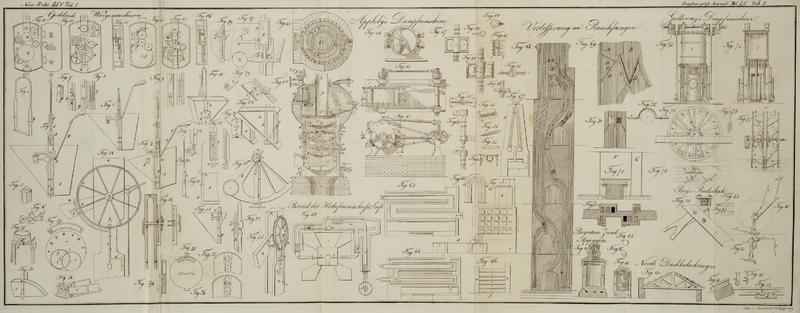| Titel: | Ueber den Betrieb der Hohöfen mit heißer Luft. Von Professor C. B. |
| Autor: | Prof. Christoph Bernoulli [GND] |
| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. VIII., S. 38 |
| Download: | XML |
VIII.
Ueber den Betrieb der Hohoͤfen mit heißer
Luft. Von Professor C. B.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Ueber den Betrieb der Hohoͤfen mit heißer Luft.
A. Faktischer Theil.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erzeugte England kaum 18,000 Tonnen Eisen, und
war nahe daran, alle seine Hohoͤfen einstellen zu muͤssen, weil
Holzmangel die Productionskosten bald unerschwinglich machte. Jezt erzeugt es
jaͤhrlich uͤber 600,000 Tonnen Roheisen, so viel ungefaͤhr als
das uͤbrige Europa zusammengenommen, und kein Land vermag das Eisen
wohlfeiler zu liefern, als das theure England. Einer dreifachen Erfindung verdankt
es hauptsaͤchlich diese wunderbare Wendung jenes Gewerbzweiges: der Kunst
naͤmlich mit destillirten Steinkohlen oder Kohks das Erz zu schmelzen, der
Erfindung der Cylindergeblaͤse, und der Vervollkommnung der Dampfmaschinen.
Denn nun stand seinem unermeßlichen Reichthume an Erz ein eben so
unerschoͤpflicher an Brennstoff zur Seite, um solches zu gute zu machen und
zu verarbeiten, und nun erst hatte es Mittel, um der Unternehmung die groͤßte
und vortheilhafteste Ausdehnung zu geben, und uͤberall und wohlfeil die
noͤthige Kraft, um diese Mittel anzuwenden. So kam es, daß Wales die Tonne
Gußeisen (20 Cntr. zu 112 Pfd.) vor 10 Jahren schon zu 3 1/2–4 Pfd. Sterling
(42–48 fl.) zu liefern vermochte. Und wie diese Erfindungen von England
ausgingen, so profitirten sie auch fast ausschließlich diesem Lande. Erst in neuerer
Zeit wurden sie hie und da auch auf dem Continente aufgenommen.
Kaum indessen hatte man angefangen diese Fortschritte in andere Laͤnder zu
verpflanzen, als England mit einem neuen Verfahren auftrat, das den Eisenwerken
neuerdings fast unglaubliche Vortheile verspricht. Es besteht dieses darin, daß man
die Hohoͤfen nicht wie bisher mit kalten, sondern mit vorerst erhizter Luft speist oder betreibt; da bei dem Einblasen von
heißer Luft das Schmelzen des Erzes nicht nur ungleich weniger Brennstoff als vorher
erfordert, sondern da nunmehr auch die rohe Steinkohle zur Schmelzung geeignet ist.
Bei diesem Verfahren soll ferner derselbe Ofen um ein Bedeutendes mehr Eisen
erzeugen, und es soll an Wind so wie an Zuschlag erspart, und uͤberdieß das
Eisen besser werden. Es soll endlich dasselbe Verfahren auch auf andere
Schmelzprocesse, und namentlich auf die Umschmelz- oder Cupolooͤfen
anwendbar seyn.
Beruht das Ebengesagte auf keinerlei Taͤuschung, so muß offenbar die
Einfuͤhrung dieser neuen Schmelzmethode
fuͤr Englands Wohlstand von außerordentlichem Nuzen seyn. Denn wie
unerschoͤpflich auch seine Kohlenlager scheinen, bei dem unermeßlichen und
immer steigenden Consum dieses Materials muß doch zulezt eine Abnahme dieser
Vorraͤthe fuͤhlbar werdenDie Erzeugung von 1 Tonne Gußeisen kostete bis dahin auf den Glasgower
Huͤtten an 7 Nonnen Steinkohlen. Nach diesem Verhaͤltnisse
verzehrt die bloße Production von 600,000 Tonnen Roheisen uͤber 4
Mill. Tonnen oder 80 Mill. Cntr. Steinkohlen!; und jedenfalls muß aus jener Ersparniß eine so namhafte Verminderung der
Productionskosten hervorgehen, daß der Preis des Eisens noch um ein Bedeutendes
herabgesezt werden kann.
Von nicht minderer Wichtigkeit ist aber diese Erfindung auch fuͤr den Continent, ja von einer groͤßeren wohl als alle
fruͤheren, und von einer groͤßeren, sogar fuͤr viele Gegenden,
als fuͤr England selbst. Denn waͤhrend jene Erfindungen fast
ausschließlich nur den Betrieb der Oefen mit Steinkohlen beguͤnstigten, ist
diese neue mit aͤhnlichem Vortheile auf alle Oefen, auch auf
Holzkohloͤfen also, an wendbar. Und da ferner bei vielen unserer Eisenwerke der
Brennstoff nicht wie in England den geringeren, sondern vielmehr den bedeutenderen
Theil der Productionskosten ausmacht, so muß eine Erfindung, die den Bedarf an
diesem Materiale um Vieles vermindert, sich verhaͤltnißmaͤßig ungleich
vorteilhafter noch fuͤr uns erweisen.
Unverzeihlich waͤre es daher, wenn dieses neue Schmelzverfahren nicht bald und
allgemein auch in Deutschland angenommen wuͤrde; wenn man stolz etwa auf
gewisse Vorzuͤge des Holzkohleneisens auch diese Vorschritte der englischen
Industrie zu verachten affectirte; oder wenn man behaglich abwartete, bis nirgends
mehr unsere Eisenpreise mit den englischen Concurrenz halten koͤnnten; und
dann wohl gar zur Rettung unserer Werke nur immer noch hoͤhere Zoͤlle,
als Praͤmie unserer Traͤgheit, verlangen wollte. Um so unverzeihlicher
waͤre eine solche Gleichguͤltigkeit, wenn die Neuerung ohne Gefahr und
ohne bedeutende Kosten versucht werden kann.
Bevor indessen irgend eine Erfindung mit Recht empfohlen werben darf, muß allerdings
mit aller Behutsamkeit untersucht werden, ob und in wie weit die von ihr
geruͤhmten Vortheile sich wirklichwirklch bestaͤtigen, und ob denselben nicht mehr oder minder große
Nachtheile zur Seite stehen. Denn nur zu oft beruhen selbst die gepriesensten auf
einer Taͤuschung. Wir versuchen daher zusammenzustellen, was sich aus den
bisherigen Berichten uͤber den Betrieb der Hohoͤfen mit heißer Luft
als zuverlaͤssige Thatsache ergeben hat. Wir entlehnen die Angaben namentlich
aus den (amtlich abgefaßten) Abhandlungen von Dufresnoy,
Gueymard und Voltz im vierten Baude der Annales des Mines.
Sur l'appareil à chauffer le vent parVoltzp. 77.Sur la conduite des hauts-fourneaux à
l'air chaud parGueymard. p.
87.Sur l'emploi de l'air chaud etc. parDufresnoy. p.
431–500.do. par Gueymard. p. 500.
Das neue Verfahren besteht bekanntlich darin, daß man den Wind nicht unmittelbar aus
dem Geblaͤse in den Ofen fuͤhrt, sondern daß man ihn zuvor durch
(gluͤhend) heiße Roͤhren von Gußeisen streichen laͤßt, so daß
bedeutend heiße Luft in den Ofen eingeblasen wird. Zuerst wurde dieses Verfahren im
Jahre 1830 auf den Clydeworks bei Glasgow von den HH. Niellon, Makintosh und Wilson
angewendet.
Anfangs wurde die Luft in einem kleineren Apparate auf 200–280° F.
(93–137° C.) erwaͤrmt. Jezt wird sie aus dem Blascylinder durch
eine 150' (engl.) lange und 19'' weite Roͤhre von Gußeisen getrieben, die in
2 Armen nach den beiden Duͤsen des Ofens fuͤhrt. (Fig. 62.) Die
Roͤhre a liegt in einem Canale von Baksteinen,
der als Rauchgang dient, und in einen hohen Schornstein ausmuͤndet. Sie geht
durch 5 heiße Oefen, oder Feuerherde b, und ist, wo sie
im Feuer liegt, mit Baksteinen umgeben. Derselbe Cylinder betreibt, von einer
70pferdigen Dampfmaschine in Gang gesezt, 4 Hohoͤfen, wovon jeder einen
solchen Hizapparat hat. Er schoͤpft per Minute
8460 Kubikfuß Luft, und liefert jedem Ofen also per
Minute 2120 K.' frische Luft, die auf 300° C. erwaͤrmt etwa das
doppelte Volumen bilden. 3 dieser Hohoͤfen waren bereits im Gange, als jene
Apparate damit verbunden wurden, und erhielten von demselben Cylinder 1/3 mehr Wind,
oder per Minute 2825 K.' – 1831 wurde er auf
450° F. (232° C.) erwaͤrmt, und die Oefen noch mit Kohks
betrieben.
1833 wurde der Wind auf 612° F. (322° C.) erhizt, und das Schmelzen mit
roher Steinkohle bewirkt.
1829 producirten die 3 Oefen (mit kalter Luft) in 24 Stunden: 17 3/4 Tonnen Guß
(jeder 6 T.) und verzehrten in dieser Zeit 53 T. Kohks (= 111 T. Steinkohlen)2 Tonnen Steinkohlen geben in Glasgow kaum 11/12 Tonnen Kohks. 31 1/2 T. geroͤstetes Erz und 9 1/2 T. Zuschlag.
1833 lieferten die 4 Oefen (mit 322° C. heißer Luft) 36 T. Guß (jeder 9 T.)
und verzehrten 72 1/4 T. Steink. 68 T. Erz und 11 T. Zuschlag.
Außerdem verbrauchte das Geblaͤse in beiden Jahren circa 18 T. Steink. und im
zweiten die Windheizung noch etwa 15 T.
Ueberhaupt kostete die Erzeugung von 1 Tonne Guß an Steinkohlen:
1829 (mit kalter Luft) 7 1/2 T. und 10 1/2 Cntr. Zuschlag.
1831 (mit Luft von 450° F.) 5 T. und 9 Cntr.
–
1833 (mit Luft von 612° F.) 3 T. und 7 –
–
Die Ersparniß an Steinkohlen stieg also auf 3/5 oder 60 Proc. Die Erzeugungskosten
(im Ganzen aber) verminderten sich von 77 Schilling auf 50 oder um 35 Proc.
––––––––––
Schon die ersten Versuche in obigen Werken hatten einen so viel versprechenden
Erfolg, daß mehrere andere das Einblasen von heißer Luft einfuͤhrten. In
demselben Jahre (1830) schon wurde diese Methode in den benachbarten Werken von Calder angenommen; und im Sommer 1833 fand Dufresnoy, der von der franzoͤsischen Regierung zu
dem Ende nach Schottland und England geschikt worden, dieselbe bereits auf 21
Eisenwerken (mit 67 Hohoͤfen) angewandt. Der Luftheizapparat hat bei den
meisten eine abweichende Einrichtung, die Resultate sind aber bei allen im Wesentlichen dieselben.
1) Das Schmelzen erfordert ungleich weniger
Brennstoff.
Die Ersparniß ist um so groͤßer, je staͤrker die Luft erhizt wird,
und noch bedeutender, wenn man dann statt der Kohks rohe Steinkohle
gebraucht.
Zu Calder kostete die Erzeugung von 1 Tonne Guß bei
kalter Luft 7 3/4 T. Steink. und in Summa 8 1/4 T. Mit Luft von 300° F.
(und Kohks) 4 3/4 T. und in Summa, d.h. die Geblaͤse und Hizkohlen
inbegriffen, 2 1/2 T.
Zu Monkland fruͤher 7–8 Tonnen
Steinkohlen. Jezt mit Kohks und Luft von 450° F. 4 1/4–4 1/2
T.
Auf 2 Werken bei Newcastle, fruͤher 7 T., jezt
(mit Kohks und Luftk. 400°) 4 1/3 T.
Bei Manchester, ehemals 6 T., jezt 3 1/4 T.
Zu Butterley (bei Derby), fruͤher 5 4/5 T.,
jezt 3 T. (in Summa); die Luft wird 360° heiß.
Zu Cadnor, fruͤher 5 T., jezt 2 3/4 T. (6 Cntr.
fuͤr die Heizung inbegriffen.)
Zu Birmingham, fruͤher 5 1/2 T., jezt 2 3/4
T.
Zu Wartag (in Wales), ehemals 4 1/8 T., jezt 3 T. (Der
Heizapparat ist mangelhaft und die Hize kaum 400°Die Ungleichheit des Kohlenbedarfs zum Schmelzen von 1 Tonne Eisen mit
gewoͤhnlicher Luft) ruͤhrt hauptsaͤchlich von der
verschiedenen Qualitaͤt der Steinkohlen her. Einige geben weit
mehr Kohks als andere. (Die sehr magern von Wales z.B. an 70 Proc.)
Ueberdieß mag bei einigen Angaben der Verbrauch fuͤr das
Geblaͤse nicht mitgerechnet seyn.
2) Das Verkohken der Steinkohle wird entbehrlich.
Fruͤher wurden alle englischen Hohoͤfen mit Kohks betrieben. Sich
der rohen Kohle zu bedienen hielt man fuͤr unmoͤglich. Jezt werden
in den meisten Werken, wo die Heizung des Windes eingefuͤhrt ist, rohe Steinkohlen aufgeschuͤttet. Das
vorlaͤufige Roͤsten der Kohlen, wodurch natuͤrlich viel
Brennstoff verschwendet wird, wird also entbehrlich, und daraus geht dann auch
die oben erwaͤhnte noch weit betraͤchtlichere Ersparniß
hervor.
Aus den spaͤteren Erfahrungen ergibt sich indessen:
1) Daß in der Regel die Hize des Windes wenigstens auf 5–600° F.
gesteigert werden muß, wenn der Ofen mit roher Kohle betrieben werden soll, und
daß sich also Oefen, die nicht so heißen Wind anwenden (wie die zu Monkland
u.a.), der Kohks bedienen mußten.
2) Daß einige (sehr fette, sich aufblaͤhende und stark klebende)
Steinkohlen auch bei dieser Hize des Windes sich unbrauchbar erweisen, und
verkohkt werden muͤssen.
3) Daß umgekehrt hingegen gewisse sehr magere Kohlenarten (wie namentlich die von
Wales) roh, selbst ohne Erhizung des Windes zum Betriebe der Hohoͤfen
tauglich sind; so daß dann auch mit kalter Luft schon eine bedeutende Ersparniß
an Brennstoff gegen vormals erhaͤltlich ist; und die Heizung des Windes,
wiewohl immer vortheilhaft, doch minder unerlaͤßlich wird.
3) Man braucht weniger und nicht staͤrkeren
Wind.
Bei den meisten der obigen Werke konnte nach Einfuͤhrung der heißen Luft
dasselbe Cylindergeblaͤse 4 statt 3 Oefen mit Wind versehen, und die
Pression war meist eher vermindert als vermehrt.Aus dieser Reduction des Windbedarfs geht natuͤrlich auch eine
Minderung von Brennstoff hervor, die jedoch nicht sehr bedeutend ist, da
fuͤr die Dampfmaschine meist eine geringe Kohle oder Kohlenkleie
verwendet wird, die nicht halb so theuer als ganze Kohle ist.
Bei den Calderworks schoͤpft der Cylinder per Minute fortdauernd 10500 K.' Luft; jeder der 3
Hohoͤfen erhielt also fruͤher 3500', waͤhrend einer jezt
nur 2624 erhaͤlt; und die Pression (am Manometer) war fruͤher 3
1/4 Pfd. per □'', und betraͤgt jezt
nur 2 3/4 Pfund.
Bei Butterley wurde der Durchmesser des Cylinders von
70 auf 80'' vergroͤßert (also im Verhaͤltniß von 49 : 64), statt 2
Oefen werden aber jezt 3 betrieben, und jeder erhaͤlt per Minute nur 2150 statt 2500 K.' per Minute. Der Druk ist beibehalten.
Bei den Birminghamoͤfen wurde er hingegen von 3
1/2 Pfd. auf 2 3/4, bei Monkland von 3 auf 2 3/4 Pfd.
vermindert.
Da die Luft durch die Hize ausgedehnt wird, so bringt man bloß
verhaͤltnißmaͤßig weitere Formen an.
Bei den Clydeoͤfen betraͤgt ihr
Durchmesser jezt 3 statt 2 1/2''; der Querschnitt ist also im
Verhaͤltnisse von 2 : 3 (25 : 36) groͤßer. Die Menge Luft verhalt
sich naͤmlich (nach Obigem) wie 2100 K.' : 2800 und das Volumen (bei
doppelter Ausdehnung der heißen) etwa wie 4200 : 2800 oder wie 3 : 2.
Den Widerstand, den die Reibung beim Durchgange durch so lange Heizrohre
verursacht, schaͤzt man nur auf 1/10.Demnach muͤßte indessen doch der Druk etwas groͤßer seyn,
und mit obigen Angaben scheint es daher in einigem Widerspruch, daß die
Pression noch vermindert seyn soll.
4) Das Schmelzen erfordert weniger Zuschlag.
Auf den Clydewerken kostete die Erzeugung von 1 Tonne
Guß fruͤher 10 1/2 Cntr. Zuschlag; bei einem Winde von 450° waren
9, und bei einem Winde von 612° sind jezt 7 Cntr. hinreichend.
Zu Calder war der Zuschlag bei kalter Luft 13 Cntr.,
bei 300° heißer 12 1/2 Cntr., und bei 612° heißer nur 5 1/2
Cntr.
Bei Manchester betraͤgt er jezt nur 4 Cntr.
Zu Butterley blieb die Quantitaͤt
ungefaͤhr dieselbe (1 T.), da das Erz sehr viel Schwefel enthaͤlt.
Die fast allgemein sich ergebende Verminderung des Flußmittels bringt an sich
eine nicht geringe Ersparniß mit sich, und beweist uͤberdieß, daß bei dem
neuen Verfahren die Temperatur des Ofens bedeutend erhoͤht seyn muß.
5) Jeder Ofen erzeugt weit mehr Eisen.
Wir sahen, daß nicht nur dasselbe Geblaͤse an den Clydewerken nun 4 Oefen
statt ihrer 3 versieht, sondern daß jeder Ofen nun taͤglich 9 statt
fruͤher 6 Tonnen producirt.
Zu Calder stieg die taͤgliche Erzeugung per Ofen von 5 T. 12 Cntr. auf 8 T. 4 Cntr.
Dasselbe Ergebniß zeigt sich mehr oder weniger bei allen Werken mit heißer
Luft.
––––––––––
Vielfache Erfahrungen bestaͤtigen hiemit bereits die
uͤberraschenden Vortheile, die mit der
Anwendung einer heißen Luft, zumal wenn sie bis 610° F. (320° C.)
erhizt wird, beim Betriebe der Hohoͤfen verbunden sind. Laßt uns nun
sehen, ob diese nicht etwa durch mancherlei wesentliche Nachtheile zum Theil wenigstens aufgewogen werden duͤrften.
Allerdings macht vorerst die Hizung des Windes einen
besonderen Apparat noͤthig; und diese
Construction soll fuͤr jeden Hohofen an den Clydewerken auf etwa 200; zu
Calder auf circa 130 Pfd. Steinkohlen gekommen seyn.
Die Heizofen muͤssen lang und weit, und wenigstens 1'' dik seyn. Es
scheint indessen, daß sie weit laͤnger dauern, als man besorgen mochte,
und uͤberdies lassen sich unbrauchbar gewordene einschmelzen. Ferner ist
die Construction schon so weit gelungen, daß sie Monate lang keinerlei
Reparaturen erfordern. Weder die Errichtung noch der Unterhalt dieses Apparates
kann also einen namhaften Einfluß auf die allgemeinen Kosten haben.
Eben so kommt nach Obigem der erforderliche Aufwand an Heizkohlen kaum in Betracht. Fuͤr die Tonne Eisen, die erzeugt
wird, kostet die Heizung selten uͤber 8 Cntr. Kohlen, waͤhrend in
der Regel an
Schmelzkohlen 3–4 Tonnen (60–80 Cntr.) erspart werden. Auch zu
diesem Zweke koͤnnen ferner ganz geringe Kohlen dienen. Wir werden
endlich sehen, daß sogar nicht ein Mal ein besonderer Aufwand dazu
unumgaͤnglich noͤthig heißen mag, sondern daß sich zur Heizung
wohl auch die aus der Gicht aufsteigende Hize benuzen laͤßt.
Man hat ferner besorgt, daß die Anwendung der heißen Luft mancherlei Schwierigkeiten und Stoͤrungen veranlassen moͤchte. Obschon jedoch
wahrscheinlich bei diesem System eine etwas abweichende Construction des
Hohofens zutraͤglich seyn duͤrfte, so ist, wie alle obigen
Erfahrungen zeigen, eine Abaͤnderung durchaus nicht nothwendig. In den
meisten Faͤllen wurde der Betrieb mit heißer Luft bei Oefen
eingefuͤhrt, die bereits seit lange, ja seit mehreren Jahren schon im
Gange waren. Die heiße Luft erfordert bloß eine andere Beschickung, ein anderes
Verhaͤltniß der Gichten (an Kohle, Erz und Zuschlag). Es kann daher auch
eine Unterbrechung des Heizprocesses keine wesentliche Stoͤrung zur Folge
haben; sie wird nur eine aͤhnliche Aufmerksamkeit erfordern, wie etwa das
Aufgeben anderer Erze etc. Allerdings ist eine immer gleiche Erhizung der Luft zu wuͤnschen, dieß wird aber leicht
zu erreichen seyn, wenn man in der Naͤhe der Blaseroͤhren
geeignete thermometrische Vorrichtungen anbringt. Bei diesem Systeme
laͤuft ferner die Form Gefahr zu schmelzen; dieß ist aber dadurch zu
verhindern, daß man sie (wie bei Cupolooͤfen) in eine Roͤhre
einschließt, durch welche kaltes Wasser fließt. Da sich uͤbrigens an der
Form nicht leicht Schlaken. (eine Nase) ansezen, weil sie heißer und
fluͤssiger sind, so kann jene dicht in das Formloch eingepaßt werden, so
daß dadurch keine kalte Luft einziehen kann.
Da ohne Zweifel die Ofenhize betraͤchtlich staͤrker ist, so hat man
nicht ohne Grund befuͤrchtet, es mochte das Gestelle etc. sehr schnell zerstoͤrt werden. Die bisherigen
Berichte erwaͤhnen indessen noch nicht einer solchen Wirkung, und
laͤngere Erfahrung nur mag also lehren, in wie weit jener Nachtheil Statt
finde.
Daß das mit heißer Luft erzeugte Eisen geringer seyn
soll, wie Manche behaupteten, ist unstreitig ein Vorurtheil. Es ist vielmehr so
viel als erwiesen, daß die Qualitaͤt eher dadurch verbessert wird.
Bestimmte Versuche uͤber die Zaͤhigkeit, Festigkeit etc. dieses
Eisens sind uns zwar nicht bekannt, allgemein wird aber angegeben, daß
waͤhrend sonst jedes Abstechen zur Haͤlfte ungefaͤhr graues
und weißliches Roheisen lieferte, jezt an ersterem ungleich mehr erhalten wird.
Unstreitig ist dieses Eisen auch duͤnnfluͤssiger und daher zu
Gußwaaren tauglicher; und haben die Eisenwerke nach Einfuͤhrung der heißen Luft ihre
Preise bedeutend herabgesezt, so geschah dieß, weil einerseits die
Erzeugungskosten um Vieles vermindert wurden, andererseits die große Vermehrung
des Productes einen staͤrkeren Absaz erheischte.
Es kann endlich auch daraus kein Beweis gegen die reellen Vorzuͤge des
neuen Verfahrens hergeleitet werden, daß einige Werke, und namentlich die
Suͤdwallis'schen, dasselbe wohl versucht, aber nicht beibehalten haben.
Dufresnoy zeigt, daß sich dieß aus besonderen
Umstaͤnden hinlaͤnglich erklaͤre. Abgesehen
naͤmlich, daß man die Versuche mit mangelhaften Heizapparaten anstellte,
die ein minder guͤnstiges Resultat gaben, kam man dadurch zugleich auf
die wichtige Entdekung, daß eben die Wallis'schen Steinkohlen unverkohkt auch
ohne heiße Luft brauchbar sind; und so wurde denn bereits ein sehr bedeutender
Vortheil erhalten. Man verzichtete nun aber um so mehr auf einen noch
groͤßeren (den ohne Zweifel auch hier die Anwendung der heißen Luft
gewaͤhrte), weil einerseits die dortigen Steinkohlen besonders wohlfeil
sind, und andererseits den Patenttraͤgern fuͤr die Benuzung ihres
Patentes ein Betraͤchtliches (1 Schill. per
Tonne) bezahlt werden muß.
Andere Anwendungen des gehizten Windes.
Das vorliegende System ist eine um so wichtigere Erfindung, da es sich auch auf
Cupolooͤfen, auf Holzkohlenhohoͤfen, und sehr wahrscheinlich auch bei
manchen anderen Schmelzprocessen mit aͤhnlichem Vortheile anwenden
laͤßt.Daß es selbst bei Kesselfeuern vortheilhaft seyn soll, scheint vorerst noch
zu bezweifeln.
Aus den obgedachten Berichten erhellt, daß in England schon vielfach sogenannte Cupolo- oder Wilkinson-Oefen mit heißer Luft betrieben werden, und zwar, indem
die Luft in Roͤhren, die uͤber dem Ofen angebracht sind, geheizt wird,
so daß die Erwaͤrmung kein eigenes Feuer erheischt. Zu Newcastle kostet das
Umschmelzen von 1 Tonne Gußeisen nur 280 Pfd. Kohks (8 Proc.) und bei Birmingham nur
260 Pfd. Da nicht angegeben ist, wie viel solches fruͤher erforderte, so ist
nicht zu ersehen, wie viel Brennstoff erspart wird. Ohne Zweifel ist die Ersparniß
um so groͤßer, da die Waͤrmung keinen Mehraufwand verursacht. Ein
zweiter sehr erheblicher Vortheil besteht aber noch darin, daß eine Schmelzung nun
in der halben Zeit, in 20 Minuten statt in 40, verrichtet werden kann.
Die Anwendung bei Schmiedefeuern (und Finery), obschon
diese Nielson empfahl, scheint bis dahin noch keinen
entschieden guͤnstigen Erfolg gehabt zu haben.
Erfahrungen in anderen Laͤndern.
Auch außer England ist das Einblasen heißer Luft schon hie und da versucht, und der
Nuzen dieses neuen Verfahrens, und zwar auch bei Holzkohlenoͤfen, mehr oder
weniger bestaͤtigt worden.
In Frankreich wurden die ersten Versuche zu Fourchambault
gemacht, und neuere auf den Eisenwerken bei Vienne, Voulte, Rimpéroux (bei
Grenoble) u.a.
Zu Vienne ergab sich, daß der Bedarf an Kohks von 251
Kilogr. auf 146 per 100 Gußeisen vermindert wurde; oder
nach spaͤteren Berichten von 550–600 Kilogr. roher Steinkohlen auf
circa 400 (also nun um 30 Proc.), und daß ein Ofen taͤglich an 6000 Kilogr.
statt 4750 erzeugt. Die Ersparniß an Zuschlag betraͤgt an 50 Proc.In den großen Eisenwerken von Decaze (im Depart. Aveyron), die mit 6
Hohoͤfen 38,000 Kilogr. taͤglich erzeugen, kosten 1000 Kilogr.
Roheisen 2150 Kohks = 5400 Stk. und 750 fuͤr das Geblaͤse. Die
Tonne Steinkohlen kommt aber nur auf 3 1/2 f. Fr., und gibt circa 38 Proc. Kohks. Eisen zu Gußwaare kostet
um die Halste mehr Kohle.
Zu Voulte (Ardêche), wo
der Hizapparat durch Taylor 1832 eingerichtet worden,
erhielt man nach und nach eine Reduction von 2057 Kilogr. Kohls auf 1210 per 1000 Kilogr. Eisen (und zwar die Heizkohle
mitgerechnet); also von mehr als 40 Proc. Bis dahin gingen zwei Oefen noch mit
kalter und einer mit gehizter Luft. Wahrscheinlich ist die Temperatur weit unter
300°, so wie man denn den Ofen noch mit Kohks betreibt.
Zu Rimpéroux wird die Luft auf 130° R.
erhizt, und der Bedarf an Holzkohlen ist von 1610 Kilogr. auf 1270 vermindert, wobei
aber das Quantum Anthrazit zur Heizung nicht gerechnet ist. Das Resultat ist hiemit
nicht sehr guͤnstig, und noch unguͤnstiger sind die Versuche bei dem
Holzkohlenofen zu Torleron (Cher) ausgefallen. An
lezterem Orte wird auch ein Cupoloofen, mittelst eines von Jeffrier in England bezogenen Apparates, mit heißer Luft betrieben, und
besonders die dadurch erzielte Beschleunigung geruͤhmt, die zugleich den
Abgang vermindert. 100 Kilogr. Guß erheischen indessen an 28 Proc. Kohks.
Von den in Deutschland gemachten Versuchen ist außer dem
interessanten Berichte von Voltz uͤber die beiden
Hohoͤfen zu Wasseralfingen im Koͤnigreiche
Wuͤrtemberg wenig bekannt geworden.Auffallend ist, daß im eben erschienenen 5ten Bande der Prechtl'schen Encykl. diese wichtige Erfindung mit wenigen Worten
nur beruͤhrt worden ist. Jener Bericht (s. Polyt. Journ. Bd. LII.
S. 100 ff.) enthaͤlt sehr befriedigende Resultate von der Anwendung des heißen
Windes auch bei Holzkohlenoͤfen. Der Heizapparat
steht seitwaͤrts uͤber der Gicht, und die Luft wird also durch die
wegziehende Hize erwaͤrmt. Bei 120'' R. Luftwarme war der Kohlenbedarf von
180 Pfd. auf 136, und bei 200° R. auf 183 Pfd. (um 36 Proc.) vermindert. Das
Geblaͤse mußte aber etwas staͤrker arbeiten; der Druk ist von 11 auf
14'' erhoͤht worden. Das woͤchentliche Erzeugniß ist bei gleichem
Kohlenverbrauch von 520 auf 730 Cntr. gestiegen; der Gang sehr regelmaͤßig,
und das Eisen von besserer Qualitaͤt.
Mit nicht minder guͤnstigem Erfolge soll die heiße Luft auf dem Werke zu Hausen (im Badischen) und einigen anderen
eingefuͤhrt worden seyn.
Unverkennbar bekraͤftigen hiemit auch die außer England schon erhaltenen
Erfahrungen die Vortheile der neuen Schmelzmethode, wenn gleich die Resultate
weniger glaͤnzend als die zuerst angefuͤhrten erscheinen. Ueberhaupt
laͤßt sich gewiß aber bei laͤngerer Anwendung derselben noch manche
Vervollkommnung erwarten, und insbesondere ist dieß in Bezug auf ihre Anwendung bei
Holzkohlenoͤfen anzunehmen, die noch sehr neu ist und auf sehr wenigen
Versuchen beruht. Sicherlich ist noch lange nicht ausgemittelt, bei welchem Hizgrade
der Luft, bei welcher Menge und Pression, bei welcher Beschikung des Ofens, und bei
welchen Dimensionen das guͤnstigste Resultat hervorgeht. Es ist ferner zu
glauben, daß so wie der heiße Wind in England die verschwenderische Verwandlung der
Steinkohle in Kohks entbehrlich machte, so dadurch in Kurzem vielleicht die nicht
minder kostspielige Verkohlung des Holzes uͤberfluͤssig, und dann noch
eine ungleich groͤßere Ersparniß an Brennstoff erzielt werden mag.
––––––––––
Bis dahin bemuͤhte man sich namentlich den Heizapparat zu vereinfachen und
zwekmaͤßiger einzurichten. Bei den Oefen am Clyde
geschieht die Erwaͤrmung vermittelst eines an 150' langen Rohres von
Gußeisen. Obschon man dadurch eine Erwaͤrmung auf 612° erlangt, so ist
doch dieser Apparat kostbar und unbequem, und bei dieser Laͤnge die
Erwaͤrmung und die Luftdichtmachung (da die Ausdehnung des Metalles sehr
merklich ist) schwierig. S. Fig. 62
A ist das Cylindergeblaͤse; a, a das Heizrohr, das sich bei b in 2 Arme theilt, die nach den beiden Duͤsen c laufen; d 5
Feuerherde.
Bei Butterley laͤuft das Rohr in 3 Abtheilungen
durch den Heizofen. (Fig. 63.)
Zu Cadnor bedient man sich concentrischer Roͤhren
(Fig.
64.). Ran suchte dadurch zu verhindern, daß sich, wie dieß in so weiten Roͤhren beobachtet
wird, in der Mitte ein kalter Luftstrom durchziehe. Indessen bringt man hier die
Luft dennoch nur auf 400° F.
Zu Wasseralfingen, wo der Apparat uͤber der Gicht
angebracht ist und durch einen Theil der abziehenden Rauchluft erwaͤrmt wird,
ist, um moͤglichst an Raum zu sparen, das Windrohr 16 Mal umgebogen. Es
besteht demnach aus so vielen 4,1' langen Rohrstuͤken, wovon 4 parallel neben
und uͤber einander liegen, und mittelst Ellenbogen mit einander verbunden
sind. (S. Fig.
65 u. Polyt. Journ. Bd. L. S. 52). A ist die Gichtmuͤndung; durch a zieht ein Theil des Rauches in den Heizapparat und
nach dem Schornsteine b. – Die Roͤhren
sind 6,6'' weit und 0,6'' dik, und bilden eine einzige von 66' Laͤnge, ohne
die Kniestuͤke, die nicht dem Feuer ausgesezt sind.
Noch mehr an Raum und Eisenroͤhren wird erspart, wenn man die Luft zwingt,
theilweise durch mehrere dem Feuer ausgesezte engere Roͤhren durchzuziehen,
indem sie dann schnell mit einer großen Heizflaͤche in Beruͤhrung
kommt.
Ein solcher Apparat ist bei Monkland eingefuͤhrt,
wo zwar die Luft nur auf 450° erwaͤrmt wird. Er besteht (Fig. 66) aus
2 weiten hufeisenfoͤrmig gebogenen Roͤhren a und b, die durch viele wagerecht liegende
und engere Roͤhren c mit einander verbunden sind.
Die kalte Luft gelangt zuerst in die Roͤhre a,
und erwaͤrmt sich, indem sie durch die gluͤhenden Roͤhren c nach b zieht.
Ein aͤhnlicher ist bei Calder vorhanden, und die
Erhizung steigt auf 612° F. (Fig. 67.) Hier liegen die
Hauptroͤhren a und b
horizontal, und die Luft muß durch 10 oder 12 gebogene Roͤhren c, d streichen. Bei dieser Beugung hat die Ausdehnung
des Metalles keinen nachtheiligen Einfluß, und die Verbindungen der Heizoͤfen
sind um so solider, da sie durch Mauerwerk der directen Einwirkung des Feuers
entzogen sind. Ueberhaupt scheint dieser Apparat vor allen andern den Vorzug zu verdienen, und auch besonders geeignet, um
durch die abziehende Hize erwaͤrmt zu werden.
Das Durchziehen der Luft in engen und gebogenen Roͤhren erleidet allerdings
mehr Widerstand; doch in den lezteren Apparaten ist er ohne Zweifel weit geringer,
als in dem von Alfingen. Ueberhaupt scheint indessen daraus kein merklicher
Uebelstand hervorzugehen.
B. Theoretischer Theil.
Die Vortheile, welche sich aus der Anwendung eines heißen Windes bei der Betreibung
der Hohoͤfen ergeben sollen, wurden anfangs von Vielen um so eher bezweifelt
und bestritten, da sie aus der bisherigen Theorie sich kaum zu erklaͤren, ja
derselben beinahe zu widersprechen schienen. Je mehr sich nun seitdem die
angegebenen Resultate als unwiderlegliche Thatsachen erwiesen haben, desto mehr sind
wir zu einer gruͤndlichen Untersuchung aufgefordert, ob sie sich wirklich mit
den fruͤheren Ansichten nicht vereinigen lassen moͤgen.
Nach allen bisherigen Erfahrungen entsteht beim Verbrennen die Hize, indem sich der
verbrennende Koͤrper mit dem Sauerstoffe der Luft verbindet, und dadurch
Waͤrmestoff frei wird; und daraus folgt, daß jeder Koͤrper, wenn er
vollstaͤndig verbrennt, eine bestimmte Menge Waͤrme entwikeln, und
eine bestimmte Quantitaͤt Oxygenluft verzehren muß.
Ferner lehren calorimetrische Versuche, daß 1 Pfd. reine Kohle waͤhrend des
Verbrennens etwa 7050 W (an Waͤrme) entbindet
(wenn W die Waͤrmemenge bezeichnet, die 1 Pfd.
Wasser um 1° C. erwaͤrmt), und dabei 2,63 Oxygenluft verzehrt, oder an
30 Kub.' Daß also dazu an 140 K.' atmosphaͤrische Luft verbraucht
wuͤrde, da diese nur 21 Proc. Oxygenluft enthaͤlt, wenn alle zersezt
wuͤrde, daß aber bei lebhaften Kesselfeuerungen an 180 K.' erfordert werden
muß, weil meist die Haͤlfte der Oxygenluft unzersezt bleibt. Daß endlich
fuͤr Steinkohle meist nur 6000 W, fuͤr
Holz nur 2700 W zu rechnen sind etc.
Sind diese Principien richtig, so ist allerdings nicht einzusehen, daß die Temperatur
der Luft einen Einfluß auf das Quantum der entwikelten
Waͤrme haben kann, oder daß heiße Luft aus der gleichen Menge Brennstoff
(wofern er nicht etwa vollkommen verbrennte) mehr Waͤrme erzeugen sollte.
Eben so gewiß ist aber, daß wenn ein Koͤrper schmelzen soll, nicht nur eine gewisse Menge
Waͤrme von demselben aufgenommen und latent gemacht, sondern daß er
uͤberdieß bis zu einer bestimmten Temperatur
erhizt werden muß. Das Schmelzen wird demnach hauptsaͤchlich durch eine
gewisse Concentrirung der Waͤrme bedingt. Das Blei z.B. schmilzt erst bei
282° C. Gesezt also ein Stuͤk Blei muͤßte, damit es bis auf
diesen Punkt erhizt und dann fluͤssig werde, 100 W in sich aufnehmen, so muß der umgebende Raum so viel Waͤrme
enthalten, daß er auch, indem er 100 W an das Blei
abgibt, noch eine Temperatur von 282° behaͤlt. Es ist mithin eine
gewisse Concentrirung der Waͤrme noͤthig; und das groͤßte
Waͤmequantum wuͤrde kein Atom schmelzen, wenn es in einem zu großen Raume vertheilt
waͤre. Klar ist ferner, daß diese Concentrirung eben so von der Menge
Materie, in die sich die Waͤrme vertheilt, und ihrer Capacitaͤt
– als von dem Waͤrmequantum abhaͤngt.
Beim Verbrennen wird die Waͤrme, die sich entwikelt, zunaͤchst an die
mit dem Brennstoff in Beruͤhrung kommende Luft
abgetreten. Erhaͤlt ein Hohofen per Minute 2800
K.' (kalte) Luft, oder etwa 2 Ctr., verzehrt er per Min.
3/4 Ctr. Kohks, und entwikelt 1 Ctr. Kohks 6000 W
Waͤrmestoff, so wuͤrden jener Luftmasse 6000 × 3/4 = 1500 W zugefuͤhrt. Die Luft sollte daher, da sie 4 Mal
weniger Capacitaͤt als das Wasser hat, etwa 4 × 1500/2 = 3000°
C. heiß werden. Unstreitig ist aber die Temperatur weit niedriger, weil viele
Waͤrme an das Erz und den Zuschlag, besonders wenn beide zum Schmelzen
kommen, abgetreten wird.Wahrscheinlich ist hier auch nicht 6000 W
anzunehmen, da die Kohle nur das achtfache Gewicht an Luft verzehrt.
Genau kennen wir nun die Hize zwar nicht, bei der das Eisen schmilzt. Nach Dumas betraͤgt sie wenigstens
1500° C.; nach Anderen weit mehr.Die gewoͤhnliche Angabe von 6000°, so wie andere nach dem Wedgwood'schen Pyrometer abgeschaͤzte, ist
unstreitig sehr uͤbertrieben. Jedenfalls kommt sie wahrscheinlich derjenigen sehr nahe, die in einem
gewoͤhnlichen Hohofen hervorgebracht wird; und dann muß wohl der
Schmelzungsproceß im Verhaͤltnisse der uͤberhaupt erzeugten
Waͤrmemenge nur langsam und schwierig von Statten gehen.
Ohne Zweifel ist er dadurch nur wenig zu beschleunigen, daß man die Windmenge und
dadurch die Waͤrmeerzeugung vermehrt, denn in demselben Verhaͤltnisse
vertheilt sich die Waͤrme dann an eine groͤßere Luftmasse. Es handelt
sich darum, die Temperatur zu erhoͤhen; denn dann wuͤrde ein viel
kleineres Waͤrmequantum sogar viel wirksamer seyn.Waͤre der Schmelzpunkt bei 2000°, so wuͤrde eine große
Luftmasse, die wenig uͤber 2000° heißer waͤre, weit
weniger Olsen schmelzen, als eine ungleich kleinere von 2500°,
obschon sie weniger Waͤrme enthielte, weil diese weit mehr
Waͤrme abtreten koͤnnte. Ueberhaupt aber zeigen analoge
Erscheinungen bei der Aufloͤsung (also Fluͤssigwerdung) der
Salze in Wasser, der Metalle in Feuer u.s.w., wie sehr eine geringe Zugabe
der Waͤrme, wenn sie die Temperatur erhoͤht, die
Aufloͤsung beguͤnstigt.
Dieß laͤßt sich nun vorerst erreichen, wenn man zur Verbrennung weniger Luft,
und also eine oxygenreichere anwendet; und so kann denn durch Zublasen von Sauerstoffgas die Temperatur ausnehmend erhoͤht
werden. Bekanntlich haben wir bis dahin aber kein Mittel, eine solche Luft zur Anwendung im Großen uns
zu verschaffen.
In der That muß jedoch einiger Maßen diese Wirkung auch erreicht werden, wenn die
Luft von dem Einblasen betraͤchtlich erwaͤrmt wird; denn eben weil
dasselbe Quantum Luft und Kohle dasselbe Quantum Waͤrme erzeugt, so muß die
resultirende Temperatur in diesem Falle um diejenige groͤßer seyn, welche die
eingeblasene bereits besizt, und da diese hinzugekommene Waͤrme
ausschließlich dann auf die Schmelzung verwendet werden kann, so mag allerdings weit
weniger Kohle und Luft ein groͤßeres Product liefern, und so ungleich mehr
Kohle im Ofen erspart werden, als die besondere Erwaͤrmung des Windes
kostet.
Kaum ist nun aber zu bezweifeln, daß nicht das Zublasen von heißer Luft wirklich eine
betraͤchtlich hoͤhere Temperatur im Ofen
hervorbringt. Zwar fehlt es bis dahin an pyrometrischen Belegen; allein alle
Erscheinungen bei diesem Betriebe erweisen eine solche. Das Eisen und die Schlafen
sind weit duͤnnfluͤssiger; man braucht viel weniger Flußmittel oder
Zuschlag; das Feuer endlich im Herde ist blendend weiß, und das wegziehende
uͤber der Gicht schoͤn roth und nicht gelb wie sonst.
Die angegebenen vortheilhaften Wirkungen der vorlaͤufigen Erhizung des Windes
beim Schmelzprocesse scheinen uns daher mit der bisherigen Theorie des Verbrennens
und der Waͤrmeerzeugung vollkommen im Einklange, wenn gleich, wie so oft, die
Theorie nicht zur Erfindung dieses Verfahrens fuͤhrte. Wir halten
naͤmlich fuͤr so viel als erwiesen, daß dieses Einblasen erhizter Luft
eine betraͤchtlich hoͤhere Temperatur des Ofens (oder Herdes) zur
Folge habe, und glauben, daß aus Obigem einerseits eben diese Erhoͤhung der
Temperatur auch bei vermindertem Kohlen- und Luftverbrauche, andererseits
ihre große Wirksamkeit auf den Schmelzproceß erklaͤrbar sey. Ueberdieß ist
indessen anzunehmen, daß in der That in diesem Falle 1) auch aus dem Quantum
Brennstoff etwas mehr Waͤrme erzeugt werde, in so fern er noch
vollstaͤndiger consumirt werden mag; und 2) daß die Oekonomie der
Waͤrme noch vollkommener sey, in so fern bekanntlich der Sauerstoffgehalt der
Luft desto vollstaͤndiger zersezt wird, je hoͤher die Feuerhize
ist.
Wir wollen schließlich noch sehen, ob und wie weit sich nach obiger Berechnungsweise
und den vorhandenen Angaben wirklich eine hoͤhere Temperatur
herausstellt.
Nach Dufresnoy verzehrte ein mit gewoͤhnlicher Luft betriebener Hohofen auf dem Calderwerke in 4
Wochen 550 Tonnen Kohks, also per Min. 13/48 Cntr. (oder
30 1/5 Pfd.), und erhielt
per Min. 3500 K.' oder 268 Pfd. Wind. Entwikelt 8 Pfd.
Kohks 6000 W (Waͤrme), und erfordert die
Erwaͤrmung der Luft vier Mal weniger Waͤrme als das Wasser (also 268
Pfd. so viel als 67 Wasser), so ergaͤbe sich (von aller sonstigen Verwendung
abgesehen) eine Temperatur = (6000 . 30 1/3)/67 = 2716° C.
Mit heißer Luft von 612° F. oder 322° C.
betrieben verzehrte derselbe Ofen in 4 Wochen 446 Tonnen Steinkohlen, oder per Min. fast 25 Pfd. und 2600 K.' oder 200 Pfd.
Luft.
Es ergaͤbe sich demnach, wenn die Steinkohle (was bei so vollkommener
Verbrennung sehr wahrscheinlich ist) wenigstens 6000 W
liefern, eine Temperatur = (25 . 6000)/50 = 3000° C., und die bereits der
Luft mitgetheilte von 320° mitgerechnet, eine Temperatur = 3320°.
Es bestaͤtigt sich hiemit auch aus dieser Berechnung die obige
Erklaͤrung.
Tafeln