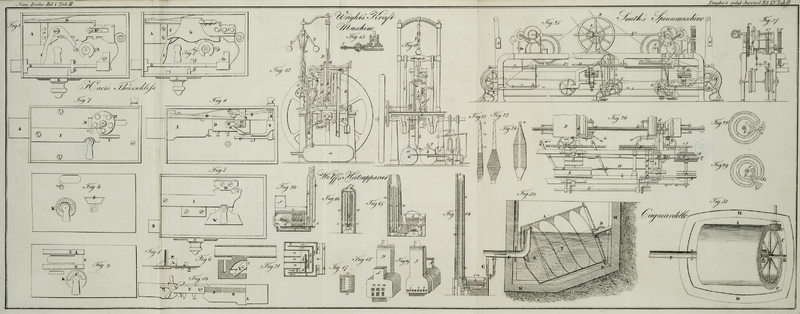| Titel: | Bericht des Hrn. Francoeur über ein neues Thürschloß von der Erfindung des Hrn. Huet, Mechanikers und Schlossers in Paris, rue du Faubourg St. Martin No. 99. |
| Fundstelle: | Band 55, Jahrgang 1835, Nr. XXXVI., S. 224 |
| Download: | XML |
XXXVI.
Bericht des Hrn. Francoeur uͤber ein neues Thuͤrschloß von der Erfindung des Hrn. Huet, Mechanikers und Schlossers in Paris, rue du Faubourg St. Martin No. 99.
Aus dem Bulletin de la
Société d'encouragement. August 1834, S. 295.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Bericht uͤber Huet's neues Thuͤrschloß.
Ich habe die Ehre hiemit uͤber ein neues Thuͤrschloß und uͤber
einen Sicherheitsriegel, welche beide von ihrem Erfinder, Hrn. Huet, der Gesellschaft vorgelegt wurden, Bericht zu erstatten.
Das neue Schloß ist bis auf einige wenige Modifikationen beinahe wie die
gewoͤhnlichen Sicherheitsschloͤsser gebaut, nur ist die
Zusammenstellung des kleinen Riegels und des Winkelhakens besser getroffen, weßhalb
saͤmmtliche Theile auch mit großer Leichtigkeit arbeiten. Das
Hauptsaͤchlichste an diesem Schlosse besteht jedoch darin, daß der Erfinder
die gluͤkliche Idee hatte, an dem großen Riegel einen Zapfen anzubringen, der
in den Zaͤhnen oder in dem Barte einer Art von Klinke, welche Hr. Huet die Riegelfeder (paillette) nennt, zuruͤkgehalten wird. Man muß daher, um das Schloß
zu oͤffnen, diese gezahnte Klinke emporheben, um den großen Riegel frei zu
machen. Der Mechanismus, womit dieß geschieht, ist sehr einfach, und auf ihn
stuͤzt sich hauptsaͤchlich auch das Patent, welches Hr. Huet genommen hat.
Die Klinke schwingt sich an der Schloßplatte, und fuͤhrt eine eigene Besazung
mit sich; um erstere zu heben muß auf leztere, die von allen den uͤbrigen
Besazungen des Schlosses ganz unabhaͤngig ist, gewirkt werden. Zu diesem
Behufe ist der Bart des Schluͤssels, abgesehen von den freien
Durchgaͤngen fuͤr diese Besazungen, nach seiner Dike gespalten, damit
ein Zuͤngelchen in ihm angebracht werden kann, welches man auf den ersten
Anblik nicht bemerkt, und welches erst dann uͤber den Bart hervorragt, wenn
es sich um einen Zapfen dreht, der ihm als Drehungsachse dient. Wenn man den
Schluͤssel anstekt, und ihn umzudrehen versucht, so greift eine der an dem
Schloßbleche befestigten Besazungen den Schwanz dieses Zuͤngelchens an,
wodurch dasselbe veranlaßt wird, hinter dem Barte hervorzuspringen. Da sich nun
dieses Zuͤngelchen an dem kreisrunden Halse, den ihm die bewegliche Besazung
darbietet, reibt, so hebt sie diese Besazung, und mit ihr die Klinke, mit der sie
solidarisch ist, empor, und dadurch wird der Zapfen, der sich in dem großen Riegel
befindet, frei, so daß sich dieser Riegel nun bewegen kann.
Es ergibt sich demnach aus diesem Mechanismus, daß man dieses Schloß, wenn es doppelt
abgeschlossen ist, nur mit dem wahren Schluͤssel oͤffnen kann. Es
waͤre sehr schwer, dasselbe mit einem Dieterich zu oͤffnen; denn
waͤhrend man einerseits die bewegliche Besazung von der Stelle schafft,
muͤßte man andererseits durch eine andere Bewegung die Barte des Riegels
angreifen, wozu es durchaus erforderlich waͤre, daß in dem engen Canale, in
welchen der gebohrte Schluͤssel gestekt wird, gleichzeitig und in
Uebereinstimmung mit einander zwei Instrumente wirken. Dieser hoͤchst
einfache Mechanismus gewaͤhrt demnach ein Sicherheitsmittel mehr, so daß
dieses Schloß wirklich von wesentlichem Nuzen ist.
Was den Sicherheitsriegel des Hrn. Huet betrifft, so
beruht derselbe, wenn er auch der beschriebenen Vorrichtung nicht ganz
aͤhnlich ist, doch auf denselben Principien. Die Zeichnung und deren
Erklaͤrung, welche weiter unten folgen wird, wird auch diese Vorrichtung
anschaulicher machen, als es sonst durch die kleinlichste Beschreibung geschehen
koͤnnte. Ich bemerke daher nur noch, daß dieser Riegel, wenn man ihn mit dem
kleinen Riegel und dem Winkelhaken, die oben beschrieben wurden, in Verbindung
braͤchte, ein Sicherheitsschloß geben wuͤrde, welches, abgesehen von
einigen Modifikationen, dem obigen sehr aͤhnlich seyn muͤßte.
Die Idee eines Bartes mit einem drehbaren Stuͤke, und die Idee der beweglichen
Besazungen sind uͤbrigens nicht neu; und wenn man dieselben bisher nicht so
oft in Anwendung brachte, so ruͤhrte dieß theils davon her, daß diese
Schloͤsser zu theuer waren, theils aber auch davon, daß die Theile derselben
zu leicht in Unordnung geriethen. Wir glauben jedoch, daß die Schlosserkunst von den
beweglichen Besazungen weit mehr Vortheil ziehen koͤnnte, als dieß hisher der
Fall war, und daß sie allerdings große Beruͤksichtigung von Seite jener, die
sich mit Verbesserungen und Erfindungen in derselben abgeben, verdienen.
Wir schlagen daher vor, die Gesellschaft solle Hrn. Huet
erklaͤren, daß sie seine Schloͤsser fuͤr gut befunden habe, und
dieselben durch den Bulletin bekannt machen.
Beschreibung des Sicherheitsschlosses des Hrn.
Huet.
Fig. 1 zeigt
den inneren Mechanismus des Schlosses mit dem verbesserten Federriegel (pêne demi-tour), in der Haͤlfte der
natuͤrlichen Große gezeichnet.
Fig. 2 zeigt
dasselbe Schloß, an welchem jedoch außerdem noch zwei andere neue Theile angebracht
sind.
Fig. 3 ist ein
vollstaͤndiges Schloß mit dem Schloßbleche (couverture), woran man die beiden neuen Stuͤke ersieht.
Fig. 4 zeigt
die innere Seite des Schloßbleches.
Fig. 5 ist ein
Profil desselben.
Fig. 6 ist ein
Laͤngendurchschnitt durch das Rohr und den Bart des Schluͤssels, in
natuͤrlicher Groͤße gezeichnet.
Gleiche Buchstaben bezeichnen an allen Figuren gleiche Gegenstaͤnde.
A ist der große Riegel mit doppelter Umdrehung (à double tour); er ist mit einem Ausschnitte a versehen, welcher zur Aufnahme des Stuͤkes F dient.
B ist der Federriegel, an welchem sich ein doppeltes,
mit den Buchstaben b, b, bezeichnetes T befindet, damit er nach Belieben umgedreht werden
kann, je nachdem sich die Thuͤre nach Außen oder nach Innen
oͤffnet.
C ist der Winkelhaken dieses Federriegels.
D, D' die große Feder und ihr Hals.
E ist der Schieber des Federriegels; er ist von ihm
unabhaͤngig und unbeweglich, wenn der Riegel mit dem Schluͤssel bewegt
wird.
F ist ein Stuͤk, welches mit Schrauben an dem
Riegel A befestigt ist, und dessen Loͤcher f, f zur Aufnahme des Zapfens i der Riegelfeder (paillette) I bestimmt sind.
G eine doppelte Feder mit einem Halse aus Kupfer; ihre
Ferse senkt sich in die Einschnitte des Stuͤkes F
herab.
H ein messingenes Stuͤk, welches mit Schrauben an
der eben genannten Feder befestigt wird, und welches, wenn das Schloß in Ruhe ist,
verhindert, daß die Riegelfeder nicht gehoben wird.
I die Riegelfeder, welche den Zapfen i traͤgt, der, wenn er in die Loͤcher f, f des Stuͤkes F
tritt, das Zuruͤkweichen des Riegels A
hindert.
I' ein Theil der Riegelfeder, welcher durch das sich
schaukelnde Stuͤk L des Schluͤsselbartes
emporgehoben ist.
J eine an der Riegelfeder angebrachte Anschwellung,
mittelst welcher dieselbe von Innen emporgehoben werden kann.
K ein Theil des Reifes des Schluͤsselloches; er
ist schraͤg abgeschnitten, damit sich das Stuͤk L des Schluͤsselbartes schwingen kann.
L das bewegliche Stuͤk des
Schluͤsselbartes, dessen Ende l die Riegelfeder
I emporhebt, wenn es unter dem Theile I' derselben durchgeht.
W ein falsches Schluͤsselloch, dessen Dike der
hoͤchsten Hebung der Riegelfeder I gleichkommt,
und welches den Raum zwischen den beiden Schloßblechen ausfuͤllt.
Beschreibung des Sicherheitsriegels.
Fig. 7 gibt
eine vollkommene Ansicht dieses Riegels mit seinem Schloßbleche; man bemerkt an
demselben zwei neue Stuͤke.
Fig. 8 gibt
eine Ansicht des Inneren dieser Vorrichtung.
Fig. 9 zeigt
das Schloßblech von Innen.
Fig. 10 gibt
eine Ansicht des zuruͤkgezogenen Riegels und der hinter ihm angebrachten
Theile.
A ist der große Riegel mit doppelter Umdrehung; er hat
zwei Baͤrte a, a und einen Ausschnitt, durch den
die Schraube P geht.
DD' die große Feder und ihr Hals mit der doppelten Ferse
d', welche das Ende des beweglichen Stuͤkes
R und einen Ring d, der
das Ende des Hebels T aufnimmt, festhaͤlt.
I die Riegelfeder und ihr Zapfen i, welche wie an dem zuerst beschriebenen Schlosse gebaut sind.
M eine kreisrunde, an dem vierekigen Ende der Stange P aufgezogene Platte, welche mit Loͤchern
versehen ist, in die nach und nach der Zapfen der Riegelfeder tritt. Diese Platte
ist mit einem Knaufe m versehen.
N ein vierekiger, in dem Schloßbleche angebrachter
Ausschnitt, der die Schraubenmutter O (Fig. 8) aufnimmt, und
dieselbe unbeweglich erhaͤlt, wenn sie sich auf ihrer hoͤchsten
Stellung befindet, und wenn der Riegel abgeschlossen ist. An diesem Schloßbleche
wird gleichfalls das in
Fig. 3
ersichtliche Stuͤk W des obigen Schlosses
an, gebracht.
O eine Schraubenmutter, welche durch die Umdrehungen der
mit einem Schraubengange versehenen Stange P nach
Auf- oder Abwarts bewegt wird, und welche, wenn der Riegel geschlossen ist,
in den vierekigen Ausschnitt N tritt; waͤhrend
sie, wenn man denselben oͤffnet, zwischen die beiden Platten X, X gleitet.
P die mit einem Schraubengange versehene Stange, womit
die Schraubenmutter auf- und niederbewegt wird; sie ist an ihrem Ende p mit einem Knopfe ausgestattet, mit welchem man sie von
Innen umdrehen, und den Riegel vor- oder ruͤkwaͤrts schieben
kann.
Q ein an dem vierekigen Ende der Stange P aufgezogener Stern, mittelst welchem der
Schluͤssel sowohl diese Stange als die kreisrunde Platte M umdrehen kann.
R ein bewegliches Stuͤk mit einem Barte r, welches in der Stellung, in der man es in Fig. 8 und 10 sieht, zum
Oeffnen der ersten Umdrehung dient, und welches sich, wenn man den Schluͤssel
bei doppelter Absperrung zum dritten Male umdreht, hinter den Bart a des Riegels stellt.
S, T, U, V ist eine Vorrichtung, die zum Oeffnen und
Schließen von Innen dient. Der Schieber S bewegt, wenn
er in dem Theil V von Oben nach Unten geschoben wird: 1)
die Klinke T, auf deren Ende er sich stemmt, und die
mittelst des Ringes d die Feder D emporhebt; 2) den horizontalen Hebel U, und
zwar mittelst einer an seinem unteren Ende angebrachten
Schraͤgflaͤche. Das Ende dieses Hebels, welches durch das Schloßblech
geht, hebt zugleich auch die Riegelfeder I (Fig. 7)
empor.
X, X zwei fixirte Platten, die als Falz fuͤr die
Schraubenmutter O dienen.
Y ein an dem Stuͤke R
angeschraubtes Zapfenband, welches sich nach Belieben abnehmen laͤßt.
Z eine messingene Spiralfeder, womit alle die Theile O, P, Q, R, Y fortgeschoben werden, wenn die
Schraubenmutter O aus dem Ausschnitte N herabgetreten ist.
Dieser Riegel wird zum Sicherheitsschlosse, wenn man den Federriegel B und den Schieber E des
ersteren Schlosses damit verbindet.
Tafeln