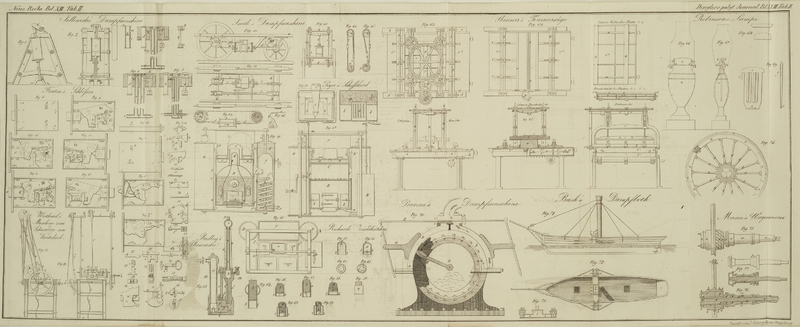| Titel: | Verbesserungen an den Schiffsheerden, an den Kochapparaten, und in der Methode destillirtes Wasser aus dem Seewasser zu erhalten, welche Verbesserungen sich auch auf die Erzeugung von Dampf anwenden lassen, und worauf sich François Peyre jun., zu White Hart Inn im Borough Southwark, am 23. Februar 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. VI., S. 15 |
| Download: | XML |
VI.
Verbesserungen an den Schiffsheerden, an den
Kochapparaten, und in der Methode destillirtes Wasser aus dem Seewasser zu erhalten,
welche Verbesserungen sich auch auf die Erzeugung von Dampf anwenden lassen, und worauf
sich François
Peyre
jun., zu White Hart Inn im Borough Southwark, am 23. Februar 1836 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Oktober 1836, S.
5. Mit Abbildungen auf Tab. II.
Peyre's Verbesserungen an den Schiffsheerden etc.
Die unter obigem Patente begriffene Erfindung bezwekt hauptsaͤchlich die
rasche Gewinnung von destillirtem Wasser aus dem Seewasser, und zwar in einem
Zustande, in welchem dasselbe besser zum Trinken geeignet ist, als das bisher auf
aͤhnliche Weise gewonnene Wasser. Die Destillation geht auf einem
Schiffsheerde oder in einem Schiffskochapparate von Statten, ohne daß dabei mehr
Brennmaterial verbraucht wird, als zu den gewoͤhnlichen Kochoperationen
erforderlich ist. Das Neue an dieser Erfindung besteht vorzuͤglich darin, daß
in das in einem Kessel enthaltene Seewasser von Zeit zu Zeit mittelst eines
Geblaͤses oder einer Luftpumpe oder irgend einer anderen geeigneten
Vorrichtung erhizte Luft eingetrieben wird, damit hiedurch das Aufsieden und die
Verdampfung beschleunigt werde. Das in dem Kessel enthaltene Seewasser wird aber
zugleich auch mit Alaun oder Schwefelsaͤure vermengt, damit sich an den
Waͤnden des Kessels keine Incrustation von Salztheilchen ansezen kann, und
damit keine Unreinigkeiten mit dem Dampfe uͤbergehen koͤnnen. Endlich
soll, nachdem das Wasser mit einem Theile Schwefelsaͤure und Kohle vermengt
aus dem Apparate ausgetreten ist, kalte atmosphaͤrische Luft in dieses
destillirte Wasser eingetrieben werden, damit ihm der unangenehme Geschmak, den das
destillirte Wasser gewoͤhnlich zu haben pflegt, genommen wird, und damit es
dafuͤr jene Eigenschaften bekommt, die das Quellwasser in Bezug auf den
Geschmak und Geruch durch den Destillationsproceß verliert, und damit es folglich
angenehmer zu trinken wird.
Die folgender Beschreibung beigegebene Abbildung zeigt einen Heerd oder einen
Kochapparat fuͤr Schiffe, woraus die Erfindung, welche den Gegenstand
gegenwaͤrtigen Patentes bildet, erhellt; der Patenttraͤger
beschraͤnkt sich jedoch nicht auf die hier abgebildete Form und Anordnung der
Theile, da sowohl erstere als auch leztere je nach Umstaͤnden mannigfach
abgeaͤndert werden kann.
Jedes Mal, so oft der Kessel mit Seewasser gefuͤllt worden ist, und bevor noch
irgend eine Verdampfung Statt findet, sezt man auf 25 Gallons Seewasser 4 Unzen
Alaun und 1 Unze Schwefelsaͤure zu. Man kann uͤbrigens auch einen
Zusaz von Alaun fuͤr sich allein anwenden. Die Absicht hiebei ist durch die
Schwefelsaͤure alle schaͤdlichen Daͤmpfe (?) oder alle
sonstigen Substanzen, die zugleich mit dem Dampfe uͤbergehen koͤnnten,
zu beseitigen, und durch den Alaun die Krystallisation des Salzes und die
Incrustirung des Kessels zu verhuͤten. Sowohl der Alaun als die
Schwefelsaͤure koͤnnen uͤbrigens auch mit dem Seewasser
vermengt werden, bevor dieses noch in den Kessel eingetragen worden ist.
Fig. 47 ist
ein Frontaufriß der ganzen Vorrichtung mit ihrem Ofen, dem Kochapparate und den
Verdichtern. Fig.
48 ist ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht derselben. Fig. 49 ist
ein senkrechter Durchschnitt nach der Linie a, b, woraus
man die innere Einrichtung des Ofens und seiner Feuerzuͤge, so wie auch jene
des Kessels mit seiner Dampfkammer und jene der Verdichter oder
Kuͤhlgefaͤße ersieht. Fig. 50 ist ein
horizontaler Durchschnitt nach der Linie c, d; und Fig. 51 ein
ebensolcher nach der Linie e, f.
Der Apparat besteht aus vier Haupttheilen: naͤmlich aus der Feuerstelle, aus
dem Kessel mit seiner Dampfkammer, aus den Verdichtern, und aus den
Blasebaͤlgen, A ist die Feuerstelle; B der Kessel, worin das Seewasser enthalten ist; C die Dampfkammer, in deren Scheitel die
Kochgefaͤße a, a, a dampfdicht eingesezt sind;
D sind die Verdichter, welche entweder beide
zugleich oder auch einzeln in Anwendung kommen koͤnnen; E ist das Geblaͤse; b,
b sind die Oefen zum Baken oder Braten von Fleisch und anderen Speisen,
welche Oefen zu beiden Seiten der Feuerstelle angebracht sind. Dieser Apparat
arbeitet folgender Maßen. Der Rauch und die heißen Daͤmpfe, welche sich aus
dem Brennmateriale entwikeln, steigen von der Feuerstelle A aus durch die roͤhrenfoͤrmigen durch den Kessel
gefuͤhrten Feuerzuͤge c, c empor, um dann,
nachdem sie den groͤßten Theil ihres Waͤrmestoffes an das Seewasser
abgegeben, bei dem Rauchfange c* zu entweichen. Die
Feuerzuͤge muͤssen stets mit Salzwasser bedekt seyn; auch
muͤssen sie zum Behufe der Reinigung entsprechende Thuͤrchen besizen.
Der aus dem Seewasser entwikelte Dampf steigt durch die Roͤhre g empor, und tritt dann, nachdem er durch den Dekel e gegangen, in die Dampfkammer C, um dann endlich, nachdem er den groͤßeren Theil seines
Waͤrmestoffes an die Kochgefaͤße a, a
abgegeben hat, in Form von Dampf und destillirtem Wasser durch die Roͤhre f in den Helm g zu
entweichen, der in dem Verdichter G mit kaltem Wasser
umgeben ist. Der unverdichtete Dampf und das heiße Wasser werden beim Hinabstroͤmen durch das
Schlangenrohr h abgekuͤhlt, und treten endlich
bei dem Hahne i als destillirtes Wasser aus. Die
Luftpumpen oder die Geblaͤse, womit heiße Luft in das Seewasser eingetrieben
wird, koͤnnen einen beliebigen Bau haben, und auch in beliebiger Stellung
angebracht werden. Der Patenttraͤger bedient sich vorzugsweise cylindrischer
Geblaͤse aus Leder oder Holz, welche nach der gewoͤhnlichen Weise
verfertigt sind, und auch nach einer der gewoͤhnlichen Methoden in Bewegung
gesezt werden. An dem hier abgebildeten Apparate geschieht dieß mittelst einer
Kurbel k, die durch den Krummhebel l und durch eine Verbindungsstange die querlaufende
Welle m in Bewegung sezt. Leztere pflanzt die Bewegung
dann mittelst des kurzen Hebels n und seiner
Verbindungsstange an die in dem Gehaͤuse E
befindlichen cylindrischen Geblaͤse fort. Der aus diesen lezteren
ausgetriebene Wind gelangt durch die Roͤhre o in
die hohlen Roststangen p des Ofens, um dann, nachdem er
bei seinem Durchgange durch dieselben erhizt worden ist, durch die Roͤhre q in das Salzwasser zu entweichen. In dem Ende dieser
Roͤhre sind viele kleine Loͤcher angebracht, damit hiedurch die Luft
um so besser in dem Wasser vertheilt werde. Die Roͤhre q ist nach Aufwaͤrts bis in die Roͤhre d gefuͤhrt, damit das Seewasser nicht durch die
Roͤhre o aus dem Kessel entweichen kann wenn die
Geblaͤse nicht in Thaͤtigkeit sind. Die auf diese Weise in das Wasser
eingetriebene heiße Luft steigt zugleich mit dem Dampfe in Form von Blasen in
demselben empor, und beschleunigt das Aufsieden und die Verdampfung in hohem Grade.
Der Dampf, die Luft und das verdichtete Wasser gehen, so wie es oben angegeben
wurde, in den Kuͤhlapparat uͤber. y ist
ein Behaͤlter, der den Verdichter mit dem zum Abkuͤhlen
noͤthigen kalten Wasser versieht; uͤbrigens kann der Verdichter
entweder mittelst eines an seinem oberen Theile angebrachten Trichters oder mittelst
einer Roͤhre, welche mit einer Pumpe in Verbindung steht, oder auch auf
irgend andere geeignete Weise gefuͤllt erhalten werden. Das kalte Wasser
tritt hier durch die Roͤhre z an dem unteren
Theile des Verdichters ein, steigt in diesem in dem Maaße als es sich
erwaͤrmt, empor, und fließt endlich als warmes Wasser durch die Roͤhre
s, s in den Kessel B,
der auf diese Weise gespeist wird. Wuͤrde das in den Verdichtern enthaltene
Wasser zu heiß werden, so koͤnnte es bei der Roͤhre t abgelassen werden. Wenn man will, kann man jedoch auch
ununterbrochen kaltes Wasser durch die Verdichter stroͤmen lassen.
Zu bemerken ist, daß der Kessel nicht in zwei Theile B
und C getheilt zu seyn braucht; sondern daß man das
siedende Wasser die Kochgeschirre a, a umspuͤlen
lassen kann, waͤhrend man den Dampf in einem Helme sammelt, und aus diesem in den Helm des
Kuͤhlapparates g leitet, wie dieß in Fig. 10 durch
punktirte Linien angedeutet ist.
Das destillirte Wasser wird so wie es aus dem Apparate kommt, in Faͤsser oder
andere geeignete Gefaͤße gebracht, und auf je 25 Gallons mit einer geringen
Quantitaͤt, z. B. mit ¼ Unze Schwefelsaͤure und mit 8 bis 10
Unzen zerschlagener Holzkohle versezt. Leztere laͤßt man gegen 24 Stunden mit
dem Wasser in Beruͤhrung, und waͤhrend dieser Zeit treibt man auch
mittelst Geblaͤsen oder anderen geeigneten Vorrichtungen kalte
atmosphaͤrische Luft durch das Wasser. Die Holzkohle soll dem destillirten
Wasser den faden Geschmak nehmen, den es gewoͤhnlich zu haben pflegt; die
Luft soll dem Wasser eine groͤßere Quantitaͤt Sauerstoff abtreten, und
die Schwefelsaͤure soll ihm einen fuͤr den Gaumen angenehmeren und dem
frischen Quellwasser mehr aͤhnlich kommenden Geschmak mittheilen (!).
Am Schlusse bemerkt der Patenttraͤger, daß das Einblasen oder Eintreiben von
heißer Luft in das Wasser die Verdampfung dieses lezteren sehr beguͤnstigt,
und daß folglich viel Brennmaterial erspart werden kann, wenn man diese Methode auf
die Erzeugung von Dampf zum Betriebe von Dampfmaschinen, zum Heizen, zum Troknen und
zu verschiedenen anderen Zweken anwendet.
Tafeln