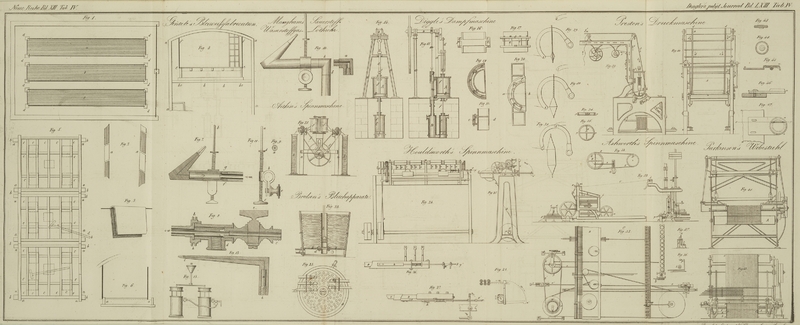| Titel: | Ueber die Bleiweißfabrication; von J. G. Gentele. |
| Autor: | Johan G. Gentele [GND] |
| Fundstelle: | Band 63, Jahrgang 1837, Nr. XLI., S. 196 |
| Download: | XML |
XLI.
Ueber die Bleiweißfabrication; von J. G. Gentele.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Gentele, uͤber Bleiweißfabrication.
Das Bleiweiß ist eine Verbindung von Bleioxyd mit Kohlensaͤure. Wenn die
Verkalkung des metallischen Bleies unter Umstaͤnden erfolgt, welche die
Vereinigung des entstehenden Oxyds mit Kohlensaͤure beguͤnstigen, so
entsteht basisches kohlensaures Bleioxyd; diese
Verbindung bildet sich also immer, wenn das Blei nach dem sogenannten
hollaͤndischen Verfahren in Bleiweiß verwandelt wird; wird hingegen die
Aufloͤsung eines Bleisalzes mit Kohlensaͤure oder einem kohlensauren
Salze zersezt, so ist der Niederschlag neutrales
kohlensaures Bleioxyd.
A. Fabrication
des basischen Bleiweißes.
Die gewoͤhnliche und im Großen betriebene Fabrication dieses Products beruht
darauf, daß man Bleiplatten unter Mitwirkung von Waͤrme und Feuchtigkeit der
Oxydation und Einwirkung von Kohlensaͤure mittelst Essigdaͤmpfen
aussezt. Die Waͤrme, in welcher die Gefaͤße, worin das Blei den
Essigdaͤmpfen ausgesezt wird, laͤngere Zeit erhalten werden
muͤssen, kann man nun entweder durch eine Mistgaͤhrung entwikeln (hollaͤndisches Verfahren), oder man kann auch die
Verkalkungsgefaͤße in Kammern aufstellen, welche durch Oefen auf die
geeignete Temperatur geheizt werden.
I. Bereitung
des Bleiweißes durch Verkalkung des Bleies in Pferdemist.
1) Ginsezen und Beschikung der sogenannten
Loogen.
In ein gegen die Witterung geschuͤztes vierekiges Local von etwa 12 Fuß
Laͤnge, 8 Fuß Breite und 10 Fuß Hoͤhe, dessen vordere Wand oder
Eingang durch in Falzen laufende Bretter nach und nach theilweise geschlossen oder
geoͤffnet werden kann, und dessen uͤbrige Wandungen zwischen Balken
geschobene oder angenagelte Dielen sind, wird eine ½′ hohe Lage von
frischem Roßduͤnger mittelst hoͤlzerner Stoͤßel fest
eingestampft und mit Brettern so gut als moͤglich zur ebenen Flaͤche
ausgearbeitet. Nach Vollendung dieser Anlage wird ein aus vier einzelnen Brettern
bestehender 1′ hoher Kasten darin so zusammengesezt, daß die Bretter
desselben auf allen Seiten 1½′ von der Wand dieses Locals (welches ich
nach der Fabriksprache nun immer Looge nenne) abstehen,
also einen Zwischenraum von 1½′ lassen; dieser Zwischenraum wird
ebenfalls mit Roßduͤnger aufgefuͤllt. Derselbe dient zur Aufnahme der
sogenannten Calcinirtoͤpfe; diese werden
gewoͤhnlich aus gemeinem zaͤhem rothem Thon
auf der Toͤpferscheibe gedreht, sind beilaͤufig 9 bayer. Zoll hoch,
und oben 6–7″, unten aber nur 4–5″ weit und gut glasirt.
In einer Hoͤhe von 5″ vom Boden befinden sich in jedem solchen Topfe
zwei einander gegenuͤber liegende, ½″ lange Zapfen, auf welche
das in Rollen aufgewikelte und zur Verkalkung kommende Blei aufgelegt wird.
Diese Rollen werden aus langen Bleistreifen gemacht, welche man dadurch
erhaͤlt, daß man auf guß- oder blecheiserne Rinnen mit ebener
Flaͤche, die beilaͤufig 4″ weir sind, schmelzendes Blei gießt,
welches, wenn die Rinne horizontal liegt, zur duͤnnen ebenen Platte
auslaͤuft, die nach dem Erkalten abgenommen werden kann. Mit sechs solcher
Rinnen ist man im Stande vermittelst zweier Arbeiter, von denen einer abwechselnd
auf die leere Rinne gießaͤt maͤhrend der andere die gegossene Platte
entfernt, taͤglich 20 Cntr. Blei in Platten von 3′ Laͤnge,
4″ Breite und der Dike eines viertel oder halben Kronenthalers zu gießen. Das
Metall wird in einem eisernen Kessel geschmolzen und mit eisernen Loͤffeln
ausgeschoͤpft; man beobachtet dabei einen gewissen Hizgrad, der deßwegen
nicht zu hoch seyn darf, weil sich sonst auf der Oberflaͤche eine zu große
Menge von Oxyd (sogenannter Kraͤze) erzeugt, und man also an Blei verlieren
wuͤrde. Zu heiß gewordenes Blei, welches auch das schnelle Erkalten der
Gußplatten beeintraͤchtigt, muß durch Einbringen von kaltem Blei (einem zweiten Bleiblok) in den Kessel erkaltet werden.
Die aus den so gegossenen Platten gefertigten Rollen muͤssen der Groͤße
der Toͤpfe entsprechen und loker seyn, das heißt: die Flaͤchen des
neben einander liegenden Bleies sollen sich nicht, oder nur so wenig als
moͤglich beruͤhren, damit Raum zum Hindurchdringen der Essigdampfe
bleibt. Diese Rollen muͤssen natuͤrlich immer in Vorrath vorhanden
seyn.
Man fuͤllt nun die Calcinirtoͤpfe bis unter die hervorstehenden Zapfen
oder Traͤger mit dem zur Verkalkung dienenden Essiggemenge, wovon
gewoͤhnlich ¾ – 1 bayerische Maaß hiezu erforderlich ist;
hierauf werden die Toͤpfe in dem fuͤr sie bestimmten Raum der Looge
reihenweise eingesezt und jeder einzelne Topf mit einer Bleirolle, welche
gewoͤhnlich 4–5 Pfd. wiegt, beschikt. Nachdem der ganze Raum innerhalb
des Kastens mit den beschikten Toͤpfen ausgefuͤllt ist, bedekt man
dieselben haͤufig, was jedoch wenig nuzt, mit thoͤnernen Dekeln.
Jedenfalls muͤssen sie aber nun noch mit Brettern gut zugedekt werden, indem
man auf zwei uͤber sie gelegte Bretter, welche mit ihren Enden auf dem Kasten
aufliegen, ein drittes bringt, welches die zwischen beiden befindliche Fuge
verschließt. Wenn auf diese Art eine Reihe Toͤpfe in die Looge gebracht ist
(wozu zwei Arbeiter gewoͤhnlich acht Stunden brauchen), kommt auf die obere
Bretterlage abermals eine der ersten entsprechende Schichte von Pferdemist, welche
geebnet und fest getreten zur Aufnahme einer ueuen Reihe Toͤpfe zwischen
einem mit Pferdemist umgebenen Kasten dient. Auf diese kommt eben so eine zweite und
dritte Reihe u. s. w., bis der Raum der Looge angefuͤllt ist.
Bei der Beschikung sorgt man insbesondere dafuͤr: daß
a) moͤglichst viele Toͤpfe neben einander
in einem Raume zusammengesezt werden koͤnnen, weil das Blei gleichstark
verkalkt wird, es mag viel oder wenig davon in einem abgeschlossenen Raume
zusammengedraͤngt seyn;
b) daß das eingesezte Blei nicht mit dem im unteren
Theile der Toͤpfe enthaltenen Essig in unmittelbare Beruͤhrung kommt,
weil es sonst
verunreinigt wird, auch der Essig bald gesaͤttigt werden muͤßte und
dann keine verkalkenden Dampfe mehr entwikeln koͤnnte; ferner
c) daß dle Bretter, welche zur Bedekung dienen, recht
fest aufeinanderliegen, also keine Fugen zum Durchlaufen etwa dem Pferdemiste
anhaͤngender Feuchtigkeit, oder zum Durchstauben desselben bleiben;
ferner
d daß die durch die oberen Bleischichten auf die
Toͤpfe herabgebogenen Bretter dieselben nicht zerbrechen koͤnnen. Die
Toͤpfe muͤssen daher gleiche Hoͤhe haben, und man thut auch
gut, wenn man in der Mitte des mit Toͤpfen auszufuͤllenden Raumes
starke Dielen aufrichtet, welche einige Zoll uͤber die Toͤpfe
hinaufreichen und die auf sie herabgebogenen Bretter stuͤzen.
e) fuͤr guten Duͤnger. Die
Schoͤnheit des zu erzielenden Bleiweißes und die Wirksamkeit des
Verkalkungsmittels haͤngen großen Theils von der Wahl des Pferdemistes ab. Frischer Pferdemist, welcher nicht mit Stroh gemengt
ist, taugt nicht, indem er sich zu sehr erhizt und zu viel Schwefelwasserstoffgas
bei seiner faulen Gaͤhrung entwikelt, wodurch die Oberflaͤche des
Bleies geschwaͤrzt wird. Derselbe muß etwas mehr Stroh enthalten als
wirklichen Duͤnger, und vor der Anwendung fast tropfnaß gemacht werden,
jedoch nicht so stark, daß wenn er zur Bedekung gebraucht wird, eine braune
Fluͤssigkeit ablaufen und das unter ihm liegende Blei verunreinigen kann. Hat
man keinen solchen strohigen Pferdemist, so wendet man am besten ein Gemenge von
bereits gebrauchtem und frischem an; denn wenn derselbe sich zu stark erhizen
koͤnnte, wuͤrde die Verdampfung des in den Toͤpfen enthaltenen
Essigs zu sehr beschleunigt und also die Beruͤhrungszeit der Daͤmpfe
mit dem Bleie verkuͤrzt werden, so daß sie zum Theil unzersezt entweichen
muͤßten. Die geeignetste Temperatur zur Verkalkung des Bleies in Pferdemist
ist die von + 30 bis 40° R., wenn sie von einer Gaͤhrung des
Pferdemistes begleitet ist, bei welcher er die groͤßte Menge
Kohlensaͤure und moͤglichst wenig gelbfaͤrbende Dampfe
entwikelt. Wenn man die rechte Temperatur getroffen hat, faͤllt der Bleikalk
blendendweiß aus und haͤngt loker an dem Metall, waͤhrend er bei
vorausgegangener starker Erhizung hart, grau, und an manchen Stellen ganz
schwarzgrau wird.
Bei dieser Art der Verkalkung hat man natuͤrlich die Operation nicht sehr in
der Gewalt, und es kommt besonders darauf an, daß man
schon beim Einsezen der Toͤpfe die geeigneten allerdings nur durch mehrere
Versuche und Operationen zu erfahrenden Verhaͤltnisse trifft. Um zu erfahren,
wie weit die Erhizung gestiegen ist, stelle ich eine Blechroͤhre senkrecht in die Mitte der
Looge, in welcher ich an einem Bindfaden ein Thermometer in verschiedener
Hoͤhe aufhangen kann. Sollte sie zu stark geworden seyn, so kann man sie,
obgleich nur theilweise, dadurch vermindern, daß man die aͤußere Umgebung der
Kasten taͤglich einige Mal mittelst einer Gießkanne mit Wasser besprizt;
damit jedoch die Erkaͤltung hiedurch nicht zu rasch eintritt, darf man nie zu
viel Wasser auf ein Mal nachgießen und diese Operation nur in Zwischenraͤumen
von einem halben Tage wiederholen.
Um uͤber die geeignetste Sorte von Pferdemist Gewißheit zu erlangen, thut man
gut, wenn man bei jeder Verkalkungsoperation eine Tabelle anfertigt, aus welcher man
zulezt die taͤgliche Temperatur, das vorgenommene Begießen, das Gewicht des
eingesezten Bleies, so wie des daraus erhaltenen Bleikalks und des
ruͤkstaͤndigen Bleies ersieht. ES versteht sich, daß jedes Mal auch
eine Probe des gewonnenen Bleikalks zur Vergleichung mit den spaͤter zu
erzielenden Producten aufbewahrt werden muß.
2) Ueber den chemischen Proceß
waͤhrend der Verkalkung.
Wenn man einen gewoͤhnliches zum Theil mit Essig gefuͤllten Topf mit
einer Bleiplatte bedekt, welche man noch mit Flanell u.
dergl. uͤberlegt (theils um den Zutritt der Luft, und dadurch die freie
Verduͤnstung des Essigs zu verhindern, theils um die Waͤrme mehr
zusammenzuhalten) und ihn dann in einer Waͤrme von beilaͤufig
35° R. ruhig stehen laͤßt, so wird sich, je nach der Laͤnge der
Zeit, die innere und zum Theil auch die aͤußere Flache der Platte mit einer
diken Rinde von Bleiweiß uͤberzogen haben. Das Blei oxydirt sich in diesem
Falle auf Kosten des Essigs, welcher sowohl durch die Anziehung des Bleies zum
Sauerstoff, als durch die disponirende Verwandtschaft des Bleioxyds zur
Kohlensaͤure zerlegt wird, und sowohl den Sauerstoff zur Oxydation des Bleies
als die Kohlensaure zu Erzeugung des Bleisalzes liefert, waͤhrend
wahrscheinlich der noch uͤbrige Kohlenstoff und Wasserstoff in eine
aͤtherartige Fluͤssigkeit uͤbergeht, aͤhnlich
derjenigen, welche erhalten wird, wenn man essigsaure Metallsalze durch trokene
Destillation behandelt. Uebrigens hat die Erfahrung gezeigt, daß der Essig diese
Bleiweißbildung beschleunige, wenn er nicht ganz rein ist, sondern ihm ein
gaͤhrungsfaͤhiger Stoff, als Wein- oder Bierlager etc.
beigesezt wird. Der Zutritt der atmosphaͤrischen Luft ist dabei nicht nur
unnoͤthig, sondern selbst schaͤdlich, indem dadurch ein
unnoͤthiger Aufwand an Essig durch Verlust der
Daͤmpfe
entsteht, und die Bleiplatten abtroknen, wodurch die Bleiweißerzeugung gehindert
wird.Prechtl's technologische Encyklopaͤdie Bd.
II. S. 456.
Der als Verkalkungsmittel dienende Essig ist in den Bleiweißfabriken
gewoͤhnlich von solcher Staͤrke, daß eine Unze desselben 30 bis 32
Gran basisch kohlensaures Kali neutralisirt.
3) Ueber die Dauer der Verkalkung.
Binnen 6 bis 7 Tagen sucht man, um die Zeit der Einwirkung des Mistes auf die unteren
und oberen Schichten in keine zu große Differenz zu bringen, mit dem Einsaze einer
Looge fertig zu werden, was gut angeht, wenn jeden Tag eine Schichte Blei eingesezt
wird, die immer 10 bis 12 Cntr. betragen kann. Schon den dritten und vierten Tag,
also nach dem Einsaz der dritten und vierten Schichte, haben sich die unteren
erhizt; es entstehen Daͤmpfe, wovon ein betraͤchtlicher Theil an der
Oberflaͤche des Pferdemistes entweicht, und von nun an ist auch jedes Mal die
waͤhrend des Tags aufgelegte Schichte uͤber Nacht in Gaͤhrung
gerathen. Wenn der Pferdemist wenig Stroh enthielt und sehr schnell gaͤhrt,
so wird sich binnen 5 bis 6 Tagen die Temperatur auf 60 bis 70° R.
erhoͤhen, es sey denn daß man den Pferdemist begießt, wodurch die Erhizung
zwar vermindert, aber nicht regelmaͤßig geleitet werden kann. Enthaͤlt
hingegen der Pferdemist viel Stroh und geht langsam in Gaͤhrung uͤber,
so steigt auch die Temperatur langsamer und regelmaͤßiger und erreicht nur
selten 55° R. Von dieser Temperatur kann man aber die Looge durch Begießen
leicht herabstimmen. Die Gaͤhrung sezt sich hier natuͤrlich auch
laͤnger fort, und es haben daher, wie schon bemerkt wurde, die
Essigdaͤmpfe zu ihrer Bildung und Einwirkung auf das Blei viel laͤnger
Zeit, was nur vortheilhaft seyn kann. Wenn man beilaͤufig acht Tage nach der
Beschikung eine Reihe oͤffnet, so bemerkt man, daß die Verkalkung ziemlich
vorgeschritten ist; der das Blei oder den Kasten umgebende Mist ist halbschimmlicht,
feucht und raucht; die Essigtoͤpfe sind warm und die noch darin enthaltene
Fluͤssigkeit, welche schwach sauer schmekt, ist theils klar geblieben, theils
gelb geworden.
Nach abermaligem spaͤterem Oeffnen findet man die Verkalkung wieder weiter
vorgeschritten, aber innerhalb derselben Zeit nie mehr in so hohem Grade wie
fruͤher. War die Erhizung gehoͤrig regulirt worden, so ist der
gebildete Bleikalk selbst in der fuͤnften Woche, wo man die Looge am
vortheilhaftesten zur Entleerung oͤffnet, noch feucht, und daher in
Ruͤksicht auf die Gesundheit der Arbeiter am besten abzuklopfen. Bei
groͤßerer Erhizung wird derselbe compact und steinhart, wozu noch die
Anwendung von reinem Essig mitzuhelfen scheint, da bei Anwendung der genannten
Abgaͤnge diese Haͤrte bei weitem nicht so bedeutend wird.
4) Ausleeren der Toͤpfe und
Ausbeute.
Nach Verlauf von 5 bis 6 Wochen ist es am vortheilhaftesten die Loogen zu entleeren,
da die fernere Einwirkung des Essigs dann so unbedeutend ist, daß sie fuͤr
den durch laͤngeres Warten entstehenden Zeitverlust nicht
entschaͤdigt. Man nimmt daher mit der gehoͤrigen Vorsicht, um eine
Verstaͤubung und das Durchfallen einzelner Pferdemist-Stuͤkchen
in die Toͤpfe zu verhindern, zuerst von der obersten und nachdem die
Toͤpfe beseitigt wurden, von der naͤchstfolgenden Schichte die
Pferdemistdeke weg, reinigt aber die Bretter vor dem Abdeken mittelst eines
Staubbesens so gut als moͤglich von dem aufliegenden Staube. In einigen
Toͤpfen wird man noch Fluͤssigkeit finden, in anderen ist sie aber
ganz eingetroknet; dieß muß man bei der Befreiung der Toͤpfe vom Blei jedes
Mal genau ausmitteln, denn es erfordert Vorsicht, aus ersteren die Rollen so
herauszubringen, daß von dem anhaͤngenden lokeren Bleiweiß, welches oft mehr
als das metallische Blei betraͤgt und in diesem Falle den Zusammenhang der
Rolle aufhebt, nichts in die Fluͤssigkeit faͤllt, indem dieser Antheil
verloren ginge oder nur zur Darstellung von Bleizuker oder einer ganz geringen Sorte
Bleiweiß anwendbar waͤre.
Bei Toͤpfen, worin die Fluͤssigkeit eingetroknet ist, schadet das
Abfallen von Bleiweiß nicht, indem sich von der Masse der eingetrokneten
Fluͤssigkeit nichts vom Topfe abloͤst.
Alle aus der Looge herausgenommenen Rollen werden einzeln auf einem Marmortische oder
auf einer zum Abklopfen vorgerichteten steinernen Platte auseinander gerollt, wobei
der Bleikalk zum Theil von selbst abfaͤllt, zum Theil aber mittelst eines
hoͤlzernen Hammers losgeschlagen werden muß. Bei dieser Arbeit, welche mit
der groͤßten Reinlichkeit vollbracht werden soll, verbinden die Arbeiter den
Mund, um sich gegen das Einathmen des Bleistaubes zu schuͤzen, und suchen
zugleich den Bleikalk zu sortiren, indem sie denjenigen absondern, welcher etwa
durch vom Pferdemist gekommene Tropfen oder durch irgend einen Zufall unrein
geworden ist. Die Reste von metallischem Blei werden beseitigt und gewogen,
deßgleichen auch der gewonnene Bleikalk, wobei sich immer eine Gewichtszunahme
ergibt, welche auf 100 Theile Metall 25 bis 27 Theile betraͤgt, je nach der
Trokenheit, in der der abgeklopfte Bleikalk herausgekommen ist.
Uebersicht einer Verkalkungs-Operation.
Textabbildung Bd. 063, S. 203
Ausbeute; Arbeiten.; Zum Einsaz
noͤthige Toͤpfe.; Eingeseztes Blei.; Verkalkungsmittel.;
Bleikalk.; Blei.; Temperatur.; Stùk.; Ct.; Pf. Ct. Pf. Ct. Pf.; Tag.; R.; a)Schmelzen des Bleies, 3 Tage 2 Mann.; 10 Eimer
Essig (32 Gran kohlensaures Kali p. Unze
saͤttigend).; b) zum Aufrollen 3 Tage, 2
Mann.; 1½ Eimer Bierhefe.; c) zum Einsezen 7
Tage, 2 Mann.; 2 Eimer Essighefe.; d) zum Ausnehmen,
Abklopfen und Wiegen, 8 Tage, 2 Mann.; 10 M. Branntwein von 11° Beck. 40
Pfd. Kartoffelbroken.
Beim Schmelzen des Bleies erhaͤlt man gewoͤhnlich 5 Proc. Abgang an
Bleiasche, welche entweder reducirt oder zur Bleizukerfabrication verwendet
wird.
Ueber die Verarbeitung des Bleikalks zu verkaͤuflichem Bleiweiße wird weiter
unten das Naͤhere mitgetheilt.
5) Ueber das Veralten der
Calcinirtoͤpfe und eine in manchen Fabriken uͤbliche
Abhuͤlfe dagegen. Erprobte Verbesserung in der Verkalkung des Bleies
durch Anwendung zwekmaͤßigerer
Toͤpfe und eine andere Anschichtung
des Pferdemistes.
Alle Bleiweißfabrikanten, welche das Blei in Pferdemist verkalken, wissen, daß neue
Toͤpfe, wahrscheinlich weil sie den Essig nicht hindurch lassen, das Blei
vollstaͤndiger verkalken, als oͤfters gebrauchte, von denen die Glasur
abgeloͤst ist und deren Poren geoͤffnet sind. Man muß deßhalb die
alten Toͤpfe beseitigen und von Zeit zu Zeit immer wieder neue anschaffen.
Manche Fabrikanten uͤbergeben deßhalb auch ihre Toͤpfe nach
jedesmaligem Gebrauche wieder dem Toͤpfer zum Glasiren; allein abgesehen von
den Glasurkosten, welche freilich nicht sehr bedeutend sind, verursacht eine solche
Manipulation zu viele Muͤhe und es gehen dabei auch immer viele Toͤpfe
zu Grund. Andere lassen hingegen nach dem ersten Gebrauche der Toͤpfe
dieselben reinigen und verpichen; es wird naͤmlich in den unteren Theil jedes
einzelnen Topfes ein Loͤffel voll Pech aus einem gußeisernen Kessel, worin
dasselbe geschmolzen wird, geschoͤpft und der Topf so gedreht, daß dessen
unter den Zapfen liegende Seitenwaͤnde mit Pech uͤberzogen werden,
worauf der Ueberschuß des Peches in den Kessel zuruͤkgegossen wird. Bei
einiger Uebung bringen es die Arbeiter leicht dahin, daß sie mit einem Centner Pech
einige tausend Toͤpfe zu verpichen im Stande sind; dieses muß dann
natuͤrlich mit solcher Geschwindigkeit geschehen, daß nicht viel Pech an den
Wandungen der Toͤpfe erstarren kann. Bei dieser uͤbrigens sehr
empfehlenswerthen Methode ist nur der Uebelstand, daß man sich huͤten muß das
Entleeren der Looge vorzunehmen, ehe die Toͤpfe hinreichend erkaltet und
ausgetroknet sind, weil sonst das Pech noch weich ist und folglich herabfallende
Bleikalkstuͤkchen daran kleben bleiben.
Daß man seit der Einfuͤhrung der hollaͤndischen Verkalkungsweise in
Nord- und Mitteldeutschland in der Form und Groͤße der Toͤpfe
noch keine Abaͤnderung gemacht hat, scheint von der Versuchsscheue der
Fabrikanten herzuruͤhren, welche meistens auf dem ein Mal angefangenen Wege
fortarbeiten, so lange es in merkantilischer Hinsicht angeht. Man kann aber nicht
nur die Toͤpfe nicht unbedeutend vergroͤßern, sondern es lassen sich
auch die Schichten derselben auf eine Art anordnen, wobei die Temperatur viel
leichter als bei der vorher beschriebenen Methode gehandhabt werden kann. Durch die
Anwendung groͤßerer Toͤpfe erspart man an Raum und Arbeit; auch wird
das Bleiweiß aus einem erklaͤrbaren Grund nicht so leicht schwarz und bei der
nun zu beschreibenden Anordnung der Toͤpfe und Mistschichten kann man, ohne
das Tropfen von gefaͤrbter Bruͤhe in die Toͤpfe
befuͤrchten zu muͤssen, die Pferdmistschichten beliebig naß halten,
also sehr leicht die geeignete Temperatur zur Verkalkung hervorbringen.
Ich habe durch Versuche mit verschieden geformten Gefaͤßen gefunden, daß sich
die Verkalkung am vortheilhaftesten in Toͤpfen von 1 Fuß Hoͤhe
betreiben laͤßt, welche oben 10 Zoll und am Boden 8 Zoll weit sind,
uͤbrigens wie gewoͤhnlich mit Zapfen als Traͤgern fuͤr
das Blei versehen und glasirt oder ausgepicht sind. Ein solcher Topf faßt dann von
breiteren Platten, welche auf die beschriebene Art (nur in breitere Formen) gegossen werden, 18 bis 20 Pfund und 5 bis 6 Maaß
Verkalkungsmittel, und da bei ihnen den Daͤmpfen mehr Raum gestattet ist,
diese auch wegen der groͤßeren Hoͤhe der Toͤpfe nicht so leicht
entweichen koͤnnen, so erklaͤrt sich dadurch leicht die im
Verhaͤltniß zum Verkalkungsmittel erfolgende staͤrkere Einwirkung
derselben.
Die abweichende Anschichtung des Pferdemistes, welche bei der Verkalkung in diesen
Toͤpfen noͤthig (aber auch bei kleineren Toͤpfen anwendbar)
ist, erheischt eine Abtheilung der Looge in einzelne Parzellen. Es wird
naͤmlich der oben beschriebene Raum, die Looge, mit einzelnen senkrecht
stehenden, einander gegenuͤber liegenden Balken, welche zum Einschieben von
Brettern mit Rinnen versehen sind, so in Parzellen getheilt, daß er z. B. wie in
Fig. 1,
welche den Grundriß darstellt, nach dem Einschieben der Bretter in drei
Kaͤsten a, b, c zerfaͤllt, welche von dem
uͤbrigen Raume d, d, d, d durch die Bretter
abgeschlossen sind und zur Aufnahme der Toͤpfe dienen, welche dann der in den
Raum d, d, d, d zu liegen kommende Pferdemist
umschließt. Diese Kaͤsten haben nun natuͤrlich auch die Hoͤhe
der ganzen Looge, und sind, um bequem darin arbeiten zu koͤnnen, beliebig
zerlegbar. Die zum Einschieben dienlichen Bretter (wovon die einer jeden langen oder
kurzen Seite des Kastens auch fuͤr die Rinnen anderer Kaͤsten passen
muͤssen, damit man bei der Arbeit mit Aussuchen keine Zeit verliert) sind an
dem Rande ihrer langen Seite saͤmmtlich schief abgehobelt, um sie so zwischen
den Rinnen uͤbereinanderschieben zu koͤnnen, daß (wie in Fig. 2, wo a, a der Kasten fuͤr die Toͤpfe ist) die
vom Pferdemist im aͤußeren Raum abtropfende Fluͤssigkeit wegen der
nach Außen abhaͤngigen Flaͤche nicht zwischen den Brettfugen in den
Raum der Toͤpfe gelangen kann. Man kann so den Mist, ohne eine Verunreinigung
der Toͤpfe befuͤrchten zu muͤssen, beliebig begießen.
Die Arbeit bei der Beschikung dieser Kaͤsten leuchtet sogleich ein, wenn man
sich die Looge versinnlicht, und sich mehrere Kaͤsten zur Aufnahme des Bleies
mit dazwischen und daneben anliegendem Pferdemiste denkt; sie unterscheiden sich
eigentlich von den gewoͤhnlichen nur dadurch, daß dort die Schichten
horizontal uͤbereinander, hier aber senkrecht nebeneinander liegen. Jede
Reihe der Toͤpfe wird von der anderen 1) durch eine Deke von Bleiplatten,
welche die Verkalkung ebenfalls ergreift, und 2) durch ein auf die Bleiplatten
gelegtes Brett getrennt, auf welches dann die nachfolgende Reihe der Toͤpfe
zu stehen kommt. Die oberste Reihe der Toͤpfe wird so verschlossen, daß der
zulezt zur Bedekung uͤber die ganze Looge ausgebreitete Pferdemist nichts
verunreinigt und wieder sauber wegzubringen ist.
II. Verfahrungsarten zur Bereitung des
Bleikalks in Kaͤsten, welche sich in geheizten Kammern
befinden.
Erstes Verfahren.
Man richtet in einer durch passende Mauern gegen den Temperaturwechsel verwahrten
Kammer,
Um die Waͤrme besser zusammenzuhalten, pflegt man in einigen Fabriken
mit den aͤußeren, aus Baksteinen gemauerten Waͤnden parallel,
in einer Entfernung von 1 Fuß von denselben, Waͤnde aus diken
Brettern aufzufuͤhren, und den Zwischenraum zwischen beiden mit alter
Lohe auszufuͤllen; eben so auch die aus starken hoͤlzernen
Pfosten hergestellte Deke dieser Kammer mit einem solchen, 1 bis 2 Fuß
diken, Lohlager zu bedeken.
A. d. R.
welche wenigstens 25 Fuß lang und 16 Fuß breit ist, der Laͤnge und
Breite derselben entsprechende hoͤlzerne Kaͤsten von 1½ Fuß
Hoͤhe so uͤbereinander auf, daß ein fuͤr die Arbeiten
hinreichender Raum zwischen denselben bleibt. Diese Kaͤsten werden von gutem
Holz angefertigt, mit Leinoͤhlfirniß getraͤnkt und ihre Fugen mit
schwarzem Pech ausgepicht, was auch jedes Mal geschieht, wenn sie nach dem Gebrauche
an irgend einer Stelle lek geworden sind; an einer ihrer Seitenwaͤnde ist
eine Oeffnung zum Entleeren und Auspuzen derselben angebracht. Durch diese
Kaͤsten gehen zum Aufhaͤngen der Bleiplatten starke Latten, welche an
den entgegengesezten Seitenwaͤnden an Leisten in der Mitte aber auf einem
queeruͤbergehenden Bohlen aufliegen. Die einzelnen Bleiplatten, welche 1 Fuß
lang und 8 Zoll breit in der Dike eines halben Kronenthalers gegossen werben,
muͤssen 3 Zoll von einander entfernt bleiben; das Ende derselben befindet
sich dann 3 bis 4 Zoll uͤber der als Verkalkungsmittel dienenden
Fluͤssigkeit. Fig. 3 zeigt eine solche aufgehaͤngte Platte. Wenn das
Verkalkungsmittel (½ Fuß hoch) in die kaͤsten gefuͤllt worden
ist und die Bleiplatten darin aufgehaͤngt sind, wird ein aus mehreren
Stuͤken bestehender Dekel darauf gelegt, dessen einzelne Theile man
zusammendruͤkt, worauf man ihn mit Holzstuͤken anspreißt, deren oberes
Ende an den Boden des oberen Kastens, das untere aber an den Dekel druͤkt.
Ein Kasten von 20 Fuß Laͤnge und 14 Fuß Breite faßt 1150 bis 1400 solcher
Platten im Gesammtgewichte von 33 bis 40 Cntr., so daß bei einem Zimmer oder einer
Looge von 8 solcher Kaͤsten, welche dann aus zwei Stokwerken besteht, 250 bis
300 Cntr. Blei gleichzeitig der Verkalkung unterworfen werden koͤnnen. Als
Verkalkungsmittel dient dasselbe Gemisch, welches ich in der Tabelle angegeben
habe.
Um diese Looge auf die noͤthige Temperatur zu erwaͤrmen, ist jede
Heizungsvorrichtung anwendbar, den Vorzug verdienen aber entweder steinerne auf der
Erde unter dem unteren Kasten herumgefuͤhrte und von Außen heizbare
Canaͤle, die sich in blecherne Roͤhren endigen, oder
Kanonenoͤfen mit an den Waͤnden der Looge herumgefuͤhrten
Blechroͤhren, welche aber ebenfalls von Außen geheizt werden
muͤssen.)
Die Heizung kann auch zwekmaͤßig und sicher durch Wasserdaͤmpfe
geschehen, welche in einigen Roͤhren, die auf der. Sohle der Kammer
vertheilt sind, durchstreichen.
A. d. R.
Nach der Beschikung der Looge muß man alle Wandungen, derselben so wie die
Thuͤre aufs sorgfaͤltigste verschließen; auch muß an einem bequemen
Orte im Inneren des Zimmers ein Thermometer, welches von Außen durch ein verdekbares
Fenster sichtbar ist, aufgehaͤngt werden, damit man nach Abschieben seiner
Verdekung die im Inneren herrschende Temperatur ablesen kann. Vor der Heizung bleibt
die Looge 3 bis 4 Tage stehen, waͤhrend welcher Zeit in dem Kasten die Stoffe
eine Gaͤhrung erleiden, in deren Folge sich das Verkalkungsmittel
erwaͤrmt. Man beginnt dann die Heizung und leitet sie so, daß die
Waͤrme nach Verlauf von sieben Tagen noch nicht uͤber 20° Réaumur betraͤgt. In der zweiten Woche wird sie
etwas hoͤher getrieben, das Zimmer jedoch ebenfalls nur nach und nach auf
30° R. gebracht und in der dritten auf 35 bis 36° R. gesteigert; in
der vierten und fuͤnften, allenfalls auch sechsten aber auf 40° R.
gehalten, worauf man die Heizung einzustellen pflegt, da die fernere Einwirkung des
Verkalkungsmittels nach diefer Zeit nur noch sehr unbedeutend ist.
Man findet nun bei Eroͤffnung der Looge und der Kaͤsten, welche ihrer
Entleerung behufs der Luͤftung des Locals einige Tage vorausgeht, die
Bleiplatten meist gut verkalkt, die in den Kasten gefuͤllte
Fluͤssigkeit aber mit einem grauen Schimmel bedekt und widerlich riechend.
Die Platten werden nun an den Aufhaͤnghoͤlzchen in Wannen
herausgezogen, worauf man den Bleikalk abklopft, das Blei aber zum weiteren
Gebrauche der unten angegebenen Behandlung unterwirft.
In einigen Fabriken bedient man sich auch kleiner 3 Fuß langer, 18 Zoll breiter und
15 Zoll hoher Kaͤsten, welche ausgepicht, ohne eiserne Naͤgel
zusammengefuͤgt und an den beiden langen Seiten mit Leisten, an welche die
Bleiplatten gehaͤngt werden, versehen sind. Dieselben werden eben so
beschikt, in einem heizbaren Zimmer uͤbereinander gestellt (so daß die obere
Kiste auf dem Dekel der unteren ruht und ihn festdruͤkt) und auch derselben
Temperatur ausgesezt. Die Verkalkung ist in solchen kleinen Kisten eben so gut
ausfuͤhrbar, wie in großen Kaͤsten, allein die Anlagskosten sind
bedeutender, die Reparaturen haͤufiger und da von diesen
uͤbereinanderstehenden Kisten die oberen ost lek werden, so verunreinigt die
Fluͤssigkeit,
welche von ihnen in die unteren eindringt, das Blei. Bei den großen Kaͤsten
kann man aber im Falle des Tropfens eine Rinne unterlegen.
Zweites Verfahren.
Ein anderes schnell zum Ziele fuͤhrendes, aber sehr umstaͤndliches
Verfahren ist folgendes: man bringt entweder verschleimte (unbrauchbare) oder gute
mit Essig gesaͤuerte Buchenholzspaͤne in geeignete Gefaͤße
(Faͤsser) und umgibt darin mit ihnen in Koͤrben befindliches loker
aufgerolltes Blei. Wenn diese Gefaͤße einer Temperatur von 30° R.
ausgesezt werden, geht die Oxydation des Bleies aͤußerst rasch mit Erzeugung
einer vorzuͤglichen Sorte Bleikalk vor sich.
Drittes Verfahren.
Bei dieser in den Fabriken in Klagenfurt, Villach und der Umgegend uͤblichen
Methode verwendet man als Verkalkungsmittel außer dem Essig auch noch eine der
geistigen Gaͤhrung faͤhige Substanz, gewoͤhnlich getroknete
Weinbeeren.
Die Vorrichtung, worin man in Klagenfurt das Blei der Einwirkung des
Verkalkungsmittels aussezt, besteht aus einem 3 Fuß hohen und 10 bis 15 Fuß langen
hoͤlzernen Kasten; derselbe wird aus 2 Zoll starken Dielen angefertigt und in
ein Geriegel eingeschlossen. In einem Locale von beilaͤufig 40 Fuß
Laͤnge kann man immer 2 bis 3 solcher Kaͤsten der Laͤnge nach
nebeneinander aufstellen. Diese Kaͤsten sind, wie der Durchschnitt des
Zimmers und der Verkalkungsvorrichtung in Fig. 4 zeigt, in dem
gewoͤlbten Locale (dessen Seitenwaͤnde a, a, a,
a bezeichnen), auf einem queruͤberlaufenden Balkenlager b, b, b, b aufgestellt, so daß ihr Boden das Balkenlager
bedekt, waͤhrend es an anderen Stellen (bei b, c b,
c) durch aufgenagelte Bretter gedekt ist. In dem unteren Raum des Locals
(der Kammer) ist die Feuerung angebracht, im oberen aber ist der Zutritt durch eine
uͤber dem Balkenlager von Außen eingehende Thuͤre offen. Die
Verkalkungskaͤsten haben nun noch folgende Einrichtung: sie stoßen an den
einander gegenuͤberstehenden Seitenwaͤnden so genau als
moͤglich zusammen, damit man daraus einen einzigen Kasten bilden kann; wo
Fugen entstehen, werden sie durch Latten und Verkittung gut verdichtet. Auf ihnen
liegen, etwas in die Dielen eingeschnitten, Durchzuͤge von starken Bohlen;
man sehe Fig.
5, wo a, a, a, a die Waͤnde der
Kaͤsten; b, b, b, b die dieselben einschließenden
Geriegel; c, c, c, c die Bohlen bezeichnen, welche als
Traͤger fuͤr die Bretter dienen, womit jeder Kasten zum Theil bedekt
wird. Diese Bedekung ist, wie der Grundriß Fig. 5 zeigt,
ausgefuͤhrt; an einzelnen Orten sind Oeffnungen, welche theils dazu dienen,
die im unteren Raum entwikelten Gase auf die Flaͤche der Bretter heraufgelangen zu
lassen, theils auch zum Einfuͤllen und zum Aufruͤhren der
Fluͤssigkeit, zu welchem lezteren Behufe mit Stielen versehene Kruͤken
gebraucht werden, deren mit d bezeichnetes aus dem
Kasten hervorragendes Ende die Handhabe ist.
Zum Einhaͤngen der Bleiplatten sind (man vergleiche Fig. 4, den Aufriß im
Durchschnitt) auf die Bretter Posten von Bohlen aufgerichtet, die unten von den
queeruͤberliegenden getragen, oben aber durch ihre Einzapfung in die Mauer
und die Verbindung der Postenreihen untereinander festgehalten werden. An ihnen sind
die Latten, welche zum Aufhaͤngen des Bleies dienen, angebracht, und zwar
sind sie in Einschnitten der Bohlen durch hoͤlzerne Naͤgel befestigt.
Sie nehmen dann natuͤrlich nur diejenigen Raͤume ein, wo das Blei bloß
auf die Bretter, nicht in die Fluͤssigkeit herabfallen wuͤrde;
deßwegen sind auch uͤberdieß die Bretter an den Oeffnungen mit Leisten
versehen, welche einige Zoll emporstehen, und so das Hineinrollen von abfallenden
Stuͤkchen verhindern. Das ungefaͤhr 5 Fuß hohe Geruͤste zum
Aufhaͤngen des Bleies ist so wie die ganze Oberflaͤche des Kastens mit
einem Verschlage aus starken Brettern umgeben, welche (bei e,
e
Fig. 4) unten
an den Kasten, oben aber an das Gewoͤlbe des Locals befestigt sind. Dieser
Verschlag hat mehrere mit Schiebern genau verschließbare Oeffnungen, welche theils
zum Eingang in die Kammer dienen, theils den Ruͤhrkruͤken
gegenuͤber angebracht sind, um dieselben bewegen zu koͤnnen. Alle an
dem Verschlage beim Aneinanderstoßen der Bretter etc. allenfalls entstehenden Fugen
werden zur Verhinderung eines Entweichens der Duͤnste mit Leinwandstreifen
und einem aus Leim und Kreide gefertigten Kitt verklebt, zulezt auch noch mit Firniß
uͤberstrichen, damit der Leim nicht erweichen kann.
In anderen Fabriken jener Gegend bedient man sich zum Aufruͤhren der
gaͤhrenden Fluͤssigkeit zwar ebenfalls solcher Kruͤken, die
Handhaben derselben gehen aber durch die Seitenwand des
Fluͤssigkeitsbehaͤlters heraus, und uͤberdieß ist die
Einrichtung getroffen, daß man einen Theil der Oberflaͤche der
gaͤhrenden Fluͤssigkeit (zur Absorption von Sauerstoff) in
Beruͤhrung mit der Luft kommen laͤßt, was dadurch erzielt wird, daß
man die eine Seite des Bretterverschlags (Fig. 6) in den Kasten
zuruͤksezt, so zwar, daß der Raum im Inneren des Kastens von dem
aͤußeren getrennt ist, aber die Fluͤssigkeit (deren Niveau a, a bezeichnet) unterhalb demselben eine Masse ausmacht.
An jedem Kasten werden auch einige Zapfen zum Ablassen der Fluͤssigkeit
angebracht.
Zum Heizen dieser Kammern dienen ebenfalls steinerne, auf ihrer Sohle angebrachte und von Außen
heizbare Canaͤle, welche in das zweite Stokwerk senkrecht emporsteigen und
sich dann in Blechroͤhren endigen, die den Rauch in ein Kamin
fuͤhren.
Die Verkalkung wird in einer solchen Looge folgender Maßen betrieben. Die
uͤber dem Fluͤssigkeitsbehaͤlter durch den Verschlag
eingeschlossenen Lattengeruͤste werden mit Bleiplatten von 2 Fuß Hoͤhe
und beilaͤufig 1 Fuß Breite, welche in der Dike eines halben Kronenthalers
gegossen sind, behangen, jedoch so, daß zwischen ihnen ein gehoͤriger Raum
zum Durchdringen der Daͤmpfe bleibt. In den
Fluͤssigkeitsbehaͤlter (die eingeschlossenen Kaͤsten) kommt als
Verkalkungsmittel ein zur duͤnnen Consistenz gebrachtes Gemisch von
Weinbeeren und Wasser, welches uͤberdieß mit bereits gegohrener Bruͤhe
versezt ist; die Heizung wird so geleitet, daß im oberen Theile der Looge die
Temperatur stets 35° R. betraͤgt; das Verkalkungsgemisch geht dann in
geistige und saure Gaͤhrung uͤber und entbindet Essigedaͤmpfe
und kohlensaures Gas zu gleicher Zeit; um lezteres in noch groͤßerem Maaße zu
erzeugen, wird die Fluͤssigkeit von Zeit zu Zeit auch noch mit ungegohrenem
Gute versezt. Waͤhrend der Gaͤhrung muß die Fluͤssigkeit mit
den Ruͤhrscheiten oͤfters bewegt werden. In einigen Fabriken pflegt
man das Verkalkungsmittel, nachdem es vollstaͤndig in saure Gaͤhrung
uͤbergegangen ist, abzulassen, um es zur Bleizukerfabrication zu verwenden;
wo dieses nicht der Fall ist, kann man uͤberdieß auch die
gewoͤhnlichen Bier- und Branntweinmaischen dazu verwenden. Es versteht
sich von selbst, daß die Weinbeeren auch durch Trauben und uͤberhaupt alle
Fruͤchte, welche zukerhaltige Saͤfte liefern, ersezt werden
koͤnnen.
Das Blei kann nach 8 bis 10 Wochen herausgenommen werden, in welcher Zeit es
gewoͤhnlich die Haͤlfte seines Gewichts Bleikalk liefert; die nach dem
Abklopfen desselben zuruͤkbleibenden kleineren Bleistuͤke, welche sich
nicht mehr aufrollen und aufhaͤngen lassen, muͤssen umgeschmolzen
werden, wobei sich eine nicht unbedeutende Menge Bleiasche abscheidet, welche
entweder an die Toͤpfer zur Glasur abgesezt oder auf Bleizuker verarbeitet
oder auch zu Metall reducirt werden kann. Am vortheilhaftesten ist es immer, wenn
man diese und alle uͤbrigen Abfaͤlle bei der Bleiweißfabrication auf
Bleizuler zu verarbeiten Gelegenheit hat.
III. Ueber die Reinigung des nach den
angegebenen Methoden gewonnenen Bleikalks und die Verfahrungsarten, wodurch das
Bleiweiß harr gemacht wird.
Die Art der Verkalkungsweise hat auf die Schoͤnheit des producirten Bleikalks
einen bedeutenden Einfluß. Da der Pferdemist bei seiner Faͤulniß etwas Schwefelwasserstoffgas
entbindet, so wird bei dem sogenannten hollaͤndischen Verfahren der Bleikalk
auch nicht selten von gebildetem Schwefelblei geschwaͤrzt, was nicht so
leicht bei der Verkalkung des Bleies in Kisten und nie bei der in Klagenfurt etc.
uͤblichen Fabricationsart der Fall ist; durch leztere erhaͤlt man
uͤberhaupt das reinste und schoͤnste Bleiweiß, welches noch immer
unter dem Namen Cremserweiß im Handel als erste Sorte
seinen Ruf behauptet. Der Bleikalk mag uͤbrigens nach was immer fuͤr
einer Methode gewonnen worden seyn, so enthaͤlt er stets etwas essigsaures
Blei (Bleizuker); bei der Klagenfurter Fabricationsweise kann sein Bleizukergehalt
sogar bis auf 10 Proc. steigen. Um das gewonnene basisch kohlensaure Blei von dem
darin enthaltenen Bleizuker zu befreien, hauptsaͤchlich aber, um einen gelblichen oder braͤunlichen Farbstoff zu beseitigen, welcher seine Weiße mehr oder
minder beeintraͤchtigt, ist es daher noͤthig dasselbe
auszuwaschen.
Zu diesem Behufe wird der abgeklopfte Bleikalk unter Rollsteinen zerdruͤkt und
in einem Kasten durchgesiebt, theils um ihn im Wasser feiner zertheilen zu
koͤnnen, hauptsaͤchlich aber um das zufaͤllig in ganz kleinen
Stuͤken unter den Bleikalk gekommene metallische Blei, welches beim Mahlen
dem Bleiweiß eine graue Farbe ertheilen wuͤrde, wegzuschaffen. Hierauf wird
das Pulver in großen hoͤlzernen Kaͤsten oder anderen Behaͤltern
in Wasser eingeruͤhrt und das nach 24 Stunden abgezogene gefaͤrbte
Wasser so oft wieder ersezt und abgezogen, als es sich noch einiger Maßen
faͤrbt. In dem Waschwasser ist nun offenbar das aus dem Bleikalk ausgezogene
essigsaure Blei, wenn derselbe (wie nach dem hollaͤndischen Verfahren
bereiteter) nur wenig davon enthielt, in so
verduͤnntem Zustande, daß es sich kaum der
Muͤhe lohnt dasselbe durch Faͤllung mit chromsaurem Kali etc. zu
verwerthen; mit dem nach der Klagenfurter Methode gewonnenen Bleikalk hingegen,
dessen Bleizukergehalt betraͤchtlich ist, laͤßt sich eine
concentrirtere, zum Eindampfen und Krystallisiren geeignete Bleizukerloͤsung
gewinnen, indem man die schwachen Waschwasser wiederholt zum Aussuͤßen
frischen Bleikalks benuzt.
Das zum Aussaͤßen des Bleikalks dienliche Wasser soll moͤglichst wenig
kohlensauren Kalk enthalten, weil der braͤunliche Farbstoff mit dieser Basis
eine unaufloͤsliche Verbindung eingeht, auch frei von Eisen und
Schwefelwasserstoff seyn. Kohlensaurer Kalk macht uͤberdieß, wenn er rein
ausgewaschenem Bleiweiß zugesezt wird, durch seine Reaction auf das Leinoͤhl
den Bleiweißfirniß nach und nach gelblich.
Das ausgewaschene Bleiweiß wird nun auf den sogenannten nassen Muͤhlen so oft
unter einem fester aufliegenden Laͤufer durchgemahlen, bis es einen diklichen
feinen Brei vorstellt, an dem durchaus keine koͤrnigen Theile mehr wahrzunehmen sind.
Derselbe ist dann nochmals mit reinem Wasser auszusuͤßen.
Manche Fabriken pflegen diesen gemahlenen Bleikalk nun sogleich mit einem
Bindungsmittel zu versezen und dann in den Formen zu troknen; allein der Bleikalk
enthaͤlt so wie er von der Muͤhle kommt, eine Menge Luftblasen, welche
das Bleiweiß loker und loͤcherig machen, indem sie besonders nach dem Zusaze
des Bindungsmittels nicht mehr heraustreten koͤnnen. Um sie zu beseitigen,
muß man den gemahlenen Brei in einer Menge Wasser zertheilen, das Bleiweiß sich
absezen lassen und ihm dann erst das geeignete Bindungsmittel einverleiben.
Um das Bleiweiß fest und hart zu machen, benuzt man als Verdikungsmittel:
a) eine duͤnne Loͤsung vom besten
arabischen Gummi.
b) eine Loͤsung von neutralem Bleizuker in Wasser,
die man im Verhaͤltniß von 6 bis 8 Proc. dem Bleiweiß zusezt; sie ertheilt
ihm jedoch nur eine maͤßige Haͤrte.
c) Staͤrkegummi, welches man erhaͤlt, wenn
man 10 Pfd. Staͤrke in 200 Pfd. Wasser zu Kleister kocht, denselben mit 2
Loth concentrirter Schwefelsaͤure, die vorher mit Wasser verduͤnnt
wurden, in einem Staͤndchen vermischt und dann durch eingeleiteten Dampf 1
bis 2 Stunden lang im Kochen erhaͤlt, worauf man die Saͤure
neutralisirt und die Fluͤssigkeit vom Saze abfiltrirt.
Diese Fluͤssigkeiten werden unter den Bleiweißbrei geruͤhrt, ehe man
denselben in die uͤblichen runden oder vierekigen Formen fuͤllt, und
zwar in einem um so groͤßeren Maaße, je mehr Haͤrte man erzielen will.
Unausgewaschener Bleikalk wird wegen seines
Bleizukergehalts nach dem Mahlen und Troknen von selbst hart.
Die lufttrokenen Brode muß man in einem auf beilaͤufig 20° R. geheizten
Local noch vollends austroknen, damit sie moͤglichst weiß und
glaͤnzend werden.
IV. Bereitung geringerer Sorten von
Bleiweiß, durch Vermengung desselben mit weißen Stoffen.
Zum Versezen des Bleiweißes, um billigere Sorten fuͤr schlechteren Anstrich
herzustellen, benuzt man hauptsaͤchlich Schwerspath (schwefelsauren Baryt),
Kalkspath (kohlensauren Kalk), Kreide und weiße Thonarten. Von diesen
Koͤrpern muß man immer die weißesten Sorten waͤhlen, alle
eisenhaltigen Stuͤke aus ihnen entfernen, sie vor dem Vermengen mit dem
Bleiweiße hoͤchst fein mahlen, dann mit dem Bleikalk selbst einige Mal durch
die Muͤhle gehen lassen und endlich den Brei zur Austreibung der Luftblasen
erst wieder in Wasser
zertheilen. Uebrigens wird so verseztes Bleiweiß gerade so wie reines hart
gemacht.
Schwerspath allein sollte man nur dann anwenden, wenn das
Bleiweiß nicht uͤber 50 Proc. Zusaz erhaͤlt. Versezt man es in
groͤßerem Verhaͤltniß damit, so ertheilt er ihm zu viel Rauheit; beim
Anstrich verhaͤlt sich die Masse dann pelzig und faserig und legt sich also
nicht gut an das Holz.
Dagegen ertheilt gut sortirter und ausgewaschener Thon der
Masse mehr Geschmeidigkeit und Zaͤhigkeit.
Nicht selten kommen auch sogenannte geringe Bleiweißsorten vor, welche bloß aus einem
Gemenge von Schwerspath mit Thon und Kreide bestehen und deren man sich zum
Voranstrich oder zur Grundisrung bedient.
Kalkspath koͤnnte zwar als ein sehr weißer
Koͤrper recht gut zum Versezen des Bleiweißes angewendet werden, allein es
ist entschieden, daß er ihm die Eigenschaft ertheilt, nach dem Abreiben mit Oehl
gelb zu werden; in Leim hingegen haͤlt solches Bleiweiß gut Stand, und wenn
daher eine geringe Bleiweißsorte bloß zu Wasserfarben verwendet werden soll, kann
man den Bleikalk wohl mit Kalkspath versezen.
Wegen der Eigenschaft des kohlensauren Kalks, das mit Oehl abgeriebene Bleiweiß gelb
zu machen, ist man auch in solchen Fabriken, wo man sich nur kalkspathhaltigen
Schwerspath verschaffen kann, genoͤthigt, denselben mit Schwefelsaͤure
zu behandeln und zur Entfernung des gebildeten schwefelsauren Kalks oͤfters
auszuwaschen. Salzsaͤure, worin sich der Kalkspath unter Aufbrausen leicht
und vollstaͤndig aufloͤst, waͤre zur Reinigung des Schwerspaths
offenbar vorzuziehen; diese Saͤure gibt auch den Bleiweißfabrikanten ein
gutes Mittel an die Hand, ihren Schwerspath auf seine Reinheit zu untersuchen.Hinsichtlich der Untersuchung des Vleiweißes auf fremde
Beisaͤze verweisen wir auf Schubarth's Elemente der technischen Chemie. (Berlin 1832) Bd. II. S. 219.
B. Fabrication
des neutralen Bleiweißes.
Neutrales kohlensaures Bleioxyd wird durch die Faͤllung irgend eines
aufloͤslichen Bleisalzes, z. B. einer Aufloͤsung von Bleizuker oder
von salpetersaurem Bleioxyd, durch Potasche oder ein anderes kohlensaures Alkali
erhalten. Diese Methode ist jedoch fuͤr die Ausuͤbung im Großen zu
kostspielig; diejenige, deren man sich in neuerer Zeit, besonders in Frankreich, zur
Darstellung des neutralen Bleiweißes in den Fabriken
bedient hat, beruht auf der Faͤllung des kohlensauren Bleioxyds aus einer
Aufloͤsung des basischen essigsauren Bleioxyds (Bleiessigs) mittelst der
Kohlensaͤure. Das basische essigsaure Bleioxyd hat naͤmlich die
Eigenschaft, daß aus seiner Aufloͤsung derjenige Antheil des Bleioxyds, den
es mehr enthaͤlt, als das neutrale essigsaure Bleioxyd, durch
Kohlensaͤure ausgefaͤllt wird. Eine Aufloͤsung von 100 Theilen
neutralen essigsauren Bleioxyds (aus 31,6 Essigsaͤure und 68,4 Bleioxyd)
nimmt noch 137 Theile Bleioxyd auf; wird nun diese basische Salzaufloͤsung
mit Kohlensaͤure in Beruͤhrung gebracht, so werden jene 137 Theile
Oxyd in Verbindung mit 27,1 Theilen Kohlensaͤure ausgeschieden, und es bleibt
die neutrale essigsaure Bleioxydaufloͤsung wieder zuruͤk.
Wenn man die im Handel vorkommende Bleiglaͤtte zur
Bereitung des Bleiessigs anwenden will, so muß sie zuerst gelinde ausgegluͤht
werden, weil das neutrale essigsaure Bleioxyd das kohlensaure Bleioxyd nicht
aufloͤst. Nach folgendem Verfahren kann man sich selbst in Zeit von 12
Stunden 8–10 Cntr. Bleiglaͤtte (sey es fuͤr diesen Zwek oder
zur Bleizukerfabrication) bereiten: Man bringt in einem gewoͤhnlichen
Reverberir- oder Flammofen, dessen Heerd aus einer eisernen Platte oder
festgemauerten flachen Schale besteht und der mit niedrigem Gewoͤlbe, starkem
Feuerraum und Sattel, ferner mit einem gut zu regulirenden Kamine versehen ist, wenn
er die Rothgluͤhhize erreicht hat, einen Blok von einigen Centnern
metallischen Bleies, welches bald in Fluß kommt und sich oxydirt, was man durch
Umruͤhren (wobei uͤbrigens der Zug des Feuers der Verstaͤubung
wegen gut geleitet werden muß) zu befoͤrdern sucht. Nach kurzer Zeit ist
alles Blei in Bleiasche verwandelt, die man nun durch weitere Erhizung beim Zutritt
von Luft durch die Eintragthuͤre des Reverberirofens in den Zustand von
Glaͤtte uͤberzufuͤhren sucht. Nach vorausgegangener
laͤngerer Erhizung wird dann ein zweiter Bleiblok eingetragen und zwar unter
das Bleioxyd vergraben, die Erhizung hierauf weiter fortgesezt und endlich
aufgeruͤhrt, wobei man meistens den Bleiblok schon zum groͤßten Theil
oxydirt findet, was fast augenbliklich vollends der Fall ist, wenn man das noch
vorhandene schmelzende Blei mit dem Bleioxyd hin und her bewegt. Nach wieder
erfolgter Oxydation wird ungefaͤhr so viel Bleiglaͤtte ausgezogen, als
von einem Bloke producirt wurde, der Rest aber weiter erhizt, um spaͤter
wieder einen Blok darin zu vergraben, und auf diese Art die Operation der Verkalkung
oder Oxydation immer fortgesezt.
Um die Gesundheit der Arbeiter zu schonen, kann die Oeffnung zum Ausziehen oder
Ausschieben der Glaͤtte aus dem Ofen der Eintragoͤffnung
entgegengesezt, in ein anderes Local gehen, so daß in dem Local, worin sich der Ofen
befindet, keine Verstaͤubung Statt findet. Die ausgezogene Glaͤtte
wird naß gemahlen, getroknet, und dann zu feinem Staube gesiebt. Man erhaͤlt
von 100 Pfd. Blei ungefaͤhr 102 Pfd. Bleiglaͤtte.
Zur Bereitung des basischen essigsauren Bleioxyds eignen sich die
gewoͤhnlichen kupfernen Kessel mit ihrer Feuerungseinrichtung nicht, sondern
dieselben muͤssen mit ebenem Boden versehen seyn, und es duͤrfen nur
ihre Seitenwaͤnde vom Feuer bestrichen werden, damit sich die auf dem Boden
befindliche Glaͤtte nicht verkrusten kann. Die Groͤße und Anzahl der
Kessel richtet sich natuͤrlich nach der Ausdehnung der Fabrication; der
Vortheil des Fabrikanten erheischt uͤbrigens, daß fuͤr die
Kohlensaͤure-Pumpen bestaͤndig eine hinreichende Menge
Bleiessigloͤsung vorhanden ist.
In diesen Kesseln erwaͤrmt man nun behufs der Bleiessigserzeugung entweder
reinen (destillirten) Essig oder Bleizukerloͤsung mit einem Ueberschuß der
gepulverten Glaͤtte unter bestaͤndigem Umruͤhren ein paar
Stunden lang. Nach einiger Ruhe zieht man dann die helle Fluͤssigkeit ab,
bringt wieder Glaͤtte in den Kessel und fuͤllt ihn neuerdings mit
Essig oder Bleizukerloͤsung u. s. f.
Umstaͤndlich und kostspielig ist bei dieser Fabricationsart des Bleiweißes die
Gewinnung der Kohlensaͤure, wenn man nicht Gelegenheit hat, ein viel
kohlensaures Gas entbindendes Mineralwasser benuzen zu koͤnnen; in lezterem
Falle kann sie sogleich durch gewoͤhnliche Pumpen oder archimedische Schneken
unter die Bleiessigloͤsung getrieben werden. Erzeugt man sie aber durch
Verbrennen von Kohlen, so muß sie jedenfalls zuvor behufs ihrer Reinigung unter
Wasser gepumpt werden.Die Kohlensaͤure, mit welcher die
Faͤllung bewirkt wird, kann nach irgend einer der
gewoͤhnlichen Methoden erzeugt werden, je nachdem die eine oder
andere fuͤr die Localitaͤt wohlfeiler kommt; durch Zersezung
von Kreide oder kohlensaurem Kalk mittelst der Schwefelsaͤure, oder
der Holzsaͤure, wobei man den erhaltenen holzsauren Kalk weiter
verwenden kann; durch gaͤhrende Fluͤssigkeiten, die man dann
zum Branntweinbrennen verwendet; oder aus brennenden Holzkohlen. Die leztere
Art ist bei dieser Methoͤde die gewoͤhnlichste. Man sammelt
das kohlensaure Gas unter einem mit Wasser gesperrten Gasometer, und
laͤßt es von hier durch bleierne Roͤhren entweder unmittelbar
in den Bleiessig treten, welcher in diesem Falle in flachen Gefaͤßen
steht, die nur 3 bis 4 Zoll hoch mit demselben angefuͤllt sind, so
daß das Gas, welches durch eine große Menge kleiner Roͤhren, in
welche die Hauptroͤhre sich endigt, und welche von Oben in die
Fluͤssigkeit treten und bis nahe auf den Boden reichen, keinen so
großen Druk zu uͤberwinden hat; oder man zieht das Gas aus dem
Behaͤlter durch eine Pumpe, und man druͤkt es mittelst dieser
durch die Fluͤssigkeit, in welchem Falle diese auch in tieferen
Gefaͤßen stehen kann. Lezteres hat den Vortheil, daß man an Raum
erspart, und daß man das Gas, bevor es in die Bleiaufloͤsung tritt,
noch erst durch ein Gefaͤß mit Kalkwasser treiben kann, damit es hier
noch fremdartige, besonders schweflige und oͤhlige Theile abseze.
Benuzt man das Gas aus brennenden Holzkohlen, so ist der obere Theil des
Windofens, in welchem die Kohlen brennen, mit einem blechernen, ringsum
verschlossenen, kegelfoͤrmig zugehenden Mantel versehen, von welchem
eine Roͤhre aufwaͤrts, dann seitwaͤrts, und dann wieder
aufwaͤrts bis unter den aus Eisenblech verfertigten Gasometer geht,
die an ihrem uͤber das Wasser des Gasometers hervortretenden Ende mit
einer leicht beweglichen Klappe verschlossen ist. Wird der Gasometer in die
Hoͤhe bewegt, so erfolgt der Luftzug durch den Rost des Windofens und
der Gasometer fuͤllt sich mit der Luft, die durch den Feuerheerd
streicht, die dann von hier aus durch eine zweite Roͤhre, deren
Oeffnung mit einer einwaͤrts gehenden Klappe verschlossen ist, an den
beliebigen Ort geleitet werden kann.Ohne Gasometer kann die Bleiaufloͤsung mit der aus den brennenden
Kohlen kommenden Kohlensaͤure auf folgende Art in Beruͤhrung
gebracht werden. Eine aufrecht stehende Tonne ist oben statt des Bodens oder
Dekels mit einem flachen Gefaͤße aus Blei verschlossen, dessen Boden
gleich einem Siebe mit vielen Loͤchern durchbohrt ist, und dessen
Seitenwaͤnde 4–6 Zoll Hoͤhe haben. In diesen Bottich
tritt die von dem Windofen kommende Zugroͤhre in der Haͤlfte
seiner Hoͤhe ein, und an der gegenuͤberstehenden Seite tritt
dieselbe wieder aus, um weiter fort in einen Rauchfang geleitet zu werden.
Die Bleiaufloͤsung wird in das durchloͤcherte Gefaͤß
geschuͤttet, wo sie in Gestalt eines Regens der durchziehenden
kohlensauren Luftart begegnet. Durch den Hahn am Boden des Bottichs wird sie
abgezapft und wieder aufgegossen, bis die Faͤllung gehoͤrig
erfolgt ist. Damit der Luftzug aus dem Feuerheerde hinreichend stark
erfolge, ist der Windofen mit einem Geblaͤse versehen, dessen
Muͤndung entweder unmittelbar unter den Rost in den uͤbrigens
luftdicht verschlossenen Aschenfall tritt, oder erst in einen
unverschlossenen Behaͤlter (Windkammer), von welchem dann die Luft
durch eine Roͤhre in den Aschenraum stroͤmt; das leztere aus
dem Grunde, um einen ununterbrochen gleichfoͤrmigen Luftstrom zu
erhalten. Damit die kohlensaure Luft, bevor sie mit der
Bleiaufloͤsung in Beruͤhrung kommt, hinreichend
abgekuͤhlt sey, laͤßt man sie erst durch ein hinreichend
weites Schlangenrohr streichen, das in einem Bottich mit kaltem Wasser sich
befindet.Die Kohlen, welche zum Verbrennen in dem Windofen verwendet werden,
muͤssen voͤllig ausgebrannt oder verkohlt seyn, sonst geben
sie beim Verbrennen noch brenzliches Oehl, welches das Bleiweiß
verunreinigt. Man gluͤht sie daher vor dem Gebrauche erst noch ein
Mal im Verschlossenen aus. Das Nachfuͤllen der Kohlen in den Windofen
geschieht durch ein seitwaͤrts und nahe senkrecht von dem Mantel
desselben ausgehendes Rohr, dessen Oeffnung mit einem lutirten Dekel
verschlossen wird.Sonst kann zu diesem Behufe das kohlensaure Gas auch aus Kohle und Braunstein
entbunden werden. Man vermengt beide gepulvert in dem Verhaͤltnisse
von 24 Theilen Braunstein und 7 Theilen Kohle mit einander, welchem Gemenge
man noch 4 Theile Kreide und so viel Wasser zusezt, um einen
gleichfoͤrmigen Teig daraus zu machen, den man troknen laͤßt,
und dann in einen Cylinder von Gußeisen, der mit der gehoͤrigen
Gasentbindungsroͤhre versehen ist, fuͤllt, diesen verschließt,
und zur Rothgluͤhhize bringt, wo sich dann durch die Verbrennung der
Kohle mittelst des Sauerstoffes des Braunsteins eine Mengr kohlensaures Gas
entbindet. Bei dieser Methode kann eben sowohl, als bei der Entwiklung der
Kohlensaͤure aus Kreide durch Schwefelsaͤure in einem
Gasentbindungsapparate, oder bei der Anwendung einer Drukpumpe, das
entwikelte Gas einen maͤßigen Druk uͤberwinden, daher mit der
Bleiaufloͤsung in der Art in Beruͤhrung gebracht werden, daß
dieselbe bei einer hoͤheren Fluͤssigkeitssaͤule
durchstrichen wird, auch, wenn die Gefaͤße verschlossen sind, die
Luft von einem in das andere, wie in einem Woulf'schen Apparate treten kann. (Prechtl's technologische Encyklopaͤdie, Bd. II. S. 469.)A. d. R.
Nachdem in die Bleiessigloͤsung so lange kohlensaures Gas geleitet worden ist,
bis sie das blaue Lakmuspapier zu roͤthen anfaͤngt, laͤßt man
das gebildete kohlensaure Blei (neutrale Bleiweiß) sich absezen, worauf die
Fluͤssigkeit durch Digestion mit Bleiglaͤtte in Bleiessig verwandelt
wird u. s. f. Das Wasser, womit das Bleiweiß ausgewaschen wurde, wird statt reinen Wassers bei den
folgenden Operationen zum Aufloͤsen von Bleizuker benuzt.
Bei diesem Verfahren hat man den Vortheil, daß man 1) selbst mit unreiner
Glaͤtte oder schlechtem, in Glaͤtte verwandeltem Blei ein ganz reines
Bleiweiß zu erzeugen im Stande ist, indem die Kohlensaͤure selbst aus einer
unreinen Bleiaufloͤsung nur kohlensaures Bleioxyd niederschlaͤgt und
2) daß eine gewisse ein Mal angewandte Menge Essig oder Bleizuker sehr lange zur
Bereitung des basisch essigsauren Bleioxyds gebraucht werden kann und nur in dem
Maaße ersezt werden muß, als durch die Arbeit selbst an Fluͤssigkeit verloren
geht.
Das auf diese Art erhaltene neutrale Bleiweiß ist nun zwar
sehr weiß und fein zertheilt, aber es dekt nicht so gut wie
das basische, indem es eine weniger erdige Beschaffenheit hat und seine
kleinsten Theile eine Neigung zum Krystallisiren besizen; es ist daher in der Regel
auch weniger compact, als das basische Bleiweiß, und um
es diesem in dieser Hinsicht aͤhnlich zu machen ist man genoͤthigt, es
bei der Einfuͤllung in die kleinen Toͤpfe einer
kuͤnstlichen Pressung zu unterwerfen.
Zusaz der Redaction.Ueber die
Bereitung von Bleiweiß aus granulirtem Blei nach Prechtl.
Hr. Director Prechtl schlaͤgt in seiner
technologischen Encyklopaͤdie Bd. II. S. 464 eine
Methode zur Darstellung des basischen Bleiweißes vor,
welche im Großen da, wo man uͤber eine wohlfeile mechanische Kraft disponiren
kann, wahrscheinlich mit Vortheil ausfuͤhrbar ist. Er hat dieselbe zwar nur
im Kleinen versucht, allein sie ist von der Art, daß die Ausfuͤhrung im
Großen keine vermehrten Schwierigkeiten mir sich bringt. Man granulire reines Blei,
indem man dasselbe durch einen heißen Loͤffel gießt, der in Gestalt eines
Seihers durchbrochen ist, so daß es von einiger Hoͤhe in kaltes Wasser
faͤllt. Von diesem, je feiner desto besser, granulirten Blei schuͤtte
man eine Quantitaͤt in ein cylindrisches, etwas flaches Gefaͤß, z. B.
eine Schuͤssel aus Steingut; gieße Wasser darauf, in welchem man etwa 1/10
seines Gewichts guter Potasche aufgeloͤst hat; und ruͤhre nun das Blei
mit der Potascheaufloͤsung fortwaͤhrend untereinander. Die
Fluͤssigkeit wird bald milchig, so daß sie etwa nach einer Stunde von dem
Blei abgegossen und zum Sedimentiren hingestellt werden kann. Es sezt sich bald ein
schoͤnes, dichtes und schweres Bleiweiß aus derselben ab, von dem die
Fluͤssigkeit abgegossen und neuerdings uͤber das granulirte Blei
geschuͤttet wird, mit welchem man dann das Zusammenruͤhren fortsezt.
Das sedimentirte Bleiweiß wird mit Wasser ausgewaschen, und dieses Waschwasser der
uͤbrigen Fluͤssigkeit zugefuͤgt. Auf diese Art wird der Proceß
immer fortgesezt, und man braucht zu demselben außer dem Blei eigentlich kein
weiteres Material, da von der ein Mal aufgewendeten Potasche nichts, oder doch nur
wenig verloren geht, indem auch die schwaͤchern Waschwasser noch verwendet
werden koͤnnen.
In diesem Processe oxydirt sich das Blei auf Kosten des im Wasser enthaltenen
Sauerstoffgases, und das Oxyd verbindet sich im Augenblike seiner Entstehung mit der
Kohlensaͤure der Potasche, die diese wieder in dem Maaße, als sie sie an das
Bleioxyd abgibt, aus der Atmosphaͤre anzieht. Auch durch die Bewegung des
Bleischrotes mit bloßem Wasser an freier Luft erfolgt die Bleiweißbildung, aber
langsamer, und das erhaltene Bleiweiß ist weniger rein, naͤmlich noch mit
einem graulichen Oxyde gemischt, das erst, laͤngere Zeit an der Luft im
befeuchteten Zustande erhalten, sich in Bleiweiß umaͤndert. Hievon erhellen
die Gruͤnde aus Folgendem: Schuͤttelt man granulirtes Blei mit reinem
Flußwasser in einer verstoͤpselten Flasche, so bildet sich ein graues Oxyd in
bedeutender Menge, das alkalische Eigenschaften zeigt, indem es das durch
Saͤuren geroͤthete Lakmuspapier blaͤuet, und das
Kurkumaͤpapier schwach braͤunt. An der Luft zieht dieses Oxyd, wenn es
bestaͤndig feucht erhalten und umgeruͤhrt wird, langsam
Kohlensaͤure an, und verwandelt sich allmaͤhlich in Bleiweiß.
Verrichtet man das Schuͤtteln in der Flasche in der Art, daß man
oͤfters Luft eintreten laͤßt, so wird ein Theil des Oxyds kohlensauer,
und man erhaͤlt Bleiweiß mit grauem Oxyd gemengt, das nach und nach an der
Luft weißer wird. Will man das Bleiweiß sogleich so viel moͤglich von dem
grauen Oxyd gereinigt erhalten, so darf daher die durch das Schuͤtteln oder
Umruͤhren des Bleischrots mit dem Wasser eingeleitete Oxydation nicht
schneller vor sich gehen, als die Zuleitung der Kohlensaͤure zu dem in der
Bildung befindlichen Oxyde. Da nun die Aufloͤsung des Aezkali die
Kohlensaͤure schneller anzieht, als das Wasser, so wirkt sie schneller als
lezteres, und die Bleiweißerzeugung wird in diesem Processe um so schneller vor sich
gehen, je schneller die Bewegung des Bleischrots mit dem Wasser erfolgt, je mehr das
Wasser Potasche enthaͤlt und je mehr Kohlensaͤure sich in der
umgebenden Luft befindet.
Um diesen Proceß im Großen auszufuͤhren, duͤrfte es am
zwekmaͤßigsten seyn, das granulirte Blei mit der Fluͤssigkeit in
cylindrische, aus Blei gegossene Gefaͤße, etwa 2 Fuß im Durchmesser und 18
Zoll hoch, zu fuͤllen, ein solches Gefaͤß mit einem Ruͤhrkreuze
aus Holz oder Blei
zu versehen, und eine Anzahl solcher Gefaͤße an die Peripherie eines großen
Stirnrades zu stellen, dessen Zaͤhne in das an der Achse des
Ruͤhrkreuzes befestigte Getriebe eingreifen und das Kreuz umdrehen. Die
Gefaͤße koͤnnen etwas erhoͤht gestellt werden, um die mit
Bleiweiß beladene Fluͤssigkeit von Zeit zu Zeit in ein rieferes
Sedimentirgefaͤß abzulassen. Indem man in diesem Arbeitsraume ein schwaches
Kohlenfeuer unterhielte, koͤnnte man die Zufuͤhrung der
Kohlensaͤure vermehren.
Will man nach dieser Art das Bleiweiß ohne Anwendung von Potasche erzeugen, so muß
man das Schuͤtteln des Bleies mit reinem Wasser (Flußwasser) in einem sich um
seine Achse drehenden Fasse bewerkstelligen, und das sich aus dem abgelassenen
Wasser absezende graue Oxyd in Form eines Breies, den man in flachen Gefaͤßen
ausbreitet und von Zeit zu Zeit umruͤhrt, in einem Raume, dessen Luft
Kohlensaͤure enthaͤlt, allmaͤhlich in Bleiweiß
uͤbergehen lassen.
Das nach diesem Processe dargestellte Bleiweiß enthaͤlt immer noch metallische
Bleitheile eingemengt, von denen es durch Schlaͤmmen befreit werden muß.
Tafeln