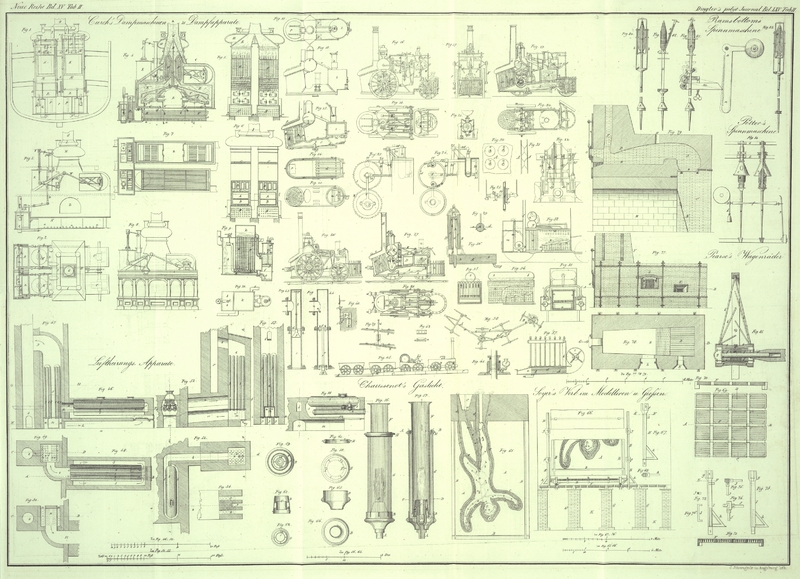| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zum Fortschaffen von Gütern und Reisenden zu Land und zu Wasser, welche zum Theil auch auf gewöhnliche Dampfmaschinen und andere Dampfapparate anwendbar sind, und woraus sich William Church von Heywood House, in der Grafschaft Warwick, am 16. März 1835 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. XXV., S. 92 |
| Download: | XML |
XXV.
Verbesserungen an den Apparaten zum Fortschaffen
von Guͤtern und Reisenden zu Land und zu Wasser, welche zum Theil auch auf
gewoͤhnliche Dampfmaschinen und andere Dampfapparate anwendbar sind, und woraus
sich William Church von
Heywood House, in der Grafschaft Warwick, am 16. Maͤrz 1835 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Februar und
Maͤrz 1837.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Church's Verbesserungen an den Dampfmaschinen fuͤr
Dampfboote und Dampfwagen.
Nach den Angaben des Patenttraͤgers bestehen seine unter obigem Patente
begriffenen Erfindungen in gewissen Zusaͤzen und Modificationen an den
Dampfapparaten und Maschinerien, auf welche ihm unterm 29. Novbr. 1830, 9. Febr.
1832, und 7. Sept. 1833 Patente ertheilt wurden.Man kann diese drei Patente, deren Einsicht zur vollkommenen
Verstaͤndigung und Wuͤrdigung der neueren Erfindungen des
Patenttraͤgers beinahe unumgaͤnglich nothwendig ist, im Polyt.
Journal Bd. XLIII. S. 1, Bd. XLIX. S. 161, und Bd. LIII. S. 90 nachlesen. Nach dem
Urtheile des London Journal soll Hr. Church durch die weitere Entwikelung, die er
nunmehr seinen Erfindungen gegeben, mehr zur Verbesserung der Dampfmaschinen
beigetragen haben, als seit dem unsterblichen Watt geschehen ist.A. d. R. Sie erstreken sich uͤber den ganzen Bau und die innere Anordnung der
Apparate, diese moͤgen zur See oder auf Fluͤssen, oder als
Locomotivmaschinen oder als stationaͤre Maschinen benuzt werden. Man kann sie
unter folgenden Abschnitten zusammenfassen.
Sie betreffen naͤmlich: 1) einen eigenthuͤmlichen Bau der Kessel, der
Oefen, der Condensatoren oder Verdichter, und der arbeitenden Theile der Maschinen
der Dampfboote, wodurch Raum, Gewicht und Brennmaterial erspart werden soll. 2) eine
verbesserte Methode an jeder Condensations, Dampfmaschine, die Verdichtung des
austretenden Dampfes durch destillirtes Wasser zu bewirken; indem das durch die
Verdichtung gewonnene Wasser wieder in den Kessel zuruͤkgefuͤhrt wird.
Wegen der Reinheit dieses Wassers werden sich in den Kesseln weder
Bodensaͤze, noch Incrustationen bilden, und hieraus wird folgen, daß die
Kessel durch das Feuer weniger Schaden leiden. 3) eine eigene Einrichtung der Kessel
und Maschinen fuͤr Dampfwagen, welche auf Landstraßen zu laufen haben, die
aber mit einigen unbedeutenden Abaͤnderungen auch fuͤr Eisenbahnen
anwendbar sind. 4) in einem verbesserten, große Staͤrke mit großer
Leichtigkeit verbindenden Baue des Gestelles und des Kessels fuͤr
Locomotivmaschinen. 5) in einer neuen Methode den aus den Hochdrukdampfmaschinen austretenden Dampf
mittelst atmosphaͤrischer Luft zu verdichten. 6) in einer
eigenthuͤmlichen Verbindung der Locomotivmaschine mit Wagen, welche auf
Landstraßen fortgeschafft werden sollen. 7) in Verbesserungen an den Raͤdern
fuͤr Locomotivmaschinen. 8) in einer verbesserten Methode den Kolben und die
Kolbenstangen der Dampfmaschinen schluͤpfrig zu erhalten. 9) In einer als
Sicherheitsventil zu gebrauchenden Methode das Feuer in den Dampfmaschinen
auszuloͤschen. 10) endlich in Vorrichtungen, welche an den Landstraßen und
Eisenbahnen angebracht werden sollen, um das Hinansteigen der Dampfwagen
uͤber schiefe Flaͤchen zu erleichtern.
Was die unter dem ersten Abschnitte begriffene eigenthuͤmliche Anordnung der
Kessel, Oefen und arbeitenden Theile eines Dampfbootes angeht, so soll durch sie
moͤglichst an Raum gespart und dabei doch allen Theilen ein mit der Kraft der
Maschine im Verhaͤltnisse stehender Spielraum gestattet werden. Zugleich soll
aber auch Leichtigkeit mit großer Staͤrke und einer großen
Heizoberflaͤche verbunden seyn. Die Kessel koͤnnen, wenn ihrer
aͤußeren Platte eine außergewoͤhnliche Dike gegeben wird, als Gestell
fuͤr die Maschine dienen; oder auch das Gestell kann den Kessel auf die
spaͤter zu beschreibende Weise umgeben. Die Abbildungen werden dieß
anschaulich machen.
Fig. 1 ist ein
Frontaufriß der Maschine zugleich mit einem Querdurchschnitte durch die Zimmerung
eines Bootes. Fig.
2 ist ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht. Fig. 3 gibt einen
seitlichen Aufriß. Fig. 4 zeigt einen senkrechten Laͤngendurchschnitt durch die
Kessel, Oefen, Feuerzuͤge und Verdichter. Fig. 5 ist ein senkrechter
Durchschnitt durch ebendiese Theile nach der durch Punkte angedeuteten Linie a, b in Fig. 4 genommen. Fig. 6 ist ein
aͤhnlicher Durchschnitt nach der punktirten Linie c,
d genommen. Fig. 7 endlich ist ein horizontaler Durchschnitt durch den Verdichter und
Abkuͤhler der einen und den Ofen der anderen Maschine, und zwar nach der in
Fig. 6
angedeuteten Linie e, f.
In allen diesen Figuren sind der Ofen oder die Feuerstelle mit A; das Aschenloch mit B; die verschiedenen
Wasserkammern des Kessels mit C, C; die Bruͤke
des Ofens mit D; die Feuerzuͤge, welche in die
roͤhrenfoͤrmigen, durch die Hauptwasserkammern laufenden und in den
Schornstein G sich oͤffnenden Feuerzuͤge
F fuͤhren, mit E;
die Dampfkammern mit H, H bezeichnet. Man sieht, daß
jede Maschine zwei Kessel, und jeder Kessel zwei von einander getrennte Dampfkammern
hat, die durch die Dampfroͤhren I, I, von denen
die Inductionsroͤhren an die Ventilbuͤchsen herabfuͤhren,
verbunden sind. Es erhellt ferner aber auch, daß jeder Kessel seinen eigenen Ofen
und seine
Feuerzuͤge hat, welche sich in den Schornstein oͤffnen. Die mit K, K bezeichneten Cylinder der Maschinen erhalten den
Dampf durch die Ventilbuͤchsen L, L. M sind die
fuͤr den austretenden Dampf bestimmten Canaͤle, welche vorne an dem
Kessel in die in zwei Theile getheilten Kuͤhlroͤhren
herabfuͤhren. In dem oberen dieser Theile stroͤmt der Dampf in einer,
in dem unteren hingegen in der entgegengesezten Richtung, um durch den Canal O in den Verdichter P, P zu
gelangen, und daselbst, wie spaͤter gezeigt werden soll, mit einem Strahle
kalten destillirten Wassers in Beruͤhrung zu gerathen. Die Luftpumpe ist mit
Q, die zum Abkuͤhlen des destillirten Wassers
bestimmte Kuͤhlkammer mit R bezeichnet. Die
Kolbenstangen S, S sind durch die Querhaͤupter
T, T mit den Stangen U,
U verbunden, die selbst wieder an die geknieten Hebel V, V gefuͤgt sind. Leztere, welche an einer
starken, in Zapfenlagern, die an dem Kessel fixirt sind, laufenden Welle aufgezogen
sind, sind durch die Stangen und Querhaͤupter W,
W mit dem Kniehebel X verbunden, der auf
gewoͤhnliche Weise an der Welle Y des Ruderrades
aufgezogen ist. Leztere Welle laͤuft in Anwellen, die an dem Kessel
festgemacht sind. Z ist der Raum fuͤr den
Heizer.
Die zur Unterhaltung der Verbrennung im Ofen dienende Luft wird, indem sie durch die
in dem aͤußeren Gehaͤuse oder Mantel der Kuͤhlkammern
befindlichen Oeffnungen a, a, a stroͤmt, und
indem sie zwischen den Dampfroͤhren N, N
circulirt, erhizt, waͤhrend sie zugleich auch die Temperatur des
ausstroͤmenden Dampfes vermindert. Sie gelangt dann von hier aus durch die
Oeffnung b, b in das Aschenloch, welches sich unter den
Roststangen c, c befindet, und mit den Thuͤrchen
d, d verschlossen ist. Auf diese Weise wird also
eine bedeutende Menge Waͤrme, die sonst verloren gehen wuͤrde, wieder
an die Kessel zuruͤkgegeben.
Obschon es der Patenttraͤger am geeignetsten fand, die
Luftkuͤhlroͤhren in horizontalen Reihen anzubringen, so
beschraͤnkt er sich doch nicht auf diese Stellung allein; sondern er
behaͤlt sich's vor, ihnen in gewissen Faͤllen eine senkrechte Richtung
zu geben. Er beschraͤnkt sich ferner durchaus auf keine bestimmte Gestalt der
Roͤhren oder Canaͤle, die den austretenden Dampf zu leiten haben;
sondern er bedient sich jeder Form, bei der die groͤßte Oberflaͤche
dem Luftstrome ausgesezt wird.
Das Thuͤrchen e, e dient zum Anschuͤren des
Feuers. f, f zeigt die Lage, in der sich das frische
Brennmaterial befindet; es wird auf den kleinen schief geneigten Roststangen zum
Theil entzuͤndet, um dann auf die Hauptroststangen in dem Ofen A Hinabzugelangen. Der durch die Entzuͤndung der
Steinkohlen auf den schraͤgen Roststangen
f emporsteigende Rauch und Dunst stroͤmt in den
Ofen herab, und wird daselbst bei seinem Durchgange uͤber und durch das
entzuͤndete Brennmaterial verzehrt. Die Feuerzuͤge koͤnnen
vermittelst der am Ruͤken des Aschenloches angebrachten Thuͤrchen g, g gereinigt werden; die Thuͤrchen h, h und i, i dagegen dienen
zur Reinigung der roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge, wenn eine solche
erfordert wird.
Der Kolben der Luftpumpe Q wird folgender Maßen in
Bewegung gesezt. Die Stangen k, k sind einerseits an den
Krummhebeln V, andererseits aber an dem Ende der Hebel
l, l befestigt, welche ihre Stuͤzpunkte in
Zapfen haben, die in die Seitenwaͤnde des Kessels eingelassen sind. Die
anderen Enden dieser Hebel l, l stehen durch
Gelenkstuͤke m, m mit den Querhaͤuptern
n, n, an denen die Kolbenstange der Luftpumpe
festgemacht ist, in Verbindung. Die Querhaͤupter werden bei ihrer Auf-
und Niederbewegung durch die an ihren Enden befindlichen Reibungsrollen zwischen den
parallelen Fuͤhrern o, o geleitet; leztere selbst
sind an den Staͤben sinn, welche quer uͤber den
Kaltwasserbehaͤlter p, p, worin die Verdichter,
Luftpumpen und Refrigeratoren untergebracht sind, laufen. Die zur Speisung der
Kessel mit Wasser dienenden Pumpen lassen sich so anbringen, daß sie gleichfalls
durch das Querhaupt n, n oder auch auf andere geeignete
Weise in Bewegung gesezt werden koͤnnen; sie schoͤpfen ihren Bedarf
aus dem Heißwasserbehaͤlter der Luftpumpe Q.
Die Kolbenstangen der Maschinen wurden durch die mit dem Querhaupte verbundene
Parallelbewegung q, q gefuͤhrt, und die
Dampfventile koͤnnen auf irgend eine entsprechende Methode in
Thaͤtigkeit versezt werden. Hier erhalten sie beispielsweise ihre Bewegung
durch ein an der Welle des Ruderrades angebrachtes Excentricum u; die Fortpflanzung der Bewegung an die Welle w geschieht durch die Stange v.
Der Canal y dient zum Uebergange des destillirten Wassers
aus dem Verdichter in den Heißwasserbehaͤlter der Luftpumpe; und z ist die Roͤhre, durch die es aus der Pumpe in
die luftdichte Kammer des Refrigerators gelangt, von wo aus es in die in dem
Verdichter angebrachte Einsprizroͤhre emporsteigt. Es versteht sich von
selbst, daß die Maschine, die Kessel, die Verdichter und uͤbrigen Theile auf
geeignete Weise und mit gehoͤriger Festigkeit an dem Gebaͤlke des
Bootes fixirt werden muͤssen. Die Darstellung dieser Befestigungsmittel ward
jedoch in der Zeichnung nicht fuͤr noͤthig erachtet, theils weil sie
sich nach der Art des Fahrzeuges richten muͤssen, theils weil sie nicht mit
zu den Erfindungen des Patenttraͤgers gehoͤren. Saͤmmtliche
uͤber dem Verdeke befindliche Theile der Maschine, so wie auch die
Feuerzuͤge muͤssen mit einem Hause, welches eine verschiedene Form haben kann, umschlossen
seyn; doch muß an diesem Hause fuͤr die noͤthigen Thuͤrchen
gesorgt seyn, damit man die Maschine gehoͤrig reinigen und schmieren
kann.
Man wird aus dem Gesagten ersehen, daß saͤmmtliche Theile der Maschine mit
ihren Wellen und Anwellen auf dem Kessel angebracht sind, der also so zu sagen das
Gestell, auf dem die Maschine aufgerichtet ist, bildet. Sollte man jedoch
wuͤnschen, daß der Kessel und der Ofen von der Maschine unabhaͤngig
angebracht waͤre, so koͤnnte man die ganze Anordnung beibehalten, nur
mit dem Unterschiede, daß die Cylinder, die Wellen und die Anwellen an den Seilen
und Enden des Kessels in einem starken eisernen Gestelle ruhen muͤßten. Die
Grundlage des Cylinders der Maschine, so wie auch die Anwellen der Ruderradwelle
bestehen, wie Fig.
8 zeigt, in starken Querplatten oder Staͤben.
Aus Fig. 9 und
10
erhellt der zweite Theil der Erfindungen, der sich auf eine auf die Dampfboote
anwendbare Verbesserung in der Verdichtung bezieht; erstere Figur ist ein
Laͤngendurchschnitt senkrecht durch den Verdichter, die Luftpumpe und den
Refrigerator genommen; leztere zeigt dieselben Theile in einem Grundrisse. Der
verbrauchte Dampf geht aus der Maschine durch die Roͤhre a in die Verdichtungskammer b uͤber, in der er mit einem Strahle kalten, gewaltsam aus dem
sprizkopfaͤhnlichen Ende der Roͤhre c
ausgetriebenen Wassers in Beruͤhrung kommt, und hiedurch auf die
gewoͤhnliche Weise verdichtet wird. Das durch die Verdichtung erzeugte Wasser
gelangt zugleich mit Luft und Dunst aus dieser Kammer durch die Roͤhre d in den Heißwasserbehaͤlter e der Luftpumpe f, deren
Kolben auf irgend eine zwekdienliche Methode von der Maschine her in Bewegung gesezt
wird. So wie dieser Kolben emporsteigt, hebt er das heiße Wasser empor,
waͤhrend die Luft durch die am Scheitel der Pumpe angebrachte Oeffnung h entweicht. Das solcher Maßen emporgehobene Wasser wird
durch die Roͤhre i in das Luftgefaͤß k getrieben, in welchem es durch das Ventil l vermoͤge des Drukes der innerhalb der Kammer
befindlichen comprimirten Luft zuruͤkgehalten wird.
Damit die durch die Pumpe emporgehobene Luft von dem Wasser geschieden werde, und
nicht mit in das Luftgefaͤß k gelangen
koͤnne, ist folgende Vorrichtung angebracht, m
ist ein leicht gebauter Schwimmer, der mit dem von dem Kolben emporgehobenen Wasser
emporsteigt, und der durch ein Gelenkstuͤk mit dem kurzen Hebel n, der seinen Stuͤzpunkt an der inneren Seite der
Pumpe hat, in Verbindung steht. An diesem Hebel ist die Stange des Luftventiles o befestigt, welches, so wie der Schwimmer steigt, und
bevor noch der Kolben an
dem Ende seines Laufes angelangt ist, die Oeffnung k
luftdicht verschließt. Die dem gemaͤß uͤber dem Schwimmer in der Pumpe
zuruͤkbleibende Luft wird also durch die weitere Bewegung des Kolbens
comprimirt, bis ihr Druk die Spannkraft der in der Kammer k eingeschlossenen Luft uͤbersteigt, wo dann das Ventil l alsogleich nachgibt und das Wasser in die Kammer k getrieben wird. Von der Kammer k aus stroͤmt das Wasser durch die Kuͤhlroͤhren p, p, p oder durch andere geeignete Canaͤle in
die untere Kammer q herab, um dann von hier aus in die
oben erwaͤhnte Einsprizroͤhre c zu
gelangen. Das Wasser befindet sich also unter einem elastischen Druke, bis es an dem
sprizkopfaͤhnlichen Roͤhrenende ausgetrieben wird. Die
Kuͤhlroͤhren sind mit einem Kaltwasserbade, welches mittelst einer
Pumpe oder auch auf andere Art durch die Roͤhre r
mit Wasser versehen wird, umgeben. Das Wasser fließt, nachdem es zur
Abkuͤhlung gedient, bei der Roͤhre s
wieder aus. Solcher Maßen wird also das destillirte, durch die Roͤhren p aus der Kammer k herab
gelangende Wasser so weit abgekuͤhlt, daß es zur Erzeugung des
Kaltwasserstrahles benuzt werden kann. Die Kraft oder Gewalt dieses Strahles wird
durch den in der Kammer k Statt findenden Druk und durch
die Oeffnung des bei t angebrachten Hahnes bestimmt. Die
Bewegung des Kolbens nach Abwarts gestattet der in der Pumpe enthaltenen Luft sich
wieder auszudehnen, wo dann das Ventil l geschlossen und
das Wasser in der Kammer k zuruͤkgehalten werden
wird, waͤhrend sich zugleich auch das Ventil des Canales d schließt und bis zum naͤchsten Kolbenhube
geschlossen bleibt.
Es ist nicht durchaus noͤthig, daß die Kammer k,
so wie sie hier beschrieben wurde, ein geflossenes Luftgefaͤß bilde; indem
der Apparat, wenn gleich nicht eben so gut, so doch gleichfalls arbeiten
wuͤrde, wenn der Scheitel des Gefaͤßes k
offen waͤre.
Wir gehen nunmehr auf die in den dritten Abschnitt gehoͤrenden Erfindungen
uͤber; und zwar zuerst in so weit sie sich auf die Kessel jener Dampfwagen
beziehen, die auf den, gewoͤhnlichen Landstraßen zu laufen haben. Fig. 11 zeigt
dieselben in einer horizontalen Ansicht oder im Grundrisse; Fig. 12 ist ein
seitlicher Aufriß; Fig. 13 ein senkrecht genommener Laͤngendurchschnitt; Fig. 14 und
15 sind
horizontale Durchschnitte. Die verschiedenen Wasserkammern a,
a, a des Kessels umgeben die Feuerzuͤge des Ofens und die
Verkohlungskammer. b ist die Dampfkammer, an der die
Sicherheitsventile und der Dampfmanometer anzubringen sind; c der Ofen oder die Feuerstelle; d die
Roststangen, welche aus hohlen, mit Wasser gefuͤllten Roͤhren
bestehen, und die mit den queren Wasserkammern e und f in Verbindung gebracht sind. Die Deke des Heerdes ist
mit g bezeichnet;
h, h sind Feuerzuͤge, welche durch die
Hauptwasserkammer fuͤhren und in den Rauchfang i
ausmuͤnden. Die Speisung des Ofens mit Brennmaterial geschieht durch den
Trichter k, der mit doppelten Thuͤren
ausgestattet ist, und der sich in den Verkohkungsofen l
oͤffnet, in welchem die Steinkohle verkohkst und zum Theil entzuͤndet
wird. Die bei der Verkohkung erzeugte Flamme, der Rauch oder die Gase, welche sich
hiebei entwikeln, gelangen durch die Oeffnung m an das
in dem Ofen befindliche entzuͤndete Brennmaterial, so daß der Rauch auf
seinem Wege in den Rauchfang verzehrt oder verbrannt wird. Durch dieselbe Oeffnung
gelangt aber auch das verkohkste Brennmaterial zur Unterhaltung des Feuers auf dem
Heerde herab. Die Oeffnung n dient zur Speisung des
Kohksofens mit Luft, um dadurch eine theilweise Entzuͤndung zu erzeugen. o ist eine Art Rechen, der waͤhrend des
Schuͤrens das Brennmaterial in dem Ofen zuruͤkhaͤlt, und der,
so oft es erforderlich ist, mittelst einer Zahnstange und eines Getriebes
uͤber die Oeffnung m bewegt wird. Die
Thuͤrchen p, p dienen zur Reinigung der
roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge. q, q
sind Traͤger, welche an den oberen Theil des Kessels gebolzt sind, und an
denen dann die Cylinder der Maschine festgemacht werden. r,
r sind Dampfwege, die den Scheitel des Kohksofens mit der Dampfkammer in
Verbindung sezen.
Da dieselbe Art von Dampfkessel in den spaͤter zu beschreibenden Abbildungen
als mit den uͤbrigen Theilen der Dampfmaschine verbunden dargestellt ist, so
ist keine weitere Beschreibung noͤthig.
Was die Anordnung der verschiedenen Theile einer Locomotivmaschine betrifft, welche
auf gewoͤhnlichen Landstraßen zu laufen und Wagen zu treiben hat, so ist Fig. 10 ein
seitlicher Aufriß einer solchen Locomotivmaschine mit Hinwegnahme des
aͤußeren, die arbeitenden Theile umschließenden Gehaͤuses. Fig. 17 gibt
eine Ansicht derselben Maschine von Vorne; Fig. 18 ist ein Grundriß;
Fig. 19
ist ein senkrechter Laͤngendurchschnitt durch den Kessel, durch den Ofen,
durch den Wasserbehaͤlter, durch die fuͤr das Brennmaterial bestimmte
Kammer und durch andere Theile; Fig. 20 endlich gibt
einen horizontalen Durchschnitt.
Der Ofen oder die Feuerstelle A, A wird von dem zur
Verkohkung dienenden Ofen oder von der Kammer B aus mit
Brennmaterial gespeist. Der Kessel C, C, C umgibt in den
Theilen, aus denen er besteht, die Feuerstelle oder den Kohksofen. Durch den
groͤßeren Theil desselben oder durch die Hauptwasserkammer fuͤhren
mehrere roͤhrenfoͤrmige Feuerzuͤge D,
D, deren Enden nach Unten gegen die Feuerstelle A, nach Oben zu aber gegen den Rauchfang offen sind. F ist die Dampfkammer; G die
Roͤhre, durch die der Dampf eintritt. H, H sind die fest
auf den oberen Theil des Kessels gebolzten Cylinder. Die Enden der Kolbenstangen,
die mit kleinen Reibungsrollen, welche zwischen den parallelen Fuͤhrern l, l laufen, ausgestattet sind, stehen durch
Gelenkstuͤke mit den Kniehebeln K, K in
Verbindung. Leztere selbst sind an den Hauptwellen L, L
aufgezogen, die in Anwellen laufen, welche von den an den oberen Theil des Kessels
gebolzten Strebebalken M, M, M getragen werden. An den
aͤußeren Enden der Hauptwellen sind die Kniehebel N,
N aufgezogen, die mittelst der Verbindungsstangen O,
O die Bewegung an die Kniehebel P, P
fortpflanzen, welche an den Enden jener Welle, an der sich die Laufraͤder Q, Q befinden, fixirt sind. Diese Laufraͤder sind
an den Enden der in die Kurbelwelle eingepaßten Roͤhren oder hohlen Achsen
R, R befestigt; leztere sind durch die
Klauenbuͤchsen Z an die Kurbelwelle geschirrt,
und laufen zwischen Reibungsrollen, die an den Buͤchsen S, S, an denen die Federn T,
T festgemacht sind, aufgezogen wurden. Die Enden dieser Federn stehen durch
die Stangen U, U, welche mit Schrauben und
Schraubenmuttern an den an die Seitenwaͤnde des Kessels gebolzten
Vorspruͤngen X, X befestigt sind, mit der
Maschine in Verbindung. Die Enden der Buͤchsen S,
S laufen durch Fuͤhrer Y, Y, welche an
dem aͤußeren Theile des Kessels und der Dampfkammer angebracht sind. Fig. 21 zeigt,
auf welche Art der Wagen mittelst Federn an der umlaufenden oder arbeitenden Achse
aufgehaͤngt ist: die ganze Anordnung ist so offenbar, daß sie keiner weiteren
Beschreibung bedarf.
Die vorderen Raͤder V, V, mit denen der Wagen
gesteuert wird, laufen frei an kurzen horizontalen Achsen, die unter rechten Winkeln
aus den aufrechten Stangen W, W hervorstehen. Der
Wasservorrath befindet sich unter dem Size des Wagenlenkers in dem Behaͤlter
J, und aus diesem wird das Wasser mittelst der Pumpe
b in die Roͤhre a
gesogen und dann in den Kessel getrieben. Die Kolben dieser Pumpen werden durch die
mit dem Winkelhebel k in Verbindung gebrachten Stangen
c, c in Bewegung gesezt; dieß kann uͤbrigens
auch, bis der Kessel ein Mal gefuͤllt ist, vermittelst des Hebels j mit der Hand geschehen.
Die Steuerung des Wagens wird folgender Maßen bewerkstelligt. Die Achsen der vorderen
Raͤder V, V sind, wie gesagt, Arme, die aus den
aufrechten Stangen W, W herausragen. Diese Stangen,
welche sich oben in Zapfenlagern drehen, die an dem Size des Wagenlenkers angebracht
sind, sind an ihren oberen Enden an den Hebeln f, f, die
durch die Querstange g mit einander in Verbindung
stehen, befestigt. An dieser Querstange befinden sich die Griffe h, h, mit denen der Wagenlenker die Stange g nach der einen oder nach der anderen Stelle bewegen, und
mithin die vorderen Raͤder in die erforderliche Stellung bringen kann. Der
Wagen ruht mit den Armen i, i auf den vorderen Achsen,
und diese Arme fuͤhren die Feder k, deren Enden
durch Drehstuͤke mit den unteren Enden der Stangen W,
W in Verbindung stehen.
Der Zufluß des Dampfes an die Maschine kann zu jeder Zeit unterbrochen werden, und
zwar, indem man das Ende des Hebels l emporhebt. Dieses
steht naͤmlich mit der Stange m in Verbindung,
welche mit dem Krummhebel l articulirt, wie aus Fig. 16, 18 und 19 ersichtlich
ist; und dieser Krummhebel steht durch ein Gelenkstuͤk mit der Stange der an
dem Ende der Dampfzufuͤhrungsroͤhre c
angebrachten Scheibenventile o in Verbindung. Der um den
aͤußeren Umfang des Bremsrades q gelegte
Reibungsriemen p wird an diesen Umfang
angedruͤkt, indem der Wagenlenker mit dem Fuße den Hebel r herabdruͤkt. Dieser Hebel ist an der in den
Anwellen t, t laufenden Spindel s aufgezogen; und an dem Ende dieser Spindel sind auch noch andere Hebel
u, u angebracht. Mit den Enden dieser lezteren sind
die Stangen v, v verbunden, die auch noch mit den
Querhaͤuptern w, w in Verbindung stehen, welche,
wie Fig. 19
zeigt, mit dem an dem Ende des Reibungsriemens befestigten Hebel x articuliren. Hieraus ergibt sich, daß, wenn man den
Hebel r herabdruͤkt, das laͤngere Ende des
Hebels x nach Vorne gezogen wird, und daß mithin der
Reibungsriemen straffer um das Bremsrad gezogen wird, so daß die Bewegung der Achsen
oder der Raͤder nothwendig eine Beschraͤnkung erleiden muß.
Der Dampf stroͤmt auf seinem Wege vom Kessel in den Cylinder durch die an
beide Maschinen fuͤhrende horizontale Dampfroͤhre, in welcher zwei auf
folgende Weise in Thaͤtigkeit gerathende Drossele Ventile angebracht sind.
Man sieht den sowohl hiezu als zum Anhalten und Abaͤndern der Richtung des
Wagens dienenden Apparat in Fig. 22, 23, 24 und 25 abgebildet: und zwar
in Fig. 22 im
Grundrisse oder in einer horizontalen Ansicht; in Fig. 23 von der Seite; in
Fig. 24
in einem nach der Richtung von Fig. 23 genommenen
Durchschnitte. Fig.
25 ist ein Durchschnitt des in Fig. 24 abgebildeten
Rades nach der Richtung der Achse. An dem Umfange der Klauenbuͤchse ist eine
Verzahnung 2 angebracht, welche in ein an der Roͤhre 4 aufgezogenes Zahnrad 3
von gleichem Durchmesser eingreift. Diese Roͤhre paßt, wie durch Punkte
angedeutet ist, lose an die Welle 5, welche durch die von der oberen Seite der
Hauptachse und von dem Cylindergehaͤuse auslaufenden gegliederten Stangen 6,6
in ihrer gehoͤrigen Stellung erhalten wird. Das Rad 3 wird mittelst der in der
Schiebplatte 8 fixirten Klauenstifte 7,7 an die Welle 5 geschirrt. Diese Stifte oder
Zapfen 7,7 gehen durch Loͤcher, welche zu ihrer Aufnahme in der
staͤtigen, an der Welle 5 fixirten Platte 9 angebracht sind, und durch
Loͤcher, welche sich zu gleichem Zweke auch in dem Rade 3 befinden, so daß
sich demnach das Rad 3 und die Welle 5 gemeinschaftlich umdrehen. An dem Rade 3 sind
in Ausschnitten oder Buͤchsen die aufgerollten Federn 10,10 angebracht; und
zwar so, daß sie mit ihren inneren Enden an dem Rade festgemacht sind,
waͤhrend sie sich mit ihren aͤußeren Enden in eine in die Seite des
Rades geschnittene Fuge erstreken. An der kreisrunden Platte 14, welche an der
aͤußeren um die innere Roͤhre 4 des Rades 3 laufenden Roͤhre 15
aufgezogen ist, sind Daͤumlinge 13,13 befestigt, an denen die aͤußeren
Enden der aufgerollten Federn festgemacht sind. An dem Ende des Hebels 17 befindet
sich eine Reibungsrolle 16, die in dem zwischen den Raͤdern 3 und der Platte
14 gelassenen Raume auf der aͤußeren Oberflaͤche der Federn 10,10
laͤuft. 18 ist ein anderer, mit dem vorhergehenden unter rechten Winkeln
verbundener Hebel, der gleichfalls mit einer auf der Oberflaͤche der Federn
laufenden Reibungsrolle ausgestattet ist. Die beiden Hebel 17 und 18 drehen sich um
die Achse 20 als um ihren gemeinschaftlichen Stuͤzpunkt. Ihre den
erwaͤhnten entgegengesezten Enden stehen mit den Stangen 21,21 in Verbindung,
die durch kurze Hebel 22,22 mit den Achsen der Drosselventile ein Gefuͤge
bilden. So wie demnach die Federn und die Daͤumlinge umlaufen, werden sie zum
Behufe des Oeffnens der Drosselventile die Enden der Hebel 17,18 abwechselnd in
Bewegung sezen; waͤhrend diese Ventile beim Beginne eines jeden Hubes, den
die Kolben der Maschine machen, durch Federn wieder geschlossen werden. Man wird
bemerken, daß die Entfernung, in welcher die Daͤumlinge 13 und die
aufgewundenen Enden der Federn 10 von einander angebracht sind, die Zeit,
waͤhrend welcher die Drosselventile offen bleiben, und mithin auch die
Quantitaͤt des in die Cylinder eingelassenen Dampfes bestimmt. Die an der
Seite des Rades 3 angebrachten Daͤumlings 23,23 dienen zum Emporheben der
Hebel, bevor sie mit den Federn in Beruͤhrung kommen.
Die Schiebventile, welche die Eintritts- und Austrittscanaͤle des
Dampfes an den Cylindern veraͤndern, erhalten ihre Bewegung durch die
kleinen, an dem Ende der Welle 5 befindlichen
Winkelhebel oder Kurbeln 24,24, indem diese durch die Stangen 25,25 mit den Enden
der rechtwinkeligen Hebel 26,26, die sich um die Welle 27 drehen, in Verbindung
stehen. Die entgegengesezten Enden dieser Hebel dagegen sind an die Stangen 28 der
Schiebventile gefuͤgt, so daß also die Dampfwege bei dem Umlaufen der Welle 5 zu
gehoͤrigen Zeilen umgewechselt werden.
Damit die Kraft der Maschine dem Zustande und der Neigung der Straße angepaßt werde,
laͤßt sich der Dampfzufluß auf folgende Weise reguliren. Durch die
aͤußere Roͤhre 15, an der die kreisrunde Platte 14 fixirt ist, ist
eine schieflaufende Fuge oder Spalte geschnitten, und eben so ist in die innere
Roͤhre 4, die das Zahnrad 3 fuͤhrt, eine gerade Laͤngenspalte
geschnitten. In diesen Spalten bewegt sich ein in dem Halsringe 30 fixirter Zapfen,
indem dieser Halsring durch einen Drehring und durch den Arm 35 seitwaͤrts
verschoben wird. So wie sich nun dieser Halsring 30 nach Ruͤk- oder
Vorwaͤrts bewegt, so bewirkt er, daß die aͤußere Roͤhre 15 mit
ihrer kreisrunden Platte 14 an der das Zahnrad 3 fuͤhrenden inneren
Roͤhre 4 einen Theil eines Umganges vollbringt. Dadurch wird nothwendig die
relative Stellung der Platte 14 veraͤndert, und mithin die
Kreisoberflaͤche der Federn 10, auf der die Enden der Hebel 17,18 laufen,
vergroͤßert oder vermindert, damit dem Durchgange des Dampfes durch die
Drosselventile zum Behufe des Betriebes der Kolben in dem Cylinder mehr oder weniger
Zeit gestattet werde; denn die Drosselventile sind nur so lange offen, als die an
den Enden der Hebel 17,18 befindlichen Reibungsrollen mit den Oberflaͤchen
der Federn 10,10 in Verbindung stehen.
Die Verschiebung des Halsringes und des Zapfens 30 laͤngs der Roͤhren
15, in welche die Spalten geschnitten sind, wird auf folgende Weise bewerkstelligt.
31 ist ein aus Fig.
16, 18 und 19 ersichtlicher krummer Hebel, dessen laͤngerer Arm zu einem
Griffe geformt ist, waͤhrend der kuͤrzere an das Ende der Stange 32
gefuͤgt ist, die mit dem an dem Ende der senkrechten Stange 34 angebrachten
Hebel 30 in Verbindung steht. An dem unteren Ende der Stange 34 (Fig. 22) bemerkt man den
Hebel 35, dessen gabelfoͤrmiges Ende mit dem Halsringe 30 verbunden ist. Der
Wagenlenker kann also die Geschwindigkeit des Wagens reguliren, indem er durch die
Bewegung des Griffes 31 nach Auf- oder Abwaͤrts die Drosselventile in
seiner Gewalt hat.
Zum Behufe der Umwandlung der Bewegung des Wagens muͤssen die Klauenstifte 7,7
aus den in dem Rade 3 befindlichen Loͤchern herausgezogen, und diesem Rade
ein halber Umgang gestattet werden, den es auch vermoͤge seiner Verbindung
mit dem Rade 2 vollbringt. Um dieselbe Zeit wird die Welle 5 mit den Schiebventilen
und deren Winkelhebeln und Stangen stationaͤr bleiben, wo dann die Stifte
oder Zapfen 7,7 alsogleich in jene Loͤcher eingestekt werden muͤssen,
die denen, worin sich die Stifte fruͤher befanden, gegenuͤber stehen. Da hierauf die
Huͤlfswelle wieder in Bewegung und die Schiebventile wieder in
Thaͤtigkeit gelangen, so wird der Dampf an dem entgegengesezten Ende des
Cylinders eintreten, woraus denn folgen wird, daß sich der Wagen und die Maschine
nach entgegengesezter Richtung bewegt. Damit diese Umkehrung der Bewegung von dem
Wagenlenker beliebig vollbracht werden kann, ist an dem gebogenen Hebel 36, den man
in Fig. 16,
18 und
19 sieht,
ein Griff angebracht, und dieser Hebel an das Ende der Stange 37 gefuͤgt, die
mit einem an dem Ende der aufrecht stehenden Stange 39 befindlichen Hebel 38 in
Verbindung steht. An dem unteren Ende dieser Stange 39 bemerkt man in Fig. 22 den
Klauenhebel 40, dessen gabelfoͤrmiges Ende in die Fuge des
Verkuppelungsstuͤkes 8 eingreift, so daß die Zapfen 7,7 also auf diese Weise
aus den einen loͤchern ausgezogen, und dafuͤr wieder in andere
eingesenkt werden koͤnnen, um dadurch eine Umwandlung der Bewegung des Wagens
zu bewirken.
Jene Verbesserungen, die sich auf verschiedene Theile der fuͤr Eisenbahnen
bestimmten Locomotivmaschinen beziehen, erhellen aus Fig. 26, wo man eine
vollkommene derlei Maschine in einem seitlichen Aufrisse dargestellt sieht; aus Fig. 27, wo
sie in einem senkrechten Laͤngendurchschnitte abgebildet ist, und endlich aus
dem Grundrisse Fig.
28. Man sieht, daß diese Maschine in Hinsicht auf die Anordnung ihrer
wesentlichen Theile mit der kurz vorher beschriebenen die groͤßte
Aehnlichkeit hat, weßhalb denn auch die Beschreibung kuͤrzer seyn kann, und
weßhalb gleiche Theile auch mit denselben Buchstaben bezeichnet sind. A ist die Feuerstelle oder der Ofen; B das Aschenloch; C, C, C
das Gehaͤuse, welches die Feuerstelle, die roͤhrenfoͤrmigen
Feuerzuͤge und den zur Verkohkung dienenden Ofen umgibt; D der Wasserbehaͤlter, in welchem die Drukpumpen
angebracht sind; E der zur Verkohkung dienende Ofen oder
die Kammer fuͤr das Brennmaterial; F die in den
Rauchfang H fuͤhrenden
roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge; G die
Dampfkammer; I, I die Cylinder der Maschine; K, K die durch Gelenkstuͤke mit den Kolbenstangen
in Verbindung stehenden Krummhebel; L die
Verbindungsstangen, die von diesen Krummhebeln aus die Bewegung an die
Laufraͤder fortpflanzen; a der Trichter, welcher
zur Speisung des Ofens mit Brennmaterial dient; b das
Thuͤrchen, durch welches die Luft in den zur Verkohkung dienenden Ofen
gelangt; c ein zum Anschuͤren des Feuers
dienendes Thuͤrchen; d die Deke oder
Bruͤke des Ofens; e, e die zur Reinigung der
roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge dienenden Thuͤrchen; f das innere Sicherheitsventil; g der in den Rauchfang fuͤhrende Entweichungscanal; h das aͤußere Sicherheitsventil; i der Dampfmanometer; k die
Dampfeinfuͤhrungsroͤhre, welche an die Schiebventilbuͤchse und
die Cylinder fuͤhrt; l die Dampfausfuͤhrungsroͤhre, welche entweder direct in den Rauchfang
oder auch in einen der spaͤter zu beschreibenden Luftverdichter
fuͤhren kann; m die Kolbenstangen; n die fuͤr diese bestimmte Parallelbewegung; o die Stangen und Hebel, welche zur Bewegung der
Schiebventile mittelst der an der Kurbelwelle q
befindlichen Daͤumlinge p dienen; r die Handsteuerung, womit die Schiebventile von der
Maschine unabhaͤngig in Bewegung gesezt werden koͤnnen; s Hebel oder Stangen, die mit einem Tretschaͤmel
in Verbindung stehen, und wodurch die Bewegung der Maschine umgeaͤndert oder
angehalten werden kann, je nachdem die Daͤumlinge in die Ausschnitte der
gebogenen Stange o, o oder aus denselben herausgebracht
werden; t, t Dampfroͤhren die den uͤber
dem Verkohkungsofen befindlichen Theil des Kessels mit der Dampfkammer in Verbindung
sezen; u die Federn, in denen der Wagen haͤngt;
v, v die Klammern und Stege, welche die Kurbelwelle
tragen; w die Stoͤßer, die auf metallenen Federn
x und Luftcylindern oder Kolben y ruhen; z der Raum
fuͤr den Maschinisten, der uͤber die Oefen zu wachen hat.
Eine Modification des Gestelles und der Kessel der Locomotivmaschinen, welche mit zu
dem vierten Abschnitte der Erfindungen gehoͤrt, erhellt aus Fig. 29 bis 35. Der Wagen
oder das Gestell, oder das den Kessel, den Ofen, die Cylinder und andere Theile der
Locomotivmaschine umschließende Gehaͤuse besteht aus Eisenblechen, die
dadurch zusammengefuͤgt werden, daß man ihre Enden schwalbenschwanzartig in
ausgefalzte Eisenstaͤbe, welche das Geripp des Wagens bilden,
einfuͤgt. Fig. 29 gibt einen Querdurchschnitt eines solchen Stabes A, in welchen ein, zwei, drei oder mehrere
Laͤngenfalzen a, b, c geschnitten seyn
koͤnnen. Der in einen dieser Falzen einzusezende Rand der Eisenplatten ist,
wie man bei d sieht, aufgeschlagen oder verdikt, damit
er eine Art von Schwalbenschwanz bildet, womit er in einen der Falzen eingesezt
wird. Nach diesem Einsezen schlaͤgt man die Raͤnder des Falzens ein,
wie man bei b, f sieht, und auf diese Weise wird die
Platte fest in dem Stabe erhalten. Man kann nach diesem Verfahren zwei, drei oder
mehrere Platten an einem Stabe befestigen, und solcher Maßen einen Wagen, ein
Gestell oder ein Gehaͤuse zusammensezen, welches den Kessel, den Ofen, die
Cylinder und andere Theile der Maschine auf die weiter unten anzudeutende Weise
traͤgt, und welches man leicht und dabei doch sehr stark finden wird.
Um fuͤr Locomotivmaschinen einen Kessel herzustellen, der bei großer
Staͤrke und einer sehr ausgedehnten Heizoberflaͤche dennoch
verhaͤltnismaͤßig leicht ist, verfertigt der Patenttraͤger die
Wasserkammern ganz oder zum Theil aus duͤnnen, parallelen Metallblechen, welche er
beilaͤufig einen Zoll weit von einander anbringt. Diese Bleche
muͤssen, damit sie gehoͤrige Staͤrke bekommen, in Falten
gebogen und dadurch an einander befestigt seyn, daß man die Scheitel dieser Falten
miteinander in Beruͤhrung bringt, und daß man dann durch diese Scheitel
Nieten treibt. Fig.
30 und 31 zeigen kleine Theile eines derlei Kessels in groͤßerem
Maaßstabe. Man schlaͤgt zum Behufe ihrer Verfertigung die Platten A, A zuerst so aus, daß sie, wie man in Fig. 30 sieht, an der
einen Seite Vertiefungen a, a, a, an der
entgegengesezten Seite hingegen Erhoͤhungen bekommen, denen der
Patenttraͤger vorzugsweise die Gestalt von abgestuzten Kegeln von
beilaͤufig 1 5/8 Zoll an der Basis gibt. Wenn man dann zwei auf diese Art
ausgeschlagene Bleche nach der aus Fig. 31 ersichtlichen
Methode aneinander gebracht hat, so verbindet man sie, indem man durch die Enden der
anliegenden Kegel die Nieten b, b treibt. Ein Gestell
und ein Gehaͤuse oder einen Mantel fuͤr eine Locomotivmaschine,
welches auf die beschriebene Weise durch Einfalzung von Blechen in
Metallstaͤbe zusammengesezt worden ist, ersieht man aus Fig. 32, wo ein
Laͤngendurchschnitt, und aus Fig. 33, wo ein
Querdurchschnitt durch den Ofen, den Kessel etc. gegeben ist. Hier ist der Kessel
zum Theil auf die eben beschriebene Art gebaut, zum Theil aus senkrechten Wasser
haltenden Roͤhren zusammengesezt. Diese Roͤhren koͤnnen, wenn
man will, etwas gebogen seyn, damit der Ausdehnung und Zusammenziehung des Metalles
Spielraum gestattet ist. Jene Theile des Kessels, die beschriebener Maßen aus
gefalteten Blechen zusammengesezt sind, und die den Ofen b,
b und das Aschenloch c, c umgeben, sind mit a, a, a bezeichnet. d, d, d
hingegen sind die senkrechten Roͤhren, welche zum Behufe des freien
Durchzuges des Wassers oben und unten offen sind. Die aus dem Ofen emporsteigenden
Flammen und heißen Duͤnste spielen zwischen diesen Roͤhren; der Rauch
entweicht endlich bei den Oeffnungen e in den Rauchfang
f. Das Gefaͤß g
bildet den Kopf des Kessels; h ist die Dampfkammer, von
der der Dampf durch die Roͤhre i, i, i und durch
die Drosselventile j, j in die arbeitenden Cylinder k, k stroͤmt. Der Dampf entweicht durch die
Roͤhre l, l und gelangt durch den Verdichter in
den Wasserbehaͤlter m; was in lezterem allenfalls
noch von unverdichtetem Dampfe emporsteigt, entweicht durch die Roͤhre n in den Rauchfang f. Die
Achse der Hinteren Raͤder laͤuft, so wie dieß an den vorhergehenden
Maschinen beschrieben worden ist, zwischen Reibungsrollen, und auch die
uͤbrigen Theile sind auf die fruͤher angegebene Weise
eingerichtet.
Eine weitere Modification des Kessels erhellt aus Fig. 34 und 35. Dieser
gemaͤß kann man zur Ausdehnung der Heizoberflaͤche eine beliebige Anzahl
senkrechter Scheidewaͤnde anbringen, innerhalb denen sich Wasserkammern, die
wie eben beschrieben, aus zusammengenieteten, gefalteten, parallelen Platten
bestehen, befinden. Fig. 34 ist ein Laͤngendurchschnitt, woraus man die gebogene
Gestalt der Scheidewaͤnde a, a, a sieht; Fig. 35 ist
ein Querdurchschnitt. An dieser Modification findet der Patenttraͤger keine
senkrechten Wasserroͤhren noͤthig. Der Dampf gelangt in die oberhalb
angebrachte Dampfkammer b, b, und aus dieser in die
arbeitenden Cylinder.
Die den fuͤnften Theil der Erfindungen bildende Methode, den aus
Hochdrukmaschinen austretenden Dampf vermittelst der atmosphaͤrischen Luft zu
verdichten, ersieht man aus dem Laͤngendurchschnitte Fig. 36. Der hiezu
dienende Apparat kann in irgend einer geeigneten Stellung zwischen dem
Austrittscanale und der endlichen Entweichungsstelle des Dampfes in den Rauchfang
angebracht werden. Der austretende Dampf gelangt von der Maschine aus durch die
Roͤhre a in die erste Kuͤhlkammer A, in der er sich ausdehnen kann. Durch diese Kammer
laͤuft horizontal eine Anzahl kleiner Roͤhren b, b, deren Enden dem Zutritte der atmosphaͤrischen Luft offen
stehen, damit sie vermoͤge des Durchzuges lezterer bestaͤndig
abgekuͤhlt werden. Von dieser Kammer A aus steigt
der Dampf durch die Roͤhre d in die zweite
Kuͤhlkammer B, die gleichfalls mit offenen
Luftroͤhren c, c, c ausgefuͤllt ist,
empor, um, nachdem er durch die Oeffnungen e, e, e
getreten, zwischen den kalten Luftroͤhren zu circuliren. Das Wasser, welches
hiebei durch die Verdichtung des Dampfes zum Vorscheine kommt, laͤuft von der
Kammer B aus durch die kleine Roͤhre f laͤngs des Bodens der Kammer A, um endlich bei der kleinen Roͤhre g an die zur Speisung des Kessels dienende Pumpe
abzufließen. Die geringe Quantitaͤt Dampf, welche unverdichtet bleibt,
entweicht durch die Roͤhre h, die entweder dem
Zutritte der atmosphaͤrischen Luft offen steht, oder in den Rauchfang
fuͤhrt.
Wuͤnschte man die Luft, welche auf ihrem Durchgang durch den
Kuͤhlapparat erwaͤrmt worden ist, in den Ofen des Kessels zu leiten,
so koͤnnte sie mittelst eines umlaufenden Windfanges oder mit Huͤlfe
irgend einer anderen Vorrichtung durch die Kuͤhlroͤhren b, b und c, c an den Ort
ihrer Bestimmung getrieben werden. Fig. 37 ist ein
senkrechter Durchschnitt eines dem gemaͤß eingerichteten
Kuͤhlapparates, welcher unter dem dem Heizer der Locomotivmaschine
angewiesenen Plaze angebracht ist. a ist die
Roͤhre, welche den austretenden Dampf in die Kuͤhlkammer A leitet, aus der der unverdichtete Ruͤkstand
durch die Roͤhre b entweicht. Der von der
Maschine oder von den Laufraͤdern aus durch Treibriemen oder auf irgend eine
andere Art und Weise in Bewegung gesezte Windfang c
treibt die Luft durch
die Roͤhren d, d, d und durch den Canal e in den Ofen der Maschine.
Die Verbindung der Locomotivmaschine mit Wagen, die auf gewoͤhnlichen
Landstraßen zu laufen haben, die den sechsten Abschnitt der Erfindungen ausmacht,
ergibt sich aus Fig. 38. A ist naͤmlich ein Grundriß
des Wagens, d.h. der Raͤder, der Achsen, der Langwied etc. einer
Locomotivmaschine, und B ein Grundriß dieser Theile an
einem gewoͤhnlichen Wagen, der durch die Locomotivmaschine gezogen werden
soll, a ist die Langwied des ersteren, b jene des lezteren; c, c, c
eine Stange, die an die beiden Langwieden gefuͤgt ist, und durch welche die
Triebkraft der Locomotive A an den vor ihr befindlichen
Wagen B fortgepflanzt wird. Die beiden Wagen stehen aber
uͤberdieß auch noch durch ein Gefuͤge d in
Verbindung, welches gebildet wird, indem sich ein an dem Ende der Deichsel e angebrachter Zapfen der Locomotive in einer
laͤnglichen Oeffnung bewegt, die in den Schwanz f
der Langwied des vorderen Wagens geschnitten ist, damit auf diese Weise die vorderen
Raͤder der Locomotive dirigirt werden. Hieraus geht hervor, daß, wie viele
Wagen auch an die Locomotive angehaͤngt seyn moͤgen, deren Lauf doch
von der Leitung oder Steuerung der vorderen Raͤder des ersten Fuhrwerkes, die
sich wie an einem gewoͤhnlichen Wagen lenken lassen, abhaͤngt.
Der siebente Theil der Erfindung beruht auf der Anwendung eines eigenen
Randvorsprunges an der aͤußeren Seite des Radkranzes der Laufraͤder
der fuͤr Eisenbahnen bestimmten Locomotiven, um das Ablaufen der
Raͤder von den Schienen zu verhuͤten, im Falle diese einem solchen
Hindernisse begegnen, daß ein Rad so hoch gehoben wird, daß dessen innerer
Randvorsprung uͤber die Schiene gleiten koͤnnte. Wenn die
Raͤder naͤmlich nur an der inneren Seite einen Randvorsprung haben, so
wird, wenn eines derselben auf ein Hinderniß der angegebenen Art stoͤßt, das
dazu gehoͤrige Rad im Bogen laufen und mithin von der Bahn abgehen. Wenn z.B.
eines der Laufraͤder einer Locomotive auf einen Stein, einen Pruͤgel
oder irgend ein dergleichen Hinderniß, welches sich zufaͤllig auf der Bahn
trifft, stoͤßt, so wird dessen Bewegung ploͤzlich unterbrochen und
sein Randvorsprung uͤber die Schiene emporgehoben werden, waͤhrend das
andere Rad, da ihm kein solches Hinderniß im Wege liegt, seine Bewegung fortzusezen
strebt. Ersteres wird daher zum Mittelpunkte der Bewegung, und die Folge davon ist,
daß das ungehinderte Rad im Bogen laufen und die Maschine aus der gehoͤrigen
Richtung kommen wird. Diesem Unfaͤlle laͤßt sich jedoch steuern, wenn
man zu beiden Seiten des Radkranzes einen Randvorsprung anbringt, wie dieß aus Fig. 28 zu
ersehen, wo der aͤußere Randvorsprung mit a, a,
der gewoͤhnliche
innere Randvorsprung dagegen mit b, b bezeichnet ist.
Damit diese verbesserten Raͤder aber von einer Schienenlinie auf eine andere
uͤbergehen koͤnnen, wie z.B. da, wo die Wagen von einer Hauptbahn aus
auf eine Nebenbahn laufen sollen, muͤssen anstatt der keilfoͤrmigen
oder anders geformten Stuͤke, die sonst gewoͤhnlich hiezu dienen,
eigene Fuͤhrer angewendet werden. Der Grundriß Fig. 39 und der senkrecht
durch die Schienen und durch einen Theil des Bodens gefuͤhrte Durchschnitt
Fig. 40
wird zeigen, wie dieser Zwek erreicht werden soll. a, a
ist naͤmlich die Haupt- und b, b die
Nebenbahn; der Uebergang von der einen auf die andere soll durch die Fuͤhrer
c, c bewerkstelligt werden, die aus einem Theile der
Schienen bestehen, und die sich an dem einen ihrer Enden um Zapfen drehen. Wenn z.B.
eine Locomotive in der Richtung des Pfeiles auf der Nebenbahn laufen soll, so
muͤssen die Fuͤhrer c, c in die aus Fig. 39
ersichtliche Stellung gebracht werden: d.h. sie muͤssen von der Hauptbahn in
die Nebenbahn fuͤhren; wenn hingegen die Maschine auf der Hauptbahn
fortlaͤuft, so muͤssen sich die Fuͤhrer c, c in einer und derselben Linie mit dieser befinden. Die Fuͤhrer
c, c muͤssen durch einen Querbalken d, d, der an der unteren Seite der Schienen
wegfuͤhrt, und der mit einem Griffe versehen ist, miteinander verbunden seyn.
Mit Huͤlfe dieses Griffes koͤnnen die Fuͤhrer gleichzeitig von
einer Bahnlinie an die andere bewegt werden. Damit die Fuͤhrer jeder Zeit mit
der einen oder mit der anderen Bahnlinie gehoͤrig in Verbindung kommen, sind
an den Seiten der Schienen gehoͤrige Aufhaltstuͤke e, e, e angebracht. Der Hebel f bewegt sich zu diesem Behufe um einen Stuͤzpunkt, welcher sich an
dem Balken g befindet, der an dem oberen Ende an dem
Querbalken d, an dem unteren dagegen an dem
Stuͤke h festgemacht ist. Lezteres ist an das
Ende des Hebels i gefuͤgt, der sich um einen an
der Stange j befindlichen Stuͤzpunkt bewegt; an
dem anderen Ende dieser lezteren Stange befindet sich das Gewicht k. Es erhellt demnach, daß die von dem beschwerten Hebel
i auf das Stuͤk h
ausgeuͤbte Gewalt des wirkt, daß der Balken d
durch den Hebel f entweder nach der einen oder nach der
anderen Richtung getrieben wird, so daß die Fuͤhrer c,
c auf die Aufhaͤlter e, e gelangen, und
daher jeder Zeit mit der einen oder mit der anderen Bahnlinie coincidiren oder
zusammenfallen.
Die verbesserte Methode die Stangen der Kolben und Pumpen schluͤpfrig zu
erhalten, welche den achten Abschnitt ausmacht, ist aus Fig. 41, wo eine an einer
senkrechten Kolbenstange angebrachte Stopfbuͤchse in senkrechtem
Durchschnitte dargestellt ist, zu ersehen. Die Erfindung beruht darauf, daß in der
gewoͤhnlichen haͤnfenen Liederung eine ringfoͤrmige Kammer
angebracht wird, in die das Oehl, der Talg oder das sonstige zum Schmieren dienende Material
aus einem kleinen, zur Seite der Stopfbuͤchse angebrachten Behaͤlter
gelangt, und welche man in Fig. 42 einzeln
fuͤr sich von der Seite und im Durchschnitte abgebildet sieht. a, a ist die Kammer, welche im Durchschnitte eine
dreiekige Gestalt zeigt, und deren obere und untere Seiten schief geneigt sind,
damit sich die Liederung dicht an die Kolbenstange anlege, wenn die Schraube b zu diesem Zweke angezogen wird, c ist ein kleiner, in die Stopfbuͤchse geschraubter
Behaͤlter fuͤr das zum Schmieren dienende Material, welches aus diesem
Behaͤlter durch den Hahn und durch die Roͤhre e in einen ringfoͤrmigen Ausschnitt f
gelangt, um dann von hier aus durch Loͤcher in das Innere des Ringes zu
gerathen und dadurch mit der Kolbenstange oder mit der sonstigen schluͤpfrig
zu erhaltenden Oberflaͤche in Beruͤhrung zu kommen.
Die in den neunten Abschnitt gehoͤrige Erfindung, naͤmlich die
Sicherheitsplatte und der Feuerausloͤscher, ist aus Fig. 43 und 44 zu ersehen.
Die Roͤhre a fuͤhrt vom Kessel oder von
der Dampfkammer in die Roͤhre oder in die Kammer b, deren unterer offener Theil c unmittelbar
uͤber dem Ofen oder uͤber der Feuerstelle oder in einer anderen
geeigneten Stellung fixirt ist. Zwischen den beiden Kammern b und c besteht eine duͤnne, metallene
Scheidewand, welche bei jedem Druke, der etwas groͤßer als der ist, bei
welchem der Kessel zu arbeiten hat, zerspringen soll. Die Staͤrke dieser
Platte hat sich demnach nach dem Grade des Drukes, auf den man den Dampf bringen
will, zu richten. Die Stange e steht an dem einen Ende
mit den Querstuͤken f, f, an dem anderen hingegen
mit dem kegelfoͤrmigen Stuͤke g, welches
durch die Metallplatte d emporgehalten wird, in
Verbindung. Wenn daher der Druk des Dampfes im Kessel so weit steigt, daß die Platte
d unter ihm nachgibt und zerspringt, so wird das aus
dem Kessel herbeistroͤmende Wasser den Kegel und die Stange e hinab druͤken, bis die Querstuͤke f durch den an der unteren Kammer c befindlichen Randvorsprung h, h aufgehalten
werden, wo dann der Kegel g der Muͤndung der
unteren Kammer c gegenuͤber aufgehaͤngt
seyn, und das Wasser in Form eines Regens auf das im Ofen brennende Feuer aussprizen
wird.
Der zehnte Theil der Erfindungen des Patenttraͤgers endlich, der in Fig. 45
dargestellt ist, besteht in einer an einer gewoͤhnlichen Eisenbahn
anzubringenden Vorrichtung, womit bedeutende schiefe Flaͤchen oder Rampen mit
Locomotiven hinan gefahren werden koͤnnen, ohne daß der Beistand einer
außerordentlichen oder Huͤlfskraft noͤthig waͤre. In Fig. 45, wo
man eine Locomotive mit einem angehaͤngten Wagenzuge uͤber eine
schiefe Flaͤche hinansteigen sieht, sind A, A
die beiden
gewoͤhnlichen Schienenbahnlinien; B, B die
Laufraͤder der Maschine; C, C erhoͤhte, an
den Seiten der Bahn aufgefuͤhrte Wege oder Bahnen, die eine weit
groͤßere Breite haben als die gewoͤhnlichen Schienen, und die aus
Stein oder einem anderen entsprechenden Materiale gebaut seyn koͤnnen, D, D sind breite, an den aͤußeren Seiten der
Laufraͤder oder mit diesen an einer und derselben Welle fixirte Reifen oder
Raͤder. Diese kleineren Raͤder haben auf der Oberflaͤche der
erhoͤhten seitlichen Bahnen zu laufen, und werden durch ihren kleineren
Durchmesser bewirken, daß die Maschine die schiefen Flaͤchen leichter und
ohne daß die Geschwindigkeit eine Veraͤnderung zu erleiden brauchte,
hinansteigen. Man koͤnnte die kleineren Raͤder auch mit Zahnen
ausstatten, welche in eine auf den erhoͤhten Seitenbahnen fixirte Zahnstange
einzugreifen haͤtten, wobei jedoch der Umfang der kleineren Raͤder
immer noch auf der Oberflaͤche der Nebenbahn laufen muͤßte. Die
unteren Enden dieser Nebenbahnen muͤßten mit schraͤgen Flaͤchen
E, E ausgestattet seyn, damit die kleineren
Raͤder, wenn sie auf die Nebenbahn gelangen, die groͤßeren
Raͤder von den Schienen emporheben, ohne daß eine ploͤzliche
Erschuͤtterung dabei Statt findet. Eine aͤhnliche Einrichtung
muͤßte auch an dem entgegengesezten Ende der Nebenbahn getroffen seyn, damit
die groͤßeren Laufraͤder eben so sachte auch wieder auf die eisernen
Schienen herabgelangen.
Tafeln