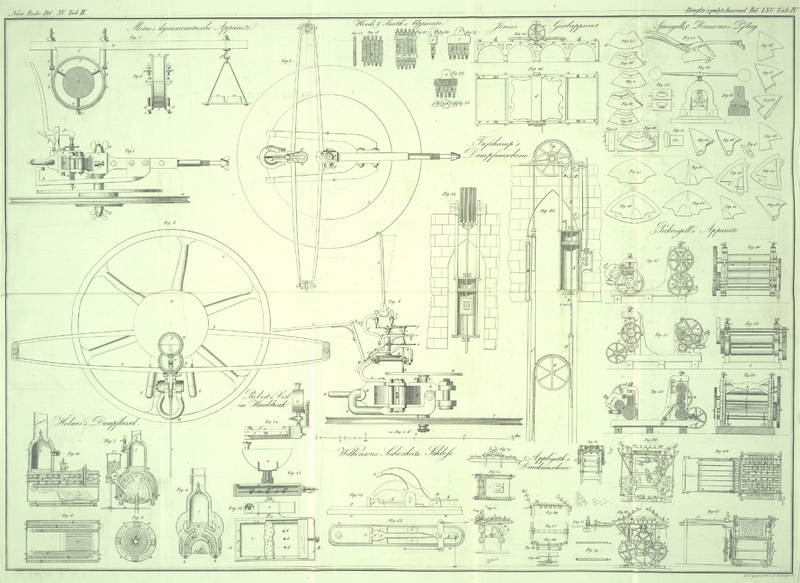| Titel: | Verbesserungen an den Dampfkesseln, und zwar namentlich der für Dampfwagen und Dampfboote bestimmten, worauf sich John Holmes, Ingenieur von Birmingham in der Grafschaft Warwick, am 7. April 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. LIX., S. 259 |
| Download: | XML |
LIX.
Verbesserungen an den Dampfkesseln, und zwar
namentlich der fuͤr Dampfwagen und Dampfboote bestimmten, worauf sich John Holmes, Ingenieur von
Birmingham in der Grafschaft Warwick,
am 7. April 1836 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. Januar 1837. S.
193.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Holmes's verbesserte Dampfkessel fuͤr Dampfwagen und
Dampfboote.
Der Patenttraͤger beabsichtigt durch seine Erfindung eine sehr große
Oberflaͤche des Kessels oder Dampferzeugers der Einwirkung des Feuers
auszusezen. Der neue Kessel, welcher aus Eisenblech gearbeitet wird, besizt keine
kleinen, roͤhrenfoͤrmigen Feuerzuͤge, welche sich stets leicht
mit Ruß und Asche verlegen, und die sehr schwer zu reinigen sind; sondern er besteht
aus halbkugel- oder kuppelfoͤrmigen Faͤchern, welche auf solche
Weise innerhalb einander angebracht sind, daß ihre Platten oder Scheidewaͤnde abwechselnd
Wasserbehaͤlter und Feuerzuͤge bilden. Der durch die Verbrennung des
Brennmateriales entstehende Dunst und Rauch steigt zwischen den
Wasserbehaͤltern empor, und stroͤmt um dieselben herum, indem die
Feuerzuͤge durch Oeffnungen, welche den Zug nicht beeintraͤchtigen,
mit einander communiciren.
Fig. 7 ist ein
Querdurchschnitt durch einen der verbesserten Dampfkessel; Fig. 8 hingegen ist ein
horizontaler Durchschnitt. Das Brennmaterial wird hier durch einen Trichter
eingetragen, und gelangt auf einen sich umdrehenden Rost; diese beiden Theile
gehoͤren jedoch nur dann mit zu der Erfindung des Patenttraͤgers, wenn
sie in Verbindung mit dem Kessel angebracht werden. Der Mantel oder das
aͤußere Gehaͤuse des Kessels a, a, a
bildet den aͤußeren, in den Schornstein fuͤhrenden Feuerzug. Der Ofen
b ist mit einem Roste c
versehen, welcher sich um eine senkrechte Welle dreht; leztere ist hohl, damit Luft
durch sie stroͤmen kann, und damit sie gleichsam wie ein Geblaͤse zur
Bethaͤtigung des Feuers wirken kann. Die von dem Ofen auslaufenden
Feuerzuͤge e, e, e steigen zwischen den
Wasserbehaͤltern auf und nieder und um sie herum, bis sie den Rauch und den
Dunst endlich in den Schornstein f leiten, der zum
Behufe der Regulirung der Hize mit einem sogenannten Daͤmpfer oder Register
versehen ist.
Das Brennmaterial gelangt in Folge der Umdrehungen einer gezahnten Walze h allmaͤhlich und in kleinen Stuͤken auf
die schiefe Flaͤche i, uͤber die es dann
auf den im Ofen befindlichen Rost Hinabrollt. Der Rost c
wird umgetrieben, indem eine an der horizontalen Welle k
befindliche endlose Schraube in ein Wurmrad eingreift, welches an der senkrechten
Welle des Rostes angebracht ist. Auf aͤhnliche Weise erhaͤlt auch die
gezaͤhnte Walze h ihre rotirende Bewegung; indem
deren horizontale Welle mit dem rotirenden Theile der Maschine in Verbindung
gebracht ist.
Der in den Wasserbehaͤltern erzeugte Dampf geht in die Dampfkammer l uͤber, und gelangt von hier aus durch die
Roͤhre m in den Cylinder der Maschine. Bei n ist ein Sicherheitsventil angebracht.
Ein Kessel dieser Art kann zum Behufs der Reinigung leicht in Stuͤke zerlegt
werden; man nimmt naͤmlich zuerst den Mantel ab, und trennt dann die inneren
Theile, indem man sie an den den Feuerzuͤgen zunaͤchst liegenden
Gefuͤgen losschraubt. Die uͤbrigen Theile der Wasserbehaͤlter
bleiben zusammengenietet.
Die Kessel lassen sich unter Beibehaltung eines im Uebrigen aͤhnlichen Baues
auch mit einem fixirten Roste ausstatten. Die Wasserbehaͤlter und
Feuerzuͤge koͤnnen unter Beibehaltung desselben Principes auch die Form von
Kutschenwoͤlbungen haben, wie man dieß aus dem senkrechten Durchschnitte,
Fig. 9,
aus dem Laͤngendurchschnitte, Fig. 10, und aus dem
horizontalen Durchschnitte oder Grundrisse, Fig. 11, ersieht.
An diesen lezteren Figuren ist a der Ofen; b, b, b sind die Wasserkammern; c, c, c die Feuerzuͤge, welche von dem Ofen in den Schornstein
fuͤhren, und die auf ihrem Laufe der Laͤnge nach zwischen mehreren
Wasserkammern durchgehen, anstatt wie bei Fig. 7 zwischen ihnen auf
und nieder zu steigen. Die Speisung des Ofens geschieht hier auf gewoͤhnliche
Weise durch ein vorne angebrachtes Ofenthuͤrchen. Die Speisung des Kessels
geschieht durch eine Roͤhre d, welche an dem
unteren Ende verschlossen ist, und in deren Seitenwaͤnden Loͤcher
angebracht sind, damit das Wasser ausfließen kann. Der Dampf gelangt aus der
Dampfkammer e durch die Roͤhre f in die Maschine. Fuͤr ein Sicherheitsventil ist
bei g gesorgt.
Unter dem Kessel laufen der Laͤnge nach zwei Roͤhren, von denen aus
kleine Verbindungsroͤhren an die Wasserkammern fuͤhren, damit der
Kessel ausgeleert werden kann, wenn es noͤthig ist; und damit sich auch der
allenfalls auf dem Boden sich ansammelnde Saz ausblasen laͤßt. Auch diese Art
von Kessel kann uͤbrigens leicht in Stuͤke zerlegt werden.
Tafeln