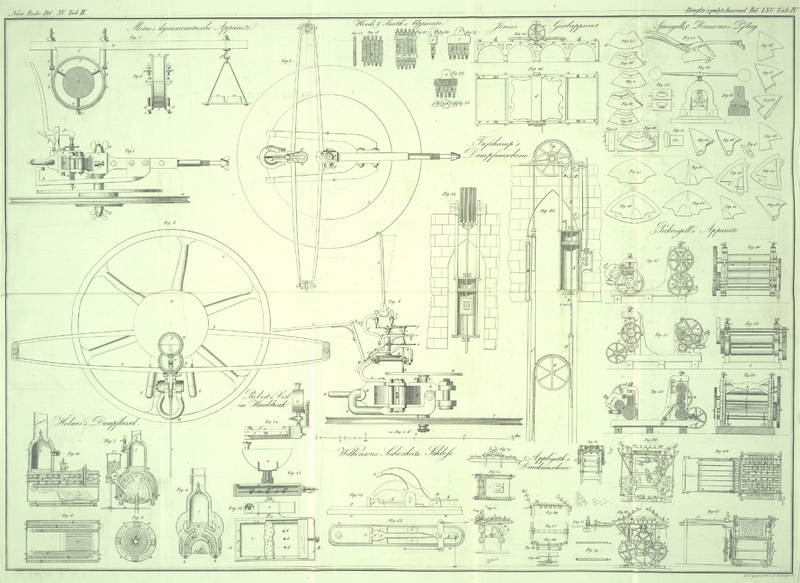| Titel: | Ueber zwei dynamometrische Apparate zum Messen der Kraft, welche von Triebkräften, denen Leben inwohnt, ausgeübt wird, und zum Messen der von ihnen vollbrachten Arbeit. Von Hrn. A. Morin, Capitän bei der königl. franz. Artillerie, und Professor der Mechanik bei der Genieschule in Metz. |
| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. LX., S. 260 |
| Download: | XML |
LX.
Ueber zwei dynamometrische Apparate zum Messen
der Kraft, welche von Triebkraͤften, denen Leben inwohnt, ausgeuͤbt wird,
und zum Messen der von ihnen vollbrachten Arbeit. Von Hrn. A. Morin, Capitaͤn bei der
koͤnigl. franz. Artillerie, und Professor der Mechanik bei der Genieschule in
Metz.Hr. Morin erhielt fuͤr diese Abhandlung, in der
die von der Société d'encouragement in
Hinsicht der Dynamometer ausgeschriebene Preisaufgabe zum Theil geloͤst
ist, die große goldene Medaille.A. d. R.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement. Mai 1837, S. 161.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Morin, uͤber Dynamometer.
§. 1. Bevor ich andeuten will, welche verschiedene Loͤsungen mir die
von der Gesellschaft ausgeschriebene Preisfrage zuzulassen scheint, glaube ich
einige Bemerkungen uͤber die Art ihrer Stellung vorausschiken zu
muͤssen.
Die Gesellschaft verlangt, daß das vorgelegte Instrument die
Dauer einer jeden in der Kraft Statt findenden Oscillirung
angebe, um daraus die Summe der innerhalb einer bestimmten
Zeit aufgewendeten Kraft zu erfahren; sie glaubt, daß es zu diesem Zweke
von Nuzen seyn koͤnnte, wenn sich die Zeit von
Secunden-Bruchtheilen an bis zur Stunde in beliebig wechselbare
Bruchtheile abtheilen ließe.
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet muͤßte also das Instrument bei jedem
Elemente dt der Zeit den Werth der
ausgeuͤbten Kraft F und die Dauer t oder dt der Zeit,
waͤhrend der sie wirkte, und mithin das Product dieser beiden
Quantitaͤten Ft oder Fdt, d.h. die Quantitaͤt der Totalbewegung
sFdt, welche waͤhrend der ganzen Zeit
seiner Thaͤtigkeit durch den Kraftaufwand hervorgebracht wird, angeben.
Bei der Anwendung der Kraͤfte auf die Industrie, wie z.B. auf das Ziehen von
Wagen, auf das Ziehen von Schiffen, auf Eisenbahnen etc., kommt es aber in der
Hauptsache nicht darauf an, die Quantitaͤt der Bewegung oder das Product der
Kraft und der Dauer ihrer Wirkung, – ein Product, welches bekanntlich jenem
der Masse multiplicirt mit der Geschwindigkeit, welche die vom Anfange der Wirkung
der Kraft bis zum Augenblike der Beobachtung erlangte, gleich ist, – zu
bestimmen; sondern es handelt sich vielmehr um die Quantitaͤt der
vollbrachten Arbeit oder um das Product der ausgeuͤbten Kraft mit der in
ihrer Richtung durchlaufenen Wegstreke. Dieses leztere Produkt ist es
naͤmlich, welches zur Bemessung des Nuzeffectes aller Triebkraͤfte
oder Motoren dient.
Es waͤre hier am unrechten Orte mich weiter hieruͤber zu verbreiten;
ich beschranke mich daher auf Andeutung dieses Unterschiedes, weil es mir scheint,
daß ein Apparat, der den Werth des Kraftaufwandes (effort) und des durchlaufenen Raumes und das Product aus diesen beiden
Quantitaͤten angibt, dem Zweke der Gesellschaft und den Beduͤrfnissen
der Industrie besser entspricht, als ein solcher, der den Werth des Kraftaufwandes
und jenen der Zeit oder die Quantitaͤt der Bewegung andeutet.
Man wird uͤberdieß einsehen, daß man, um den Kraftaufwand und die Zeit zu
bestimmen, nicht nur eines Dynamometers, sondern auch eines Chronometers bedarf,
wodurch die Aufgabe viel verwikelter, der Preis der Instrumente weit hoͤher
und deren Benuzung weit schwieriger werden wuͤrde. Uebrigens laͤßt
sich die Aufgabe auch von diesem Standpunkte aus auf ziemlich einfache Weise
loͤsen; ja sie ward es bereits im Jahre 1834 von mir bei Gelegenheit der
Versuche, welche ich uͤber das Eindringen kugeliger Koͤrper in weiche
Medien und uͤber die Geseze der Fortpflanzung der Bewegung durch den Stoß anstellte, und deren
Resultate man im 6ten Bande des von der Akademie herausgegebenen Recueil des savans étrangers abgedrukt
findet.
§. 2. Ich habe mir bei der Verfertigung einer dynamometrischen Feder (ressort dynamométrique) folgende Bedingungen
gesezt:
1) sollen die verschiedenen Biegungen oder Fluxionen der Vorrichtung mit den
ausgeuͤbten Kraͤften im Verhaͤltnisse stehen. Dadurch wird
naͤmlich das Instrument bequem zu handhaben; denn wenn ein Mal das
Verhaͤltniß dieser Kraͤfte zu den Biegungen bekannt ist, so braucht
man nur leztere zu messen oder eine Andeutung derselben zu haben, um ohne alle
Berechnung und mit einem einfachen Tarirungsmaaßstabe den Ausdruk fuͤr den
Kraftaufwand zu erhalten.
2) soll die Empfindlichkeit des Instrumentes mit der Intensitaͤt der zu
messenden Kraͤfte im Verhaͤltnisse stehen.
3) darf die Elasticitaͤt des Instrumentes durch den mehr oder minder raschen
Wechsel des Kraftaufwandes nicht Schaden leiden.
§. 3. Anwendung der Theorie des Widerstandes der festen
Koͤrper gegen die Biegung auf den gegenwaͤrtigen Fall. Ich
glaube in dieser Hinsicht nicht auf eine detaillirte Auseinandersezung eingehen zu
muͤssen, sondern beschraͤnke mich darauf in Erinnerung zu bringen,
daß, wenn die Federplatten die parabolische Gestalt eines gleichen Widerstand
leistenden festen Koͤrpers haben, und wenn
a die Laͤnge einer elastischen Platte, von dem
Einfuͤgungspunkte an bis zu jenem Punkte gerechnet, an welchem sie durch die
zu ihrer Biegung noͤthige Normalkraft angereizt wird, bezeichnet;
b deren Dike nach der Richtung der
Biegungsflaͤche;
c deren Breite in einer senkrecht gegen diese
Flaͤche laufenden Richtung;
f die Biegung in normaler Richtung gegen die
urspruͤngliche Direction der Platte gemessen;
P die Kraft, welche normal in eben dieser Direction
ausgeuͤbt wird;
A einen Elasticitaͤts-Coefficienten,
welcher fuͤr einen und denselben Koͤrper constant, von einem zum
anderen hingegen wandelbar ist; zwischen diesen Quantitaͤten das
Verhaͤltniß f = fPc³/Aab³ besteht, wonach man
jede einzelne bestimmen kann, wenn die uͤbrigen bekannt sind. Bei der
Anwendung dieser Formel, um die es sich hier handelt, hat man die Dimensionen der
Feder so zu bestimmen, daß sie unter einer gegebenen Kraft eine bestimmte Biegung
annimmt; indem hiedurch,
da sich die uͤbrigen Biegungen innerhalb ziemlich ausgedehnten, immer aber
den Kraͤften proportionalen Graͤnzen befinden, fuͤr alle
Faͤlle dasselbe Verhaͤltnis hergestellt seyn wird.
§. 4. Von den Verhaͤltnissen, welche zwischen den
verschiedenen Proportionen der Federn herzustellen sind. Die zu obiger
Formel fuͤhrende Theorie fußt sich auf gewisse Hypothesen, die innerhalb der
Graͤnzen der Verlaͤngerung, welche die Koͤrper durch die
Biegung erleiden, ziemlich genau mit den Resultaten angestellter Versuche
uͤbereinstimmen. Hieraus ergibt sich, daß die Dimensionen der Federplatten in
solchen Verhaͤltnissen zu einander stehen sollen, daß die bewirkten Biegungen
diese Graͤnzen nicht uͤberschreiten.
Ich habe aus der Verfertigung verschiedener Dynamometer erfahren, daß man immer den
Lasten proportionale Biegungen erhaͤlt, so lange die Gesammtbiegung nicht
uͤber 0,10 bis 0,08 Meter der Laͤnge der Platte betraͤgt.
Hienach ließe sich a priori zwischen f und c folgendes
Verhaͤltniß sezen:
f = 0,10 c
fuͤr kleine Federn von
100 bis 150 Kilogr.
f = 0,08 c
fuͤr große Federn von
150 bis 600 –
Was die Breite a der Feder in einer gegen die
Biegungsflaͤche senkrechten Richtung betrifft, so kann diese beinahe
willkuͤrlich angenommen werden. Sie soll jedoch nicht uͤber 0,04 Meter
betragen, weil das beim Haͤrten entstehende Werfen um so merklicher wird, je
groͤßer die Breite ist, und weil hieraus bei der Adjustirung Schwierigkeiten
erwachsen.
§. 5. Von der Bestimmung des
Elasticitaͤts-Coefficienten des zur Verfertigung der Federn
verwendeten Stahles. Der Elasticitaͤts-Coefficient A des Gußstahles war zu der Zeit, wo ich die ersten
Dynamometer verfertigen ließ, noch nicht zur Genuͤge bekannt; ich konnte mich
jedoch bei deren Verfertigung selbst von dessen Werth mit einer fuͤr
technische Zweke hinreichenden Genauigkeit uͤberzeugen.
Bei der Beobachtung der Biegungen eines ersten Dynamometers, welchen ich bei
Versuchen uͤber die Reibung anwendete, fand ich
A = 33444000000
Kilogr.
Bei der Beobachtung zweier anderer Dynamometer,
von denen jeder eine Kraft von 200 Kilogr. hatte, fand ich fuͤr den
einen
A = 27595000000
Kilogr.
und fuͤr den anderen
= 29833000000
–
Bei einem vierten endlich von einer Kraft von
400 Kilogr. war
A = 36910000000
Kilogr.
Das Mittel dieser vier Werthe, auf welche die Verschiedenheit der Qualitaͤt des
angewendeten Stahles einen sehr merklichen Einfluß ausuͤben konnte, ist
demnach A = 31945500000 Kilogr.; und auf dieses kann man
bei der Berechnung der Dynamometer mit Zuversicht bauen, weil es sich nicht um
Herstellung eines strengen Verhaͤltnisses zwischen den Verhaͤltnissen
und der Biegung handelt; sondern weil es bloß darum zu thun ist, im Voraus eine
Graͤnze zu bestimmen, von der sich dasselbe nicht zu weit entfernt. Wenn das
Instrument fertig ist, so sucht man den genauen Werth dieses Verhaͤltnisses,
indem man es der Einwirkung bekannter Kraͤfte aussezt, und die da, durch
entstehenden Biegungen beobachtet, woraus sich der wirkliche Tarirungsmaaßstab (echelle de tare) des Dynamometers ergibt.
§. 6. Von der Anordnung der Federplatten. Mit
Huͤlfe der eben angedeuteten Verhaͤltnisse und des Werthes des
Elasticitaͤts-Coefficienten wird es leicht seyn aus der in §. 3
gegebenen Formel eine der drei Quantitaͤten f, a
und b abzuleiten, wenn die beiden uͤbrigen
gegeben sind. Ich will sogleich mehrere Anwendungen hievon auf bereits verfertigte
Dynamometer zeigen; vorher jedoch deren Bau im Allgemeinen erlaͤutern.
Ich gab dem Profile der Federplatten nach der Richtung der Biegung die Gestalt eines
festen Koͤrpers von gleichem Widerstande, weil sich hieraus bei gleicher
Krafteinwirkung und mit gleichem Widerstaͤnde gegen den Bruch eine doppelt
groͤßere Biegung als mit einem festen Koͤrper von gleicher Dike
ergibt, und weil mithin das Instrument um so empfindlicher wird. Ich sezte den
Dynamometer aus zwei vollkommen gleichen Federn zusammen, die, wie man in Fig. 1 und 2 bei a, a' und b, b' sieht, an
ihren Enden in ein Ohr von gleicher Breite auslaufen, durch welches in der Richtung
der Breite ein Loch gebohrt ist. Durch diese Ohren, so wie auch durch die
Baͤnder f, f, welche uͤber und unter den
Federn angebracht sind, sind kleine staͤhlerne Bolzen gefuͤhrt, und
mit Schraubenmuttern solcher Maßen daran fixirt, daß sich die Federn mit
Leichtigkeit in ihrer Laͤngenrichtung bewegen, und von selbst in
Parallelismus gelangen koͤnnen, wenn die Kraft senkrecht gegen die Feder b, b' wirkt, die auf folgende Weise an dem zu ziehenden
Koͤrper befestigt ist.
Durch das Gehaͤuse oder durch die Klemme c ist
eine Oeffnung geschnitten, durch welche die Feder ihrer Laͤnge nach so
gestekt wird, daß die in deren Mitte gelassene Schulter (deren Dimensionen genau der
Weite der Klemme entsprechen) in dieses leztere zu ruhen kommt. Die an ihren Enden
kegelfoͤrmig gestalteten Drukschrauben g zwangen
die Feder in dem Gehaͤuse fest ein. Die Laͤnge der Feder wird von
ihrem Austritte aus dem Gehaͤuse bis zu dem Mittelpunkte der beiden
Loͤcher b, b' gerechnet. Die vordere Feder a, a' ist auf aͤhnliche Weise gleichfalls durch ein
Gehaͤuse d gefuͤhrt, und an diesem ist ein
Ring r, auf den die Zugkraft wirkt, angebracht.
Bei dieser Einrichtung des Dynamometers ist die Zugkraft gleichmaͤßig
zwischen, den beiden Gefuͤgen vertheilt und jeder Arm der beiden Federn der
Haͤlfte dieser Kraft ausgesezt. Da sich aber die Mitten der beiden Federn um
das Doppelte der Biegung der Enden von einander entfernen, so folgt hieraus, daß die
Empfindlichkeit des Instrumentes zwei Mal so groß ist, als jene einer jeden
einzelnen Feder.
Uebrigens ist es gut, wenn in Hinsicht auf die erwaͤhnten Klemmen c, d eine solche Einrichtung getroffen ist, daß sich
dies selben beruͤhren, wenn sich das Instrument im Zustande der Ruhe
befindet; denn auf diese Weise koͤnnen sie bei den Schwingungen nicht jenen
Punkt uͤberschreiten, der einem Null von Spannung entspricht. Diese
Vorsichtsmaßregel ist zwar nicht in allen Faͤllen streng nothwendig; allein
sie gewaͤhre unter gewissen Umstaͤnden Vortheile, die man erst
spaͤter zu wuͤrdigen lernen wird. Endlich muß ich bemerken, daß sich
die Klemmen auch so einrichten lassen, daß sie nach Belieben verschiedene Federn
aufnehmen koͤnnen.
§. 7. Resultate der uͤber den Gang der Biegungen
der Federn angestellten Versuche. Nachdem ich angegeben habe, welche
Richtschnur man bei der Bestimmung der Dimensionen der Federn zu befolgen hat, und
welche Anordnung ihnen gegeben wurde, will ich nun zeigen, mit welcher Genauigkeit
man auf diesem Wege Dynamometer erzielen kann, die innerhalb sehr ausgedehnter
Glaͤnzen Biegungen erleiden, welche den ausgeuͤbten Kraͤften
proportional sind.
Der erste von mir verfertigte Dynamometer gab als
Elasticitaͤts-Coefficienten des Gußstahles A = 33444000000 Kilogr. Da sich außerdem a =
0,020 M., c = 0,25 M., f =
0,25 M., und P = 50 Kilogr. ergab, so wurde aus der in
§. 3 angegebenen Formel abgeleitet: b = 0,0072
M.
Nach diesen Daten und der Formel sollte der Dynamometer per Kilogr. Spannung eine Zunahme der Biegung um 0,0005 M. zeigen, wobei
zu bemerken kommt, daß in Folge der getroffenen Anordnung der Federn die wirklichen
Biegungen eines jeden ihrer Arme nur die Haͤlfte der Gesammtzunahme der
Entfernung der Arme von einander betragen.
Dieser Dynamometer ward nun an einem fixen Punkte so aufgehaͤngt, daß die
Federn horizontal standen, worauf dann allmaͤhlich bekannte Gewichte
angehaͤngt wurden, die von 5 zu 5 Kilogr. zunahmen. Die hieraus folgende
Zunahme der Biegung oder des Voneinanderweichens der Federn ward mit einem
Culissen-Decimeter, mit dessen Huͤlfe man Zehntheile eines Millimeters
bestimmen konnte, beobachtet. Als Resultat dieser Beobachtungen ergab sich, daß die
constante Zunahme der Biegung von 0 bis zu 100 Kilogr. 0,00052 und nicht 0,00050
Meter per Kilogr. betrug. Da es nun wenig darauf
ankommt, ob dieses Verhaͤltniß diesen oder jenen Werth hat, wenn nur die
Tarirung genau den wirklichen Werth hat, so folgt hieraus, daß dieses Instrument
seinem Zweke vollkommen entsprochen hat.
Zu Versuchen uͤber das Ziehen der Wagen, welche gegenwaͤrtig in
Ausfuͤhrung sind, so wie zu anderen Versuchen, die unmittelbar uͤber
das Anholen von Schiffen vorgenommen werden sollen, ließ ich zwei andere Dynamometer
verfertigen, mit denen Zugkraͤfte, welche bis an 200 Kilogr. betragen,
gemessen werden koͤnnen. Um deren Dimensionen nicht auf eine laͤstige
und hemmende Weise zu erhoͤhen, ward die Zunahme der einem jeden
Spannungskilogramm entsprechenden Biegung auf 0,00025 Meter beschraͤnkt.
Hiebei ergibt sich bei einem Kraftaufwands von 100 Kilogr. eine Approximation von
1/100, weil es mit den Mitteln, die ich angeben werde, ein Leichtes ist einen den
vierten Theil eines Millimeters betragenden Unterschied in der Biegung zu
messen.
Nach der Beobachtung des vorhergehenden Dynamometers ist A = 33444000000 Kilogr. Es ist ferner gegeben: a = 0,03 M., c = 0,25 M., P = 100, f = 0,025 M. Mithin
ist nach der in §. 3 gegebenen Formel
b = 0,0079 Meter.
Nach Vollendung dieser Instrumente wurden deren Biegungen auf dieselbe Weise wie bei
dem zuerst angegebenen durch bekannte Kraͤfte erprobt. Als Resultat ergab
sich, daß die Biegungen regelmaͤßig um eine constante Quantitaͤt
stiegen, welche an dem ersteren von 25 bis zu 200 Kilogr. bei jeder Vermehrung der
Spannung um einen Kilogramm im mittleren Durchschnitte 0,000303, an dem zweiten
hingegen 0,000280 Meter betrug.
Diese beiden mittleren Werthe sind merklich groͤßer, als jene, auf welche man
zahlen konnte, wenn man die Dimensionen des Dynamometers nach dem aus der
Beobachtung des ersten Instrumentes abgeleiteten
Elasticitaͤts-Coefficienten A berechnete.
Es ruͤhrt dieß ohne Zweifel von einer Verschiedenheit in der Qualitaͤt
des angewendeten Stahles her: so zwar, daß sich der Werth des
Elasticitaͤts-Coefficienten dieser beiden Federn berechnet:
fuͤr erstere
A = 27595000000 Kilogr.
fuͤr leztere
A = 29833000000 Kilogr.
Endlich ließ ich auch noch einen vierten, den vorhergehenden aͤhnlichen
Dynamometer verfertigen, der jedoch eine Kraft von 400 Kilogr. auszuhalten im Stande
war, und bei jeder Vermehrung der Spannung um einen Kilogramm eine Zunahme der
Biegung um 0,00015 Meter zeigte.
Es war an diesem a = 0,04 M., c = 0,30 M., f = 0,30 M., P = 200 Kilogr., A =
27595000000; mithin berechnete sich:
b = 0,0135 Meter.
Die mit diesem Instrumente nach der angegebenen Art angestellten Versuche zeigten,
daß dasselbe genau den gewuͤnschten Grad der Empfindlichkeit hatte, und von 0
bis zu 400 Kilogr. hinauf Biegungen erlitt, die per
Kilogramm regelmaͤßig um 0,00015 Meter stiegen.
Das Zusammenstimmen aller dieser Resultate beweist, daß man mit Huͤlfe der in
§. 3 und 4 gegebenen Formeln und Regeln und mit Huͤlfe des Werthes des
Elasticitaͤts-Coefficienten des Gußstahles leicht einen Dynamometer
verfertigen kann, der eine bestimmte Empfindlichkeit besizt, und der bekannte
Kraͤfte auszuhalten im Stande ist.
§. 8. Von Wesenheit ist es auch, im Voraus das Maximum der Kraft bestimmen zu
koͤnnen, welche ein Dynamometer ohne Gefahr der Beeintraͤchtigung
seiner Elasticitaͤt auszuhalten vermag. Nach der in §. 4 aufgestellten
Regel laͤßt sich diese Kraft immer leicht berechnen; denn ich habe daselbst
angenommen, daß die groͤßte Biegung nicht uͤber 0,10 bis 0,08 der
Laͤnge der Feder betragen darf; und nach der in §. 3 gegebenen Formel
laͤßt sich der Werth der Kraft P, die diese
Biegung erzeugt, leicht bestimmen.
§. 9. Von den Mitteln zur Verhuͤtung der
Ueberwaͤltigung der Feder. Wenn auf die eben angedeutete Weise die
Glaͤnze der Kraft bestimmt worden ist, muß eine Vorkehrung getroffen werden,
wodurch der Dynamometer im Falle die Kraft diese Glaͤnzen
uͤberschritte, verhindert wird, seinerseits das angegebene Maximum der
Biegung zu uͤberschreiten. Man braucht zu diesem Zweke nichts weiter, als an
dem Hinteren Bande oder Stege c seiner Fassung zwei
gekniete Aufhaltarme h, h anzubringen, und die
Laͤnge dieser so zu bestimmen, daß sich die bewegliche Feder unter der
Einwirkung des Maximums der Kraft gegen sie stemmt. In diesem Falle wird all der
Ueberschuß an Kraft von diesen Aufhaͤltern, die gehoͤrig proportionirt
seyn muͤssen, getragen.
Bei dieser Vorkehrung wird der Dynamometer in Hinsicht auf seine Elasticitaͤt
nie Schaden leiden, welche Erschuͤtterungen und Intermittenzen der Spannung
auch auf ihn einwirken moͤgen. Als Beispiel erwaͤhne ich einen
Dynamometer von der Kraft von 100 Kilogr., den ich in den Jahren 1831 bis 34 bei meinen
Versuchen uͤber die Reibung benuzte, und der oft eine Gewalt von 300 und 400
Kilogr. aushielt, und dem ploͤzlichen Wechsel in der Spannung von 0 bis zur
aͤußersten Graͤnze derselben ausgesezt war, ohne daß seine
Elasticitaͤt waͤhrend dieser vierjaͤhrigen Dienstzeit auch nur
im Geringsten Schaden gelitten haͤtte.
§. 10. Die oben angegebenen Regeln lassen sich auch auf die Verfertigung
isolirter dynamometrischer Federn mit einem einzigen Arme anwenden; ich bediente
mich ihrer auch zur Herstellung eines Rotationsdynamometers, womit die constante,
wechselnde oder mittlere Kraft, die einer Rolle durch eine Treibschnur oder ein
Laufband, oder einer Welle durch ein Raͤderwerk mitgetheilt wird, gemessen
werden kann. Ich glaube hier keine Beschreibung dieses Apparates geben zu sollen, da
derselbe nicht direct unter die Classe jener gehoͤrt, welche die Gesellschaft
gefordert hat. Ich bemerke daher nur, daß man ihn in einer Abhandlung, welche ich am
Anfange des Jahres 1835 der Akademie der Wissenschaften in Betreff mehrerer neuer
Versuche uͤber die Reibung vorlegte, beschrieben findet, und daß ich mich
seiner den ganzen Sommer 1834 uͤber mit bestem Erfolge bediente.
§. 11. Von der Curve des Laͤngenprofiles der
Federn. Da die Dike der Feder nach der Richtung der Biegung an jenem
Theile, an welchem sie in die fixirten oder beweglichen Gehaͤuse eingerahmt
ist, bekannt ist; und da das Profil der Feder nach derselben Richtung jenes eines
festen Koͤrpers von gleichem Widerstaͤnde seyn muß, so laͤßt
sich die parabolische Curve dieses Profiles leicht ziehen. An der inneren Seite sind
naͤmlich die Federplatten gerade, wenigstens in so weit, als es das durch die
Haͤrtung unvermeidlich erzeugte Werfen gestattet; nach Außen hingegen haben
sie die Gestalt einer Parabel, welche durch die Gleichung
y² = (b²/c) x
bezeichnet ist.
Wenn x die Abcissen an dem geradlinigen Theile von dem
Ende der Feder an oder von der Entfernung c des
Einrahmungspunktes an gemessen, und y die Ordinaten des
Profiles sind, so ergeben sich z.B. fuͤr die Dynamometer
Textabbildung Bd. 65, S. 268
v. 100 Kilogr.; v. 200 Kilogr.; v.
400 Kilogr.; Werthe v. x; Werthe v. y
Wenn die Federn geschmiedet sind, so kann man, wenn sich ihr
Profil merklich von diesen Proportionen entfernen sollte, sie leicht durch Feilen
auf dieses zuruͤkfuͤhren.
§. 12. Von den Mitteln zur Erzielung einer bleibenden
Spur der Biegungen waͤhrend eines bestimmten Zeitraumes. Da das
bisher Gesagte den auf den Bau der eigentlichen Dynamometer bezuͤglichen
Theil der Frage genuͤgend aufklaͤren duͤrfte, so habe ich
nunmehr nur noch anzudeuten, welche Mittel ich in Anwendung brachte, um entweder
eine bleibende Spur all der verschiedenen, constanten oder mittleren Spannungen,
denen der Apparat ausgesezt gewesen war, oder die Totalsumme der auf einer gegebenen
Wegstreke oder selbst innerhalb einer bestimmten Zeit ausgeuͤbten Arbeit zu
erhalten.
§. 13. Von der Erzielung einer bleibenden Spur der
Biegungen. Um eine Spur jener Biegungen zu erhalten, die der Dynamometer in
jedem Augenblike erleidet, bediente ich mich mit bestem Erfolge folgender, aus Fig. 1 und 2 ersichtlichen
Vorrichtung.
Das Gehaͤuse c ist an dem Koͤrper, welcher
fortgezogen wird, und der nach Belieben ein Schlitten, ein Wagen, ein Boot etc. seyn
kann, fixirt. Hinter der durch dasselbe gefuͤhrten Federplatte ist senkrecht
mit der Flaͤche der Federn ein cylindrisches Loch durch dasselbe gebohrt.
Durch dieses Loch ist eine Spindel i gefuͤhrt, an
deren oberem Theile eine Schraubenmutter k und eine
Gegenschraubenmutter angebracht ist, die aber ganz einfach auch mit einem als
Ausladung oder Schulter dienenden Kopfe versehen seyn koͤnnte. Unter den
Federn und in einer Entfernung von 0,2 oder 0,3 Met. traͤgt diese Spindel
zuerst eine vollkommen ebene, messingene Platte l, auf
die ein Blatt Papier geleimt wird, und weiter unten eine mit einer oder mehreren
Kehlen ausgestattete Rolle m. Diese Kehle dient zur
Aufnahme einer Schnur, welche zum Umtreiben der Rolle bestimmt ist. Handelt es sich
um einen Schlitten oder um ein Boot, so wird das eine Ende dieser Schnur hinter dem
beweglichen Koͤrper an einem fixen Punkte, und das andere Ende entweder in
der Kehle oder vor ihr an einem anderen fixen Punkte befestigt; in welchem Falle die
Schnur ganz um die Rolle laͤuft. Soll der Apparat auf einer ziemlich langen
Streke, z.B. durch 50 Meter, in Thaͤtigkeit seyn, so waͤre auch
fuͤr die angedeuteten Faͤlle anstatt der eben erwaͤhnten
Vorrichtung die folgende, hauptsaͤchlich fuͤr alle Arten von
Raͤder-Fuhrwerken geeignete in Anwendung zu bringen. Die Kehle der
Rolle ist naͤmlich mit einer Schnur umschlungen, welche vermittelst kleiner
Leitungsrollen auch um die Rabe des einen der Raͤder gefuͤhrt ist. Sowohl in dem
einen, als in dem anderen Falle pflanzt sich die Bewegung des Koͤrpers in
einem constanten Verhaͤltnisse an die Messingplatte fort. So ist z.B. an
Schlitten und Booten die Geschwindigkeit des Umfanges der Kehle genau jene der
Ortsveraͤnderung dieser Koͤrper; waͤhrend sie an den
Raͤderfuhrwerken zu jener des Rades oder zu dem durchlaufenen Raͤume
in einem Verhaͤltnisse steht, welches von den Speichen des Rades, der Nabe
und der Rolle abhaͤngt.
§. 14. Ich muß bemerken, daß, wenn man bei gewissen Versuchen den Kraftaufwand
in Hinsicht auf die Zeit bestimmen muͤßte, der Platte irgend eine bekannte
gleichfoͤrmige Bewegung zu geben waͤre. Dieß ist leicht mittelst
chronometrischer Apparate zu erzielen; ich selbst bediente mich solcher bei mehreren
Versuchen, wie ich dieß denn auch in meiner oben erwaͤhnten Abhandlung
beschrieben habe.
§. 15. Von dem zur Hervorbringung der Spur dienenden
Zeichenstifte. Wenn man auf das in §. 13 Gesagte zuruͤkgeht,
so sieht man, daß jedem Umgange der Platte ein bestimmter Raum, den der bewegliche
Koͤrper durchlief, entspricht. Das vordere Gehaͤuse hat nun
gleichfalls eine Oeffnung und zwar parallel mit jener, durch die die Rotationsachse
dieser Platte gefuͤhrt ist. Diese im Inneren mit einem Schraubengewinde
versehene Oeffnung dient der messingenen Schraube n,
welche zu leichterer Handhabung mir einem großen Kopfe versehen ist, als
Schraubenmutter. Der untere Theil dieser Schraube ist mir einer kleinen Dille
versehen, in welcher sich ein Pinsel befindet, dessen Spize, wenn sie in chinesische
Tusche oder in irgend eine andere Art von Tinte getaucht ist, und mit Huͤlfe
des Kniehebels p, auf den die Feder q druͤkt, in Beruͤhrung mit der Platte
herum gefuͤhrt wird, auf das Blatt Papier eine Curve der Biegungen
verzeichnet. Wenn die auf den Dynamometer ausgeuͤbte Kraft constant bleibt,
so bleibt auch die Entfernung der beiden Federn von einander eine und dieselbe, so
daß die von dem Pinsel beschriebene Curve einen Kreis bildet; wechselt die Kraft
hingegen, so wird sich, je nachdem die Kraft zu- oder abnimmt, die Curve von
der Achse entfernen oder sich ihr naͤhern. Da uͤbrigens der Anfang der
Bewegung und der Curve auf dem Papiere angedeutet ist, so ist es klar, daß man
fuͤr jede Stellung des Koͤrpers die Biegung und folglich auch die
ausgeuͤbte Kraft messen kann. Uebrigens ist der Halbmesser des Kreises, der
dem Momente, in welchem die Feder abgespannt war, entspricht, im Voraus bekannt; man
kann daher veranstalten, daß sich die Federn in dieser Stellung einander noch weiter
naͤhern koͤnnen oder nicht.
§. 16. Von der Bestimmung der mittleren Kraft. Wenn
der zu messende Kraftaufwand um irgend einen mittleren Werth, wie z.B. um jenen
eines Pferdes, eines Menschen etc. herum schwankt, so wird die Doppelkreuzung der
Curven natuͤrlich die mittlere Curve der Biegungen und mithin die mittlere
Kraft, welche man zu wissen wuͤnscht, geben. Will man hingegen die
wandelbare, jeder einzelnen Stellung entsprechende Kraft haben, so braucht man nur
die beschriebenen Bogen zu entwikeln, sie in Raͤume, welche von dem
Koͤrper durchlaufen wurden, zu uͤbertragen, – was leicht
geschehen kann, da diese Quantitaͤten durch ein constantes Verhaͤltniß
miteinander verbunden sind, – und dann diese Raͤume fuͤr die
Abscissen einer Curve zu nehmen, deren Ordinaten die Kraͤfte und die einem
jeden Raͤume entsprechenden Biegungen waͤren. Die nach den bekannten
Methoden vorgenommene Quadratur dieser Curve wird offenbar den Werth der auf dem
durchlaufenen Wege entwikelten Totalarbeit liefern. Eben so kann man auch das Mittel
des Kraftaufwandes, oder die hoͤchste und geringste Kraft, welche
ausgeuͤbt wurde, und wenn eine Periodicitaͤt in den Schwankungen der
Kraft Statt faͤnde, deren Glaͤnzen ausmitteln und bestimmen.
§. 17. Anstatt eines Pinsels kann man, wie Fig. 1 zeigt, auch einen
Bleistift anwenden; dieser muͤßte durch eine leichte Spiralfeder gegen das
Papier angedruͤkt werden. Eben so kann man sich eines hohlen Gehaͤuses
bedienen, welches mit Tinte angefuͤllt, und an dem oberen Ende verschlossen,
an dem unteren kegelfoͤrmigen Ende hingegen mit einem haarduͤnnen
Loche versehen ist. Die Spize des Pinsels muß fein seyn, und darf durch den Druk der
Schraube, die wie der Pinsel selbst die Richtung des von der Platte beschriebenen
Kreises annimmt, nur wenig auf das Papier niedergebogen werden. Diese Biegung
uͤbt uͤbrigens auf das Maaß der Biegung der Feder nur einen sehr
geringen Einfluß. Damit der Pinsel eine hinreichende Menge Tusche fassen kann, muß
er am Koͤrper wenigstens 0,003 bis 0,004 Meter im Durchmesser haben. Ich
bediene mich gewoͤhnlicher Haarpinsel, die ich aus den Kielen nehme, und die
ich, nachdem ich sie in einer Entfernung von 0,010 oder 0,012 M. von ihrer Spize
gebunden, in die kleine Dille bringe, welche auf den Stiel geschraubt wird. Endlich
kann man auch noch einen Schieferstift, der auf eine Schieferplatte zeichnet, oder
eine etwas abgestumpfte metallene Spize, welche in irgend eine weiche Substanz
zeichnet, oder eine andere beliebige Vorrichtung anwenden.
§. 18. Man kann sich denken, daß man den Zeichenstift nicht zu lange zeichnen
lassen darf, ausgenommen es handelt sich bloß um Ausmittelung der mittleren Kraft;
denn nach 5 bis 6 Umlaͤufen der Rolle wird es schwer die Curven von einander zu
unterscheiden. Man kann aber den Rollen solche Verhaͤltnisse geben, daß man
z.B. die Curve jener Biegungen erhaͤlt, die einem durchlaufenen Raum von 10
bis 12 Meter entsprechen. Handelt es sich aber nur um die mittlere Kraft, so kann
man den Zeichenstift weit laͤnger, und waͤhrend einer Streke von
wenigstens 50 Meter zeichnen lassen.
§. 19. Nach beendigtem Versuche nimmt man die Platte ab, wo man dann durch
Messung der Biegungen und nach dem bekannten Verhaͤltnisse, welches zwischen
diesen und den angewendeten Kraͤften besteht, leztere bestimmen kann. Wollte
man jedoch auch diese Berechnung umgehen, so koͤnnte man sich eines kleinen
Richtscheites bedienen, welches in das im Mittelpunkt der Platte befindliche Loch
eingesezt oder gegen den Absaz der Achse angelegt wird, und auf dem eine im Voraus
gemachte Eintheilung angebracht ist. Von diesem Richtscheite kann man, wenn man es
in der Richtung eines Halbmessers auf die Platte legt, mit Leichtigkeit den einer
bestimmten Biegung entsprechenden Werth der Kraft ablesen.
§. 20. Der hier beschriebene Apparat gibt demnach Mittel an die Hand, womit
man ohne alle Beihuͤlfe des Calculs und durch einfache Betrachtung der von
dem Zeichenstifte zuruͤkgelassenen Spuren die mittlere oder die wandelbare
Kraft erfahren kann, die auf einen Schlitten, einen Wagen, ein Boot, einen Pflug
oder uͤberhaupt auf irgend einen gezogenen Koͤrper wirkte. Seine
Empfindlichkeit laͤßt sich den zu messenden Kraͤften anpassen, und er
kann ohne Nachtheil heftigen Gewalten und Erschuͤtterungen widerstehen. Er
ist leicht anwendbar, und kann in die Haͤnde eines jeden einfachen Arbeiters
gelegt werden. Er laͤßt sich durch ein Gehaͤuse, in welches man ihn
bringt, gegen die nachtheiligen Einfluͤsse der Witterung schuͤzen. Er
gibt Andeutungen, die von dem Willen desjenigen, der sich seiner bediente,
unabhaͤngig sind, und die von ihm gelassenen Spuren lassen sich nicht
veraͤndern. Sein Preis endlich erleidet durch die Verschiedenheit der
Staͤrke der Federn keine großen Veraͤnderungen, indem man
vollstaͤndige Dynamometer dieser Art von 100 bis zu 600 Kilogr. fuͤr
die unbedeutende Summe von 250 Fr. liefern kann.
§. 21. Um den von der Gesellschaft gestellten Bedingungen zu genuͤgen,
habe ich nunmehr anzugeben, welche Vorkehrung ich in Anwendung brachte, um
waͤhrend einer bestimmten Streke oder einer bestimmten Zeit von
groͤßerer Ausdehnung die Totalsumme der Arbeit, die von irgend einer nach
einer bestimmten Richtung wirkenden Triebkraft vollbracht wurde, zu messen. Auf
diese Frage nun findet das, was ich von meiner ersten Art von Dynamometer gesagt
habe, vollkommene Anwendung; und nach der muthmaßlichen Intensitaͤt der ausgeuͤbten
oder zu messenden Kraft wird es leicht seyn eine Feder von gehoͤriger
Staͤrke zu verfertigen. Der einzige Unterschied besteht darin, daß an dem
Instrumente ein Apparat anzubringen ist, vermoͤge dessen man sich nach
Zuruͤklegung irgend einer bestimmten Streke bloß durch das Gesicht von der
durch die Triebkraft vollbrachten Quantitaͤt der Arbeit uͤberzeugen
kann. Uebrigens ist klar, daß, wenn die Quantitaͤt der auf einer bestimmten
Streke vollbrachten Arbeit bekannt ist, man die mittlere ausgeuͤbte Kraft
bekommt, wenn man jene Quantitaͤt durch diese Streke theilt.
§. 22. Ich will eine Beschreibung des von mir in Anwendung gebrachten
Zahlapparates vorausschiken, und dann erst die Theorie und praktische Benuzung
desselben erlaͤutern.
Das hintere Gehaͤuse oder die Hintere Klemme A,
welche man in Fig.
3 und 4 sieht, nimmt hinter der stritten Feder E
eine Rotationsachse Q' auf, und zwar in demselben Loche,
welches an dem zuerst beschriebenen Dynamometer die Platte, auf die der Zeichenstift
zeichnete, trug. An dieser Achse ist eine Scheibe B von
einem Halbmesser von 0,076 Met., welche uͤber die Federn zu liegen kommt, und
eine Rolle C aufgezogen, an die die Rotationsbewegung
durch aͤhnliche Mittel, wie oben in §. 13 angegeben wurden,
fortgepflanzt wird. An dem beweglichen Gehaͤuse D
ist mit einer Schraube ein Traͤger a, b
befestigt, welcher allen Bewegungen desselben folgen kann. Das Ende b dieses Traͤgers traͤgt das Stuͤk
c, d, an welchem sich der ganze Zaͤhlapparat
befindet.
Lezterer besteht aus einer Rotationsachse e, f, die mit
der Flaͤche der Scheibe parallel laͤuft, und die mit ihrem Zapfen e in das Stuͤk c, d,
mit dem Zapfen f hingegen in den
zuruͤkgekruͤmmten Arm g desselben
Stuͤkes eingesezt ist. Sie traͤgt gegen f
hin einen Laͤufer h von 0,05 Meter im
Durchmesser; gegen e hingegen ein kegelfoͤrmiges
Getrieb i, welches 16 Zaͤhne und in der Mitte
einen Durchmesser von 0,012 Meter hat. Wenn sich die Scheibe dreht, so fuͤhrt
sie in Folge der Statt findenden Reibung den Laͤufer h mit sich. Man kann, um diese Reibung zu erhoͤhen, die miteinander
in Beruͤhrung stehenden Oberflaͤchen mit Bimsstein oder mit Sand
abreiben; jedoch fand ich dieß an dem ersten Apparate, den ich verfertigte, nicht
fuͤr noͤthig, und noch weniger duͤrfte es an den Apparaten, die
ich dermalen verfertigen lasse, erforderlich seyn, indem diese viel leichter
ausfallen werden. Es erhellt uͤbrigens, daß, wenn sich der Laͤufer im
Mittelpunkt der Scheibe befindet, wo die Geschwindigkeit heinahe null ist, er sich
nicht umdreht: eine Stellung, welche jenem Falle, wo die Feder im Zustande der Ruhe
ist, entspricht.
Das Getrieb i greift in ein Winkelrad k, welches bei einem Durchmesser von 0,048 M. 64
Zaͤhne hat, und welches folglich einen Umgang macht, waͤhrend der
Laͤufer ihrer vier zuruͤklegt. Ueber diesem Rade und an einer und
derselben Spindel befindet sich ein 12zaͤhniges Getrieb l von 0,010 Meter im Durchmesser, und ferner ein in 100
Theile getheilter Gradbogen, der gleich wie das Rad k
eine Viertelumdrehung zuruͤklegt, waͤhrend der Laͤufer eine
ganze vollbringt. Das Getrieb l greift in das mit 60
Zaͤhnen versehene Rad n, so daß lezteres also,
waͤhrend das Getrieb ein Mal umlaͤuft, den fuͤnften, und
waͤhrend der Laͤufer ein Mal umlauft, den zwanzigsten Theil eines
Umganges zu Stande bringt. Die Welle oder Spindel dieses Rades n traͤgt einen zweiten, gleichfalls in 100 Theile
getheilten Gradbogen p.
Hieraus ergibt sich, daß auf einen Umgang des ersten Gradbogens vier Umgaͤnge
des Laͤufers kommen: daß der zweite Gradbogen innerhalb derselben Zeit nur
den fuͤnften Theil eines Umganges vollbringt; und daß auf 20 Umgaͤnge
des Laͤufers ein Umgang des zweiten und vier Umgaͤnge des ersten
Gradbogens kommen. Jeder Grad des ersten Gradbogens entspricht also dem
fuͤnfundzwanzigsten Theile eines Umganges des Laͤufers, und jeder Grad
des zweiten Gradbogens dem fuͤnften Theile eines Umganges desselben
Laͤufers.
§. 23. Hienach ist der Gang dieses Zaͤhlapparates leicht zu verstehen.
Wenn naͤmlich die Maschine in Bewegung ist, so dreht sich die Scheibe, und
die bewegliche Feder F entfernt sich, indem sie der
ausgeuͤbten Kraft nachgibt, wobei sie den ganzen Mechanismus des
Zaͤhlapparates mit sich fuͤhrt. Der Laͤufer h entfernt sich von dem Mittelpunkte der Scheibe B, und dreht sich mit um so groͤßerer
Geschwindigkeit, je rascher sich die Scheibe bewegt, und je weiter er sich von dem
Mittelpunkte dieser lezteren entfernt. Seine Bewegung theilt sich an die Gradbogen
mit, und die Zahl der Grade, welche an jedem derselben innerhalb einer bestimmten
Zeit oder innerhalb eines bestimmten durchlaufenen Raumes voruͤbergegangen,
wird offenbar die Zahl der Umgaͤnge, die der Laͤufer machte,
angeben.
§. 24. Um jedoch die Beobachtungen zu erleichtern, muß man
1) den Zaͤhlapparat nach Belieben in Gang sezen oder zum Stillstehen bringen
koͤnnen; und zwar entweder in einem bestimmten Zeitmomente oder an einer
bestimmten Stelle des durchlaufenen Raumes.
2) Muß auf irgend eine bequeme Weise zu erkennen seyn, welche Grade einander am
Anfange und am Ende einer jeden Beobachtung an beiden Gradbogen gegenseitig
entsprachen.
3) Muß man versichert seyn, daß der Laͤufer bei der Befreiung der Federn und bei den
Erschuͤtterungen nicht nach entgegengesezter Richtung umlaͤuft.
4) Muß man eine einfache Regel haben, nach der man aus der Zahl der Umgaͤnge
des Laͤufers mit Leichtigkeit die Quantitaͤt der vollbrachten Arbeit
oder die mittlere Kraft, welche ausgeuͤbt wurde, ableiten kann.
§. 25. Damit der ersten dieser Bedingungen Genuͤge geleistet werde, ist
der ganze Zaͤhlapparat um zwei Zapfen, die von den Verlaͤngerungen der
Schrauben b gebildet werden, beweglich; und außerdem
druͤken auch noch zwei kleine, an dem Stuͤke a,
b befestigte Federn s zu beiden Seiten der
Fassung c, d mit ihren Enden auf zwei kleine Schrauben
q. In Folge der Wirkung dieser Federn und in Folge
seiner eigenen Schwere uͤbt der Zaͤhlapparat stets einen solchen Druk
auf die Scheibe B aus, daß der Laͤufer durch die
hiedurch entstehende Reibung in Thaͤtigkeit gesezt wird. Ein bei t angebrachtes Gesperr faͤllt nach Belieben in
den Haken u ein, wo dann der Zaͤhlapparat
emporgehoben und außer Thaͤtigkeit gebracht ist.
Wenn man nun mit diesem Apparate eine Beobachtung beginnen will, so druͤkt man
auf den langen Arm v des Gesperres, wodurch der
Zaͤhler losgemacht wird, so daß der Laͤufer, indem er mit der Scheibe
in Beruͤhrung kommt, in Bewegung versezt wird. Stuͤnden die Gradbogen
auf Null, so koͤnnte man von diesem Momente an zu zaͤhlen beginnen, um
in dem Momente, wo man den Versuch beendigen will, den Zaͤhler durch einen
Druk auf die Stange x emporzuheben. Da der
Zaͤhler hierauf beinahe alsogleich in Stillstand kommen wuͤrde, so
bekaͤme man auf diese Weise die Zahl der Umgange, welche der Laͤufer
gemacht hat, so ziemlich genau; immer wird aber diese Methode keine
genuͤgende Genauigkeit gewahren, indem die Theile des Zaͤhlapparates
ein gewisses Bewegungsmoment erlangen, und sich folglich selbst dann noch einige
Zeit uͤber fort bewegen werden, wenn der Zaͤhler bereits emporgehoben
ist. Es ist uͤbrigens leicht einen weit hoͤheren Grad von Genauigkeit
zu erzielen.
§. 26. Von dem Apparate, welcher Spuren der Zahl der
Umgaͤnge, welche die Gradbogen vollbrachten,
zuruͤklaͤßt. Ueber den Gradbogen, in einer und derselben
senkrechten Flaͤche mit ihnen und durch deren Achsen gehend, sind zwei Dillen
z, z angebracht, in welche Pinsel, die in
chinesische Tusche oder in eine fette Tinte eingetaucht worden, oder auch kleine
Bleistifte, oder auch metallene Spizen eingesezt sind. Leztere haͤtten in
eine weiche, auf den Gradbogen ausgebreitete Substanz zu zeichnen. Diese Pinsel oder
Zeichenstifte sind an dem Ende kleiner Staͤbchen, welche sich um Achsen, die
mit den Gradbogen parallel laufen, drehen, und welche an dem anderen Ende durch ein kleines
Band b' miteinander verbunden sind, befestigt. Dieses
Band selbst bildet mit der langen Stange x, die sich um
eine mit dem Gradbogen parallel laufende Achse dreht, ein Gefuͤge. Es erhellt
daher, daß, wenn man diese Stange x um ihre Achse
bewegt, sie die Staͤbchen und die Dillen z, z mit
sich fuͤhrt; und daß die Pinselenden dann kleine Kreisbogen beschreiben,
welche sich in einer Flaͤche, die senkrecht gegen die Flaͤche der
Gradbogen gestellt und durch deren Mittelpunkt gelegt ist, befinden. Da die Dillen
mit Schraubengewinden versehen sind, so ist es ein Leichtes sie so zu adjustiren,
daß die Spize der Pinsel die Gradbogen an dem tiefsten Punkte des Bogens, den diese
beschreiben, beruͤhren; und daß, wenn dieser Punkt voruͤbergegangen
ist, diese Beruͤhrung wieder aufhoͤrt.
Dieser kleine Apparat sezt demnach den Beobachter in Stand genau in dem Augenblik, in
welchem die Beobachtung beginnen oder aufhoͤren soll, auf dem Gradbogen die
entsprechenden Punkte, welche sich in einer und derselben Meridianflaͤche
befanden, zu bezeichnen; und daraus folglich die Zahl der Eintheilungen oder Grade,
welche sich zwischen diesen Stellungen befinden, so wie auch die Zahl der
Umgaͤnge des Laͤufers abzuleiten.
Zu noch groͤßerer Genauigkeit der Resultate duͤrfte es gut seyn, den
Zaͤhler, nachdem man ihn frei gemacht, vor der Anstellung der Beobachtung
einen Augenblik laufen zu lassen. Die Bestimmung der Umgaͤnge des
Laͤufers wird hiedurch nicht im Geringsten beeintraͤchtigt, indem
diese durch die von den Pinseln bewirkten Spuren angedeutet werden.
Man kann die Pinsel waͤhrend eines und desselben Versuches leicht zu
wiederholten Malen auf die Gradbogen zeichnen lassen, indem es, da sich die Spuren
immer in einer und derselben Flaͤche entsprechen und der Linie der
Mittelpunkte folgen, leicht ist, sie in diese Stellung
zuruͤkzufuͤhren, und die Zahl der zwischen jeder der entsprechenden
Spuren begriffenen Eintheilungen zu bestimmen.
§. 27. Wenn die Feder, sobald sie nachlaͤßt, die Stellung, in der der
Laͤufer dem Mittelpunkte der Platte entspricht, uͤberschreiten
koͤnnte, so wuͤrde sich der Laͤufer, so wie auch der
Zaͤhler nach entgegengesezter Richtung umdrehen, woraus nothwendig bedeutende
Stoͤrungen im Gange des Apparates erwachsen muͤßten. Dieß laͤßt
sich leicht vermeiden, wenn man zwischen den beiden Gehaͤusen oder Klemmen
A, D einen Aufhaͤlter anbringt, welcher
dieselben hindert sich einander uͤber die Graͤnze hinaus, fuͤr
die der Apparat adjustirt ist, zu naͤhern. Kommen Momente vor, in denen die
Triebkraft nicht wirkt,
so bleibt der Zaͤhlapparat ganz einfach stehen, wo er dann hiedurch von der
Unterbrechung der Thaͤtigkeit der Triebkraft Rechenschaft gibt.
§. 28. Von der Theorie des Zaͤhlapparates.
Um die hier gegebene Beschreibung zu vervollstaͤndigen, habe ich nur mehr
anzugeben, wie sich aus der Zahl der Umgaͤnge des Laͤufers mit
Leichtigkeit die Quantitaͤt der Arbeit, die von der Triebkraft entweder
innerhalb einer bestimmten Zeit oder innerhalb einer bekannten Streke Weges
vollbracht wurde, ableiten laͤßt. Es fuͤhrt mich dieß zur Entwikelung
der Theorie dieses Apparates, und zwar namentlich in seiner Anwendung auf die Wagen.
Es sey:
r die in Meter ausgedruͤkte Entfernung des
Laͤufers von der Achse der Scheibe unter der in Kilogrammen
ausgedruͤkten Zugkraft F.
ρ der Radius oder Halbmesser des
Laͤufers.
e der in einer Minute von dem Wagen oder dem sonstigen
beweglichen Koͤrper in der Richtung des Zuges durchlaufene Raum.
R der Radius oder Halbmesser des Wagenrades.
n die Zahl der dem Wege c
entsprechenden Umlaͤufe des Rades, wonach
n = e/2πR.
K das Verhaͤltniß der Biegungen, welche von dem
Ruhepunkte oder r = o aus
bis zur Kraft F gemessen wurden, wonach
K = F/r.
N die Zahl der Umgaͤnge des Laͤufers auf
dem Wege e.
R' der Halbmesser der Nabe des Rades oder der Welle, von
der die Scheibe ihre Bewegung mitgetheilt erhaͤlt.
r' der Halbmesser der Rolle der Scheibe.
Die Scheibe macht offenbar waͤhrend eines Umganges des Rades oder der Welle
R'/r' Umgaͤnge;
oder auf den in der Richtung der Zugkraft durchlaufenen Raum e kommen e/2πR .
R'/r' Umgaͤnge.
Der Laͤufer macht auf jeden Umgang der Scheibe r/ρ Umlaͤufe; wonach sich also
fuͤr die dem Wege e unter der Zugkraft F entsprechende Zahl der Umgaͤnge des
Laͤufers ergibt:
Textabbildung Bd. 65, S. 277
Es ist aber:
K = F/r; wonach r = F/K;
folglich
Textabbildung Bd. 65, S. 278
mithin
Textabbildung Bd. 65, S. 278
Da nun der Factor
Textabbildung Bd. 65, S. 278
nur aus constanten Quantitaͤten, welche von den
fuͤr die Halbmesser angenommenen Verhaͤltnissen und von der
Elasticitaͤt der Feder abhaͤngen, besteht, so folgt, daß die Zahl N der Umgaͤnge, welche der Laͤufer
zuruͤklegt, waͤhrend der Koͤrper die Streke e durchlaufen hat, in einem constanten
Verhaͤltnisse zu der vollbrachten Arbeit steht; und daß, wenn ein Mal dieser
Factor bekannt ist und fuͤr einen Dynamometer und den Wagen, an dem dieser
angebracht wird, berechnet worden ist, man nichts weiter braucht, als ihn mit der
Zahl N der Umgaͤnge des Laͤufers zu
multipliciren, um daraus die von der Triebkraft entwikelte Arbeit abzuleiten.
Da der von mir beschriebene Zaͤhlapparat gestattet, daß man mit
groͤßter Leichtigkeit und zu wiederholten Malen fuͤr verschiedene
Wegstreken und Zeitraͤume die Zahl der Umgaͤnge des Laͤufers
beobachten kann, so erhellt, daß ich fuͤr jeden Apparat nur den Werth des
Factors
Textabbildung Bd. 65, S. 278
anzugeben brauche, damit man auf den ersten Blik und ohne daß
man mehr als eine einfache Multiplication vorzunehmen brauchte, die gesuchte
Quantitaͤt der Arbeit auffinden kann.
Da der durchlaufene Raum bekannt ist, so erhaͤlt man, wenn man die gefundene
Quantitaͤt der Arbeit durch diesen theilt, offenbar die mittlere von der
Triebkraft ausgeuͤbte Kraft. Und hat man vollends zugleich auch noch die Zeit
beobachtet, so erhaͤlt man auch die Quantitaͤt der Arbeit fuͤr
eine jede bestimmte Zeit. Da jedoch dieß nur in Hinsicht auf die Erprobung der Kraft
der Pferde von Wichtigkeit ist, so will ich mich nicht laͤnger dabei
aufhalten.
§. 29. Ich will die eben aufgestellte Theorie auf einen Dynamometer von der
Kraft von 400 Kilogr. anwenden, welcher einer Zugkraft von 300 Kilogr. ausgesezt,
und zu Versuchen uͤber den Widerstand, den die Straßen dem Fortrollen der
Wagen entgegensezen, bestimmt ist.
Es sey R' oder der Halbmesser der Nabe oder der Welle,
von der die Bewegung der Scheibe abgeleitet wird, = 0,06 Meter, r' = 0,20 M., ρ =
0,025 M., R = 0,80 M., K =
1/0,00015 = 6667, was einer Zunahme der Biegung um 0,00015 Meter bei jeder
Vermehrung der Spannung der Feder oder des Kraftaufwandes um ein Kilogramm
entspricht. So ergibt sich:
Textabbildung Bd. 65, S. 279
Die mittlere Kraft der Pferde zu 300 Kilogr. und den durchlaufenen Raum zu 100 Meter
angenommen, ergibt sich fuͤr die Zahl der Umgaͤnge des
Laͤufers: N = 10,74 Umgaͤngen.
Waͤhrend nun der Laͤufer diese 10,74 Umgaͤnge vollbringt, wird
der erste Gradbogen 10,74/4 = 2,685 Umgaͤnge, und der zweite 0,537
Umgaͤnge zuruͤklegen; so daß folglich ein ganzer Umgang dieses
Gradbogens 10,74/0,537 Mal 100 Metern einer unter einer mittleren Kraft von 300
Kilogr. zuruͤkgelegten Streke oder 186,2 Meter entsprechen wird; was
fuͤr den Zwek, zu dem der Apparat bestimmt ist, mehr als genuͤgend
erscheint. Da uͤberdieß nicht die geringste Verwirrung zu befuͤrchten
ist, wenn man den zweiten Gradbogen zwei und selbst drei Umgaͤnge machen
laͤßt, so ergibt sich hieraus, daß man sehr leicht auch die auf einer Streke
von 372 oder 558 Meter entwikelte Arbeit mit Huͤlse des Apparates auffinden
kann.
Man sieht außerdem wohl ein, daß, wenn man wuͤnschte, daß der
Zaͤhlapparat die auf einer Streke 1000 und 2000 Meter geleistete Arbeit
andeute, derselbe mit großer Leichtigkeit und ohne Beeintraͤchtigung der
Genauigkeit dem gemaͤß verfertigt werden koͤnnte; denn es brauchte
hiezu lediglich einer leichten Modification des Raͤderwertes.
Wenn man im Allgemeinen N' als die Zahl der
Umgaͤnge des ersten Gradbogens waͤhrend eines Umganges des
Laͤufers, und N'' als die Zahl der
Umgaͤnge des zweiten Gradbogens waͤhrend derselben Zeit annimmt, so
erhaͤlt man hier:
N' = 1/4 N
N'' = 1/5 N' = 1/20 N,
und also im vorhergehenden Beispiele
N' = 2,685.
Behaͤlt man bei, daß
Fe = 300 Kil. × 100 Met.
= 30000 Kilm., und N = 10,74,
so entsprechen 2,685 Umgaͤnge des ersten Gradbogens
einer Quantitaͤt Arbeit, welche 30000 Kilom. gleichkommt; oder ein Umgang des Gradbogens entspricht
einer Quantitaͤt, welche 1117/400 = 27,93 Kilom. gleichkommt.
In dem hier angenommenen Falle betraͤgt also die Totalarbeit innerhalb des
Raumes von 100 Meter:
27,93/30000 = beinahe 1/1075.
Da der beim Ablesen der Grade moͤgliche Irrthum constant bleibt, so wird dieß
Resultat der Wahrheit um so naͤher kommen, je laͤnger die Streke, auf
welcher beobachtet wurde, ist. Eben so erhellt, daß, wenn die von der Triebkraft
ausgeuͤbte Kraft 300 Kilogr. bleibt, die vollbrachte Arbeit fuͤr 200
Meter durchlaufenen Raumes 1/2150, fuͤr 50 Meter 1/537 und fuͤr 25
Meter 1/268 seyn wird.
Dieser Grad von Genauigkeit ist gewiß genuͤgend und selbst groͤßer, als
man ihn bei allen Versuchen, die man uͤber die Zugkraft am zustellen haben
mag, auch nur wuͤnschen kann.
§. 30. Derselbe Zaͤhlapparat kann, wenn man ihn auf Dynamometer von
verschiedenen Kraͤften, die sich in den Gehaͤusen (§. 6)
adjustiren lassen, anwendet, sowohl fuͤr große als fuͤr kleine
Kraftaufwaͤnde dienen. Wenn man sich z.B. eines Dynamometers von 200 Kilogr.
(§. 7) bediente, der im mittleren Durchschnitte einer Kraft von 150 Kilogr.
ausgesezt wuͤrde, so wuͤrde der Grad der Approximation derselbe
bleiben, indem einerseits die Empfindlichkeit der Feder oder deren Biegungen bei
gleicher Kraftanwendung doppelt so groß sind, als jene der vorhergehenden Feder,
waͤhrend andererseits der mittlere Kraftaufwand um die Haͤlfte
geringer anzunehmen ist.
§. 31. Fuͤr was immer fuͤr einen Dynamometer der
Zaͤhlapparat eingerichtet seyn mag, so wird sich der Factor, womit man die
Grade des Gradbogens zu multipliciren hat, um die auf dem durchlaufenen
Raͤume entwikelte Totalarbeit zu erhalten, immer leicht bestimmen lassen. In
dem vorhergehenden Beispiele war diese Zahl 111,73 Kilomet.
Ich werde saͤmmtliche Apparate, die ich verfertigen lassen will, nach directen
Versuchen tariren lassen; der constant bleibende und fuͤr jeden derselben
einzeln zu bestimmende Factor wird auf einen in die Augen fallenden Theil des
Instrumentes gravirt werden. Wollte man das Instrument jedoch verificiren oder, an
einem anderen Wagen, oder an einer anderen Maschine als jene, fuͤr die es
tarirt worden ist, anwenden, so kann dieß mit groͤßter Leichtigkeit
geschehen. Es braucht
naͤmlich nichts weiter, als daß man das Vordergestell des Wagens mit einem
Boke aufhebt; daß man auf den Dynamometer mittelst Gewichten und einer
Fuͤhrrolle eine bekannte Kraft ausuͤbt; daß man dann die Zahl der
Grade, um welche sich der Gradbogen innerhalb eines Umganges des Rades dreht,
zaͤhlt, und zur Erzielung sicherer Resultate die Beobachtungen wiederholt,
und daß man endlich dieses Gewicht oder die ausgeuͤbte Kraft mit jener Zahl
der Meter multiplicirt, welche der Zahl der von dem Rade durchlaufenen Umfange
entspricht. Man erhaͤlt auf diese Weise die der Zahl der beobachteten Grade
entsprechende Arbeit, und theilt man diese durch die Zahl der Grade, so ergibt sich
der dem fraglichen Wagen zukommende constante Factor oder jene Zahl, womit man die
beobachteten Grade zu multipliciren hat, um die vollbrachte Arbeit zu erfahren.
Hieraus folgt, daß ein fuͤr einen bestimmten Wagen verfertigter Apparat auch
an allen anderen Wagen angewendet werden kann.
§. 32. Ich glaube, daß der Apparat, den ich hiemit zur Beurtheilung unterlege,
der von der Gesellschaft gesezten Aufgabe, naͤmlich: Bestimmung der Totalsumme der innerhalb einer bestimmten Wegstreke vollbrachten
Arbeit, Genuͤge leistet. Da man mit der Beobachtung des
durchlaufenen Raumes fuͤglich auch jene der abgelaufenen Zeit verbinden kann,
so wird man auch die innerhalb einer bestimmten Zeit geleistete Arbeit zu finden im
Stande seyn.
Der Zaͤhlapparat laͤßt sich in einer Kapsel verwahren und gegen alle
Unbilden der Witterung schuͤzen.
Das Instrument ist auf alle Arten von Wagen, Pfluͤgen, Karren, Schlitten,
Schiffe etc. anwendbar. Auch ist es ganz vorzuͤglich zur Bestimmung des
wirklichen Werthes der Zugpferde geeignet; denn es gibt die Quantitaͤt der
Arbeit an, die sie auf einer beliebigen Streke geleistet haben. Da man es mittelst
einer Gabel, einer Waage oder eines Ortscheites an einem Wagen anbringen kann, so
kann man mit ihm ohne alle Stoͤrung einen oder mehrere Tage lang reisen; und
wenn man hiebei von Zeit zu Zeit in Wegstreken von 200 bis zu 500 Meter zu
verschiedenen Zeiten des Tages die Quantitaͤt der von den angespannten
Thieren entwikelten Arbeit beobachtet, so wird man erfahren, welche von ihnen am
besten aushalten und innerhalb eines Tages den regelmaͤßigsten und
betraͤchtlichsten Nuzeffect, in welchem eigentlich der wirkliche Werth der
Zugpferde gelegen ist, geben.
Der Zaͤhlapparat erhoͤht den Preis des Dynamometers hoͤchstens
um 100 Fr., so daß die ganze Vorrichtung zusammen auf 350 Fr. zu stehen kommt. Sie wurde in
dem Artilleriearsenale in Metz in Gegenwart vieler Zeugen erprobt, und hat hiebei
nicht nur vollkommen ihrem Zweke entsprochen, sondern auch die Sanction der Theorie
und der Erfahrung erhalten.
Tafeln