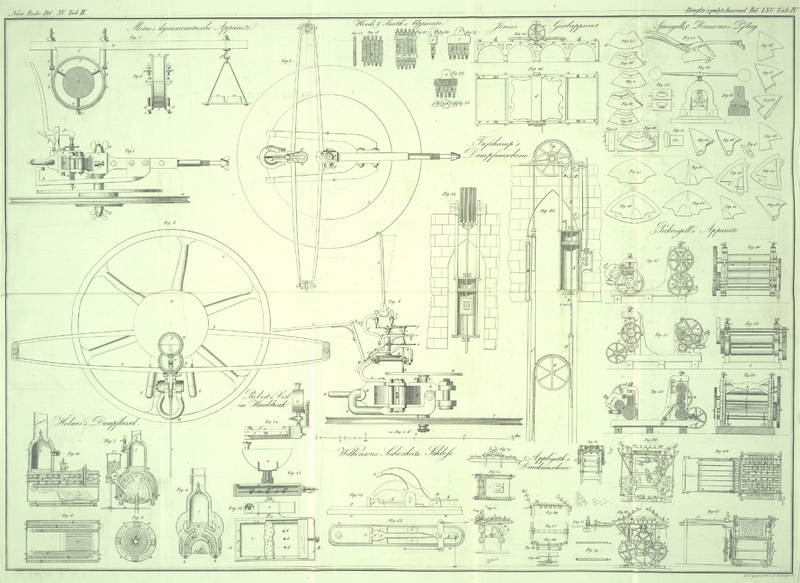| Titel: | Verbesserungen im Handdruke, worauf sich John Roberts, Calicodruker von Prestolle in der Grafschaft Lancaster, am 27. Junius 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. LXVIII., S. 309 |
| Download: | XML |
LXVIII.
Verbesserungen im Handdruke, worauf sich
John Roberts,
Calicodruker von Prestolle in der Grafschaft Lancaster, am 27. Junius 1836 ein Patent ertheilen
ließ.
Aus dem London Journal of Arts. April 1837, S.
1.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Roberts's Verbesserungen im Handdruke.
Die Erfindung des Patenttraͤgers betrifft eine eigenthuͤmliche oder
neue Einrichtung des Druksiebes und dessen elastischer Grundlage. Dieses Sieb (cloth or sieve), welches mit oder ohne der elastischen
Unterlage benuzt werden kann, bildet die Oberflaͤche, auf der man die Farbe
zum Behufe ihrer Uebertragung auf die Form, mit der das Muster gedrukt wird,
ausbreitet. Der Rahmen, in den die Raͤnder des Siebes eingelassen sind, ist
so gebaut, daß man dem Siebe leicht jeden Grad von Spannung geben kann, welcher der
Beschaffenheit der verschiedenen, zum Druke verwendeten Farben entspricht; und daß
man also die Spannung dem zu drukenden Muster anpassen kann, d.h. daß der
Oberflaͤche der Form je nach dem Charakter des Musters eine groͤßere
oder geringere Menge Farbstoff dargeboten wird. Der ganze Apparat ist ferner so
eingerichtet, daß die sogenannten Streichknaben, die sonst jedem Druker zum Behufe
des Ausbreitens der Farbe nach geschehener Eintauchung der Form beigegeben waren,
entbehrlich werden, indem hier jedes Mal dem Siebe so viel Farbstoff zufließt, als
zum Auftragen auf die Form noͤthig ist. Die Zeichnung, zu deren Beschreibung
wir nunmehr sogleich uͤbergehen wollen, wird alles dieß anschaulich
machen.
Fig. 12 ist
ein Grundriß oder eine horizontale Ansicht des Farbtroges (springing tub), woraus man denselben von Oben betrachtet ersieht: ein
Theil des Siebes ist weggenommen, damit das Innere anschaulich werde. Fig. 13 ist
ein Aufriß, welcher zum Theil nach der in Fig. 12 angedeuteten
Linie A, B genommen ist. Fig. 14 endlich ist ein
Endaufriß des rechten Endes von Fig. 12. a, a ist ein aus Blech, Zinn oder einem anderen
Materiale bestehender Behaͤlter, der zur Aufnahme des zum Druke zu
verwendenden Farbstoffes bestimmt ist. Lezterer fließt durch die Roͤhre b, b und den Hahn c in die
Canaͤle d, d, d, welche in dem unterhalb
befindlichen hoͤlzernen Gehaͤuse angebracht sind, und die
saͤmmtlich mit einander in Verbindung stehen. Diese in ein massives
Stuͤk Holz gebohrten Canaͤle d, d dienen,
um die untere Oberflaͤche des Siebes e, e durch
die Unterlage f hindurch mit Farbstoff zu speisen. Die
Unterlage f dient als Traͤger oder als
Stuͤzpunkt fuͤr das Sieb, und ist mit kleinen Loͤchern
ausgestattet, damit der Farbstoff frei an die untere Oberflaͤche des Siebes
gelangen kann. Die Zahl und Groͤße dieser Loͤcher, wovon die Speisung
des Siebes mit Farbstoff abhaͤngt, muß bei verschiedenen Mustern verschieden
seyn. Man sieht aus der Zeichnung, daß drei der Seiten des Siebes in dem Rahmen oder
Holzwerke g, g, g festgehalten werden; daß die vierte
Seite hingegen an der Latte h befestigt ist, welche
durch einen eisernen Stab, der die Mutter der Schraube i,
i zu tragen hat, verstaͤrkt ist. In dieser Latte h befinden sich zwei kleine Endvorspruͤnge, die
zu beiden Seiten des eisernen Rahmens j in Falzen oder
Fenstern laufen. Durch Umdrehen der kleinen Schraube i
wird nun die Latte h in den Rahmen j gestellt oder adjustirt, und dadurch wird die Spannung
des Siebes in gehoͤrigem Grade regulirt. Der Grad, den diese Spannung haben
soll, kann uͤbrigens, wie sich von selbst versteht, nur durch die Erfahrung
erlernt werden. Auch versteht sich, daß das Sieb, welches in Fig. 12 als gebrochen
dargestellt ist, ganz und mit seinem aͤußeren Ende in der beweglichen Latte
h, h festgemacht seyn muß. Dagegen muß die
Scheidewand oder die durchloͤcherte Unterlage rings herum an dem Rahmen des
ganzen Apparates befestigt seyn.
Damit die Farbe nach jedem Eintauchen der Form gleichmaͤßig an das Sieb
gelange und darauf ausgebreitet werde, soll die Unterlage f,
f aus einem wasserdichten Materiale bestehen, damit der Farbstoff nur durch
die Loͤcher allein gehen kann. Das Sieb selbst ist je nach der
Verschiedenheit der Muster abzuaͤndern; so fand der Patenttraͤger
fuͤr gut es in gewissen Faͤllen doppelt und mehrfach zu nehmen, und
bald einen Baumwoll- und Wollen- oder einen Leinen- und
Baumwollzeug oder auch einen anderen Stoff dazu zu waͤhlen.
Aus einem Blike auf die Zeichnung erhellt, daß man den Zufluß des Farbstoffes
reguliren kann, je nachdem man den Hahn c mehr oder
minder weit oder ganz oͤffnet, und je nachdem man den Farbstoff in dem
Farbbehaͤlter hoͤher oder niedriger stehen laͤßt. In lezterer
Hinsicht kann man mittelst der Stellschraube k, k,
welche sich am Ruͤken des Rahmens befindet, beliebig nachhelfen.
Die Fuͤllung des Farbbehaͤlters hat bei einem Trichter l, der sich an dem Scheitel desselben befindet, und der,
waͤhrend man sich des Apparates bedient, mit einem Pfropfe verschlossen
werden muß, zu geschehen. Alle abfließende Farbe kann bei der Oeffnung m, die mit den Canaͤlen d,
d communicirt, und die mithin, waͤhrend man sich des Apparates
bedient, gleichfalls verstopft werden muß, entleert werden.
Tafeln