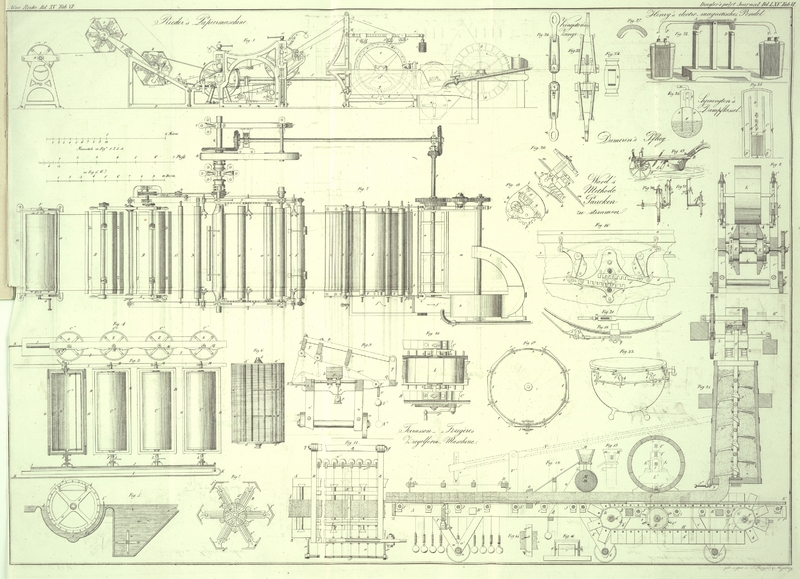| Titel: | Beschreibung einer Maschine zum Erzeugen, Troknen und Appretiren des Papieres, welche von Hrn. Amédée Rieder verbessert wurde, und in der Buntpapierfabrik der HH. J. Zuber und Comp. in Mülhausen angewandt wird. |
| Fundstelle: | Band 65, Jahrgang 1837, Nr. XCII., S. 417 |
| Download: | XML |
XCII.
Beschreibung einer Maschine zum Erzeugen, Troknen
und Appretiren des Papieres, welche von Hrn. Amédée Rieder verbessert wurde,
und in der Buntpapierfabrik der HH. J.
Zuber und Comp. in Muͤlhausen angewandt wird.
Aus dem Bulletin de la Société
d'encouragement. Julius 1837, S. 241.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Rieder's verbesserte Maschine zum Erzeugen, Troknen und Appretiren
des Papieres.
Die Société d'encouragement ertheilte den
HH. J. Zuber und Comp. im
Jahre 1832 eine goldene Medaille fuͤr die ausgezeichneten Verbesserungen, die
sie in der Fabrication der Tapetenpapiere vorgenommen haben. Unter diesen
Verbesserungen hob sie besonders die sinnreiche Maschine hervor, mit der jene
Fabrikanten Papierrollen von 9 Meter Laͤnge, und von vollkommener Gleichheit
in Hinsicht auf Dike und Breite aus einem Stuͤke verfertigen. Auch die Jury,
welche uͤber die im Jahre 1834 in Paris abgehaltene Industrieausstellung
abzuurtheilen haͤtte, und welche den HH. Zuber die große goldene Medaille ertheilte,
lenkte die Aufmerksamkeit der Fabrikanten auf diese Maschine, deren Hauptverdienst
darin besteht, daß sie
anstatt der Rollen, welche man fruͤher durch Zusammensezung mehrerer
Blaͤtter erzielte, endloses Papier liefert.
Diese Maschine, welche urspruͤnglich von Ferdinand Leistenschneider von Poncey, der im Jahre 1813 ein Patent auf die
Fabrication von Papier in Blaͤttern nahm, erfunden ward, erlitt in der Fabrik
der HH. Zuber eine
gaͤnzliche Umwandlung. Sie ward schon im Jahre 1830 von Hrn.
Amédée Rieder zur Fabrication von endlosem
Papier eingerichtet, und seither auf mannichfache Weise verbessert; namentlich
stattete er dieselbe mit einem von ihm erfundenen Trokenapparate aus, und eben so
verbesserte er das ganze System in einem solchen Grade, daß die Maschine nicht nur
vortreffliche Tapetenpapiere, sondern auch jede andere Art Papier, vom
duͤnnsten bis zum staͤrksten, fuͤr die Kupferstecher bestimmten
Papiere liefert. Auf diese verbesserte Maschine erhielten die HH. Zuber am 30. Septbr. 1830 ein Patent
fuͤr 15 Jahre; die HH. André Koͤchlin und Comp. in Muͤlhausen, welche ausschließlich
bevollmaͤchtigt sind sie zu verfertigen, liefern sie von groͤßter
Vollkommenheit, und haben schon von mehreren Laͤndern her Auftrage
erhalten.
Fig. 1 zeigt
die Maschine in einem Laͤngenaufrisse.
Fig. 2 ist ein
Grundriß.
Fig. 3 zeigt
eine Reihe von vier hohlen, kupfernen Cylindern, in welche Dampf eingelassen wird,
und die zum Troknen des Papieres, welches sich beim Austritte aus der Maschine um
dieselben rollt, dienen. Einer der Cylinder ist in einem senkrechten Durchschnitte
dargestellt. Der ganze Trokenapparat besteht gewoͤhnlich aus 16 bis 18
solcher Cylinder.
Fig. 4 gibt
eine Ansicht dieser Cylinder vom Ende her.
Fig. 5 zeigt
einen senkrechten Laͤngendurchschnitt des Formcylinders, des Troges, in dem
er untergetaucht ist, und eines Theiles der Zeugbuͤtte, worin ein Agitator
und eine zur Reinigung dienende Vorrichtung enthalten ist.
Fig. 6 stellt
den Formcylinder im Grundrisse und von seinem Drahtgewebe entbloͤßt dar.
Fig. 7 zeigt
einen der Aufrollcylinder im Aufrisse.
An saͤmmtlichen Figuren beziehen sich gleiche Buchstaben auf gleiche
Gegenstaͤnde.
Das gußeiserne Gestell a, a traͤgt den
Formcylinder, den kupfernen Trog desselben, und mehrere Walzen, die zur Leitung des
endlosen Filzes dienen. Der aus gewalztem Kupferbleche bestehende Trog b ist an der einen Seite mit einer Scheidewand oder mit
einem doppelten Boden b', Fig. 5, unter den der mit
Wasser angeruͤhrte Papierzeug gelangt, versehen. In den gleichfalls aus
Kupfer verfertigten Trog
c wird fuͤr gewisse Papiersorten klares
Wasser geleitet, welches der ganzen Breite nach und vor dem Formcylinder in den Trog
b uͤberlaͤuft.
Der messingene, mit Metallsieb uͤberzogene Formcylinder d, auf dem das Papier erzeugt wird, besteht aus zwei Kreuzen, welche durch
26 Querstuͤke mit einander verbunden sind. Leztere tragen in Entfernungen von
2 Centimetern von einander kupferne Reifen, auf denen das Metallsieb, welches durch
eine Nach muffartig verbunden ist, ruht. Um das Sieb anzusteken, nimmt man das
Segment d' des Cylinders, welches sich in einem Falze
bewegt, ab, schiebt das Sieb auf den Cylinder, und spannt es, indem man das
erwaͤhnte Segment wieder an Ort und Stelle bringt, und mit Schrauben
befestigt.
Die Breite, welche das zu verfertigende Papier bekommen soll, wird durch zwei sehr
duͤnne, messingene Baͤnder, welche uͤber die Raͤnder des
Metallsiebes gespannt werden, und deren Enden zusammengeloͤthet sind,
bestimmt. Da sich auf keiner Stelle des Siebes, die sein Wasser durchlaͤßt,
Papier bilden kann, so ist es ein Leichtes, Papier von jeder beliebigen Breite, und
selbst Papier in Streifen und Bogen zu erzeugen; denn man braucht zu diesem Behufe
nur metallene Querstreifen oder gar nur leinene, dicht gewirkte Baͤnder auf
dem Formcylinder zu befestigen.
Der Formcylinder ist an der einen Seite mit der aus Kupferblech bestehenden Platte
e geschlossen; an der anderen offenen Seite dagegen
communicirt er mittelst einer sogenannten hydraulischen Buͤchse (boîte hydraulique) mit einem hoͤlzernen
Bottiche f, in den das im Inneren des Formcylinders
enthaltene Wasser durch die Oeffnung q abfließt. Der
Hahn g laͤßt das uͤberschuͤssige an
dem Formcylinder ausgetretene Wasser abfließen. Das Schuzbrett h dient zum Abfluͤsse jenes Wassers, welches,
nachdem es aus dem Formcylinder entwichen ist, unter das Rad k gelangt.
Die Roͤhre i leitet den Zeug in die Buͤtte
f', wobei dessen Zufluß durch den Hahn j regulirt wird. Das Rad k
dient zum Heben und Abschlagen des Zeuges, der von diesem Rade weg mit Wasser
vermengt in dem Canale l in die große hoͤlzerne,
mit Blei ausgefuͤtterte Buͤtte m gelangt.
In dieser befindet sich die zur Reinigung dienende Vorrichtung und auch der Agitator
n, der 40 Umgaͤnge in der Minute macht. Der
Reinigungsapparat, Epurator genannt, ist in dem Grundrisse nicht abgebildet.
Die kupferne Roͤhre o ist mit einer Reihe kleiner
Loͤcher versehen, durch welche Wasser auf das Sieb faͤllt, damit
dieses auf solche Weise gereinigt und gewaschen wird.
o' ist eine kleine kupferne Rinne, in welcher der
Ueberschuß aus dem Troge b in den Bottich f abfließt.
Der Hahn p liefert rings um die hydraulische
Buͤchse, in welcher der Formcylinder mit seinem offenen Ende umlaͤuft,
einen kleinen Wasserstrom. Dagegen ist g eine in den
Trog b geschnittene Oeffnung, welche die Communication
zwischen dem Inneren des Formcylinders und dem Bottiche f herstellt.
Die Hebel r, r, laͤngs denen sich die
Zapfenbaͤnder der drei hoͤlzernen Walzen 1, 2 und 7, welche den
endlosen Filz auf seinem Laufe leiten, schieben lassen, haben den Mittelpunkt ihrer
Bewegung in r'. Die Walze 1, der sogenannte Deker (coucheur) ist mehrmals mit Filz umwunden, damit er einen
elastischen Druk auf den Formcylinder d ausuͤben
kann. An dem Ende der Hebel s, s sind Gewichte
ausgehaͤngt, womit die Walze 1 auf den Formcylinder herabgedruͤkt
wird.
Der von den Walzen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 geleitete Filz laͤuft in der durch
Pfeile angedeuteten Richtung, und theilt dem Formcylinder die rotirende Bewegung
mit. Die Walze 4, welche an einem Traͤger mit Laͤufer aufgezogen ist,
und welche mittelst der Schraube t' herabgesenkt werden
kann, dient zur Spannung des Filzes.
Die erste, aus zwei Cylindern bestehende Presse u, u
fuͤhrt den Filz und empfaͤngt das von dem Formcylinder
herbeigelangende Papier, um es an einen zweiten Filz zu uͤbertragen. v, v ist eine zweite, gleichfalls aus zwei Cylindern
bestehende Presse. Die oberen Cylinder beider Pressen sind mit den Rakeln v, v versehen. Die Schrauben x,
x dienen dazu, die Cylinder beider Pressen einander mehr oder minder nahe
zu bringen.
Das gußeiserne Gestell y, y traͤgt die beiden
Pressen, die Cylinder, welche den zweiten Filz leiten, und die Aufrollcylinder. Der
endlose Filz z, z, welcher diker ist, als der Filz t, und der das Papier unter die zweite Presse
fuͤhrt, wird von den hoͤlzernen Walzen 8, 9, 10, 11 und 12 geleitet,
und bewegt sich in der durch Pfeile angedeuteten Richtung. Die Walze 11 ist
gleichfalls auf einem Traͤger mit Laͤufer, der zum Spannen des Filzes
z dient, aufgezogen.
Die beiden Schwaͤngel A, A, welche die beiden
Aufrollcylinder B, B tragen, schwingen sich um den
Zapfen a'.
C ist ein aus gewalztem Kupferbleche bestehender, in dem
Gestelle D aufgezogener Appretir- und
Trokencylinder, der das von dem Aufrollcylinder B
hergelangende Papier aufnimmt. C', C' in Fig. 3 sind zwei
Appretir- und Trokencylinder, welche an der Dampfroͤhre angebracht und
mit Papier beladen sind. C'' ist ein unbedekter
Cylinder, an welchem der Zuflußhahn fuͤr den Dampf geschlossen ist. C''' zeigt einen solchen Cylinder im Durchschnitte. Als
Grund oder Boden
fuͤr diese Trokencylinder dienen die gußeisernen Platten E, E, welche durch vier, durch die Cylinder laufende
Bolzen b'b' zusammengehalten werden. Ihre Zapfen sind an
der einen Seite bei F, wo sie an den Hahn adjustirt
sind, kegelfoͤrmig abgedreht, waͤhrend sie an der anderen Seite mit
einem vierekigen Eisen i', an welches die Kurbel G gestekt wird, versehen sind. In diesem Eisen befindet
sich ein kleines Loch, durch welches die in dem Cylinder enthaltene Luft entweichen
kann, so oft man Dampf eintreten, laͤßt.
D ist ein gußeisernes Gestell, auf das man den
Trokencylinder bringt, waͤhrend man das getroknete Papier von ihm abwindet,
und waͤhrend feuchtes Papier auf ihn aufgerollt wird. Die hoͤlzernen
Rahmen H, H, in denen die Cylinder aufgezogen sind,
dienen dazu, leztere, nachdem sie aufgerollt worden, an die Dampfroͤhre zu
tragen. Uebrigens ruht der ganze Trokenapparat in dem hoͤlzernen Gestelle I, welches man aus Fig. 3 und 5 ersieht.
Die Dampfroͤhre J communicirt einerseits mit dem
Kessel und andererseits mit einer kleinen Roͤhre K, welche zur Entleerung des Verdichtungswassers dient.
Die Haͤhne L, L dienen zum Einlassen des Dampfes
in die Trokencylinder; an sie werden die Cylinder mittelst der kegelfoͤrmigen
Adjustirung F gestekt: so zwar, daß sie leicht
abgenommen und in das Aufwindgestell D gebracht werden
koͤnnen.
Die Haken M, M dienen zur Befestigung der Trokencylinder
in dem Gestelle I. Die Kurbel G wird an die vierekigen Zapfen der Trokencylinder gestekt, so oft man
diese in das Gestell D bringt, um das trokene Papier
davon ab- und feuchtes dafuͤr auf sie aufzurollen.
Die beiden Rollen N, N sind dazu bestimmt, die
Aufrollcylinder in Bewegung zu sezen. Die uͤber sie laufende Schnur wird
durch die Rolle O in Spannung erhalten.
P, P sind Spanner fuͤr den mit Leder besezten
Filz der zweiten Presse. Die Welle Q, Q macht 10 bis 12
Umgaͤnge in der Minute. Die Rollen R, R sind zur
Uebertragung der Bewegung von einer Presse an die andere bestimmt. Die
Zwischenwellen S, T, U haben durch Zahnraͤder die
Bewegung auch an den Agitator n und an das Rad
fortzupflanzen. Alle diese Wellen ruhen in den Anwellen V,
V.
An der Achse oder Welle der Aufrollcylinder ist ein Zahnrad c' angebracht, welches in die kleinen Getriebe d'',
d'' eingreift. Leztere sezen die an den Culissenradien befestigten
Zahnstangen e'' in Bewegung. Auf diese Welse wird der
Durchmesser des Cylinders vergroͤßert oder verkleinert, im Falle man auf dem
Cylinder selbst das feuchte Papier in verschiedene Formate zerschneiden will, um es dann
aufhaͤngen und troknen zu koͤnnen.
Der beschwerte Hebel g' druͤkt gegen die Rolle O, womit die Schnur gespannt wird. Der Haken h' endlich dient dazu den Balancier A in seiner Stellung zu erhalten.
Das Spiel des Apparates ist folgendes.
1) Erzeugung des Papieres. Der Zeug gelangt durch die
Roͤhre i aus dem fuͤr ihn bestimmten
Behaͤlter in den Bottich f, in welchem er mit dem
aus dem Inneren des Formcylinders abfließenden klaren Wasser vermengt wird. Von hier
aus treibt ihn das zu seiner Vertheilung und zum Heben desselben bestimmte Rad k durch den Canal l in die
Buͤtte m, um dann an den Epurator, der in der
Zeichnung nicht abgebildet ist, und nachdem er von dem Agitator n umgetrieben worden ist, endlich in den Trog b zu gelangen. Wenn er hierauf durch den doppelten Boden
b' unter den Formcylinder gerathen ist, wie dieß
durch Pfeile angedeutet ist, so dringt das Wasser durch das Metallsieb des
Formcylinders, waͤhrend sich der Zeug, der in dem Wasser geschwebt, auf
dessen Oberflaͤche absezt. Dieses Wasser entweicht durch die Oeffnung q aus dem Inneren des Cylinders, und gelangt aus dem
Bottiche f allmaͤhlich in den Bottich f', wo es neuerdings Papierzeug aufnimmt, um dann
abermals unter den Formcylinder zu gelangen, u.s.f.
Der Formcylinder ist einer rotirenden Bewegung nach der durch die Pfeile angedeuteten
Richtung theilhaftig; er bringt den Papierzeug, der sich auf ihm ablagerte, an den
oberen Theil des Troges b, wo das aus dem Troge c abfließende klare Wasser einen gleichmaͤßigen
und graduirten Druk auf dessen Oberflaͤche ausuͤbt. Dieser Druk, der
durch die Differenz des Niveaus der Fluͤssigkeit innerhalb und außerhalb des
Formcylinders bedingt ist, wie dieß aus dem Durchschnitte in Fig. 5 erhellt, dient zur
Filzung und Glaͤttung des auf dem Formcylinder abgesezten Zeuges, so daß das
Papier bei seinem Austritte aus dem Troge eine solche Consistenz erlangt hat, daß es
mittelst des Filzes, an dem es haͤngen bleibt, von dem Metallsiebe abgenommen
werden kann.
Der endlose Filz t, t wird mittelst der sogenannten
Dekwalze 1 gegen den Formcylinder angedruͤkt, und fuͤhrt das Papier in
die erste Presse u, u, in der es nur einen schwachen
Druk erleidet. Nachdem es diese verlassen, gelangt es auf einem zweiten Filze z, z unter die zweite Presse v,
v, in der das Wasser in so weit aus dem Papiere ausgetrieben wird, daß
dieses fuͤr den Trokenproceß geeignet ist, zu welchem Behufe es in feuchtem
Zustande auf den Cylinder B aufgerollt wird. Die Bildung
des Papieres geht auf eine eben so gleichfoͤrmige, als regelmaͤßige Weise
von Statten, indem sie durch den Druk bedingt ist, den das Wasser des Troges b auf die Oberflaͤche des in diesen
untergetauchten und innen leeren Formcylinders ausuͤbt. Die Dike des Papieres
haͤngt von der groͤßeren oder geringeren Menge Zeuges ab, welche durch
die Roͤhre i herbeigelangt und durch den Hahn j regulirt wird.
2) Troknen und Appretiren des Papieres. Wenn der
Aufrollcylinder B mit dem aus der zweiten Presse
kommenden, feuchten Papiere beladen worden ist, so schaukelt man ihn, damit er vor
das Aufrollgestell D gelange. Wenn dann einer der
Trokencylinder C auf dieses Gestell gebracht worden ist,
so rollt man das Papier in einer gewissen Laͤnge, z.B. je nach seiner Dike in
20 bis 30 Umgaͤngen auf denselben auf, wobei man jenes Ende des Papieres,
welches um den Cylinder geschlungen wird, befeuchtet, damit es an diesem kleben
bleibe und bei dem Trokenprocesse sich nicht davon abloͤse. Der solcher Maßen
mit feuchtem Papiere versehene Trokencylinder wird dann mit einem der Haͤhne
L der Dampfroͤhre J in Verbindung gebracht und durch den Haken M
in seiner Stellung erhalten. Sobald nun zum Behufe der Einleitung des Dampfes in den
Cylinder der Hahn geoͤffnet worden ist, wird sogleich die in ihm enthalten
gewesene Luft durch die kleine in dem vierekigen Zapfen i des Cylinders befindliche Oeffnung ausgetrieben. Dieselbe Oeffnung dient
auch zur Unterhaltung des Dampfzuflusses zum Cylinder, und um eine zur Bewirkung des
Troknens hinreichende Temperatur zu unterhalten. Die zum Troknen noͤthige
Zeit dauert fuͤr jeden Cylinder 30 bis 40 Minuten. Unmittelbare Folge des
Trokenprocesses ist, daß sich das Papier zusammenzieht und eine sehr starke Spannung
erleidet, indem sich dessen inneres Ende nicht losmachen kann. Hieraus erwachst
nothwendig eine Reibung der verschiedenen Papierschichten auf einander; und diese
Reibung in Verbindung mit der eben erwaͤhnten Spannung gibt dem Papiere einen
Appret, den es sonst nur durch wiederholtes Pressen und Walzen erlangt.
Ist das Papier vollkommen troken geworden, so bringt man den Cylinder wieder auf das
Aufrollgestell D, und wikelt es in diesem von dem
Cylinder ab, um wieder feuchtes Papier dafuͤr aufzurollen. Die Zahl der
Trokencylinder hat sich nach der Quantitaͤt Papier, welche die Maschine
erzeugt, zu richten. Der Dienst ist so einzurichten, daß immer nur ein
Trokencylinder auf ein Mal abzuwinden kommt, denn auf diese Weise wird von der
Waͤrme, die die Cylinder waͤhrend der Operation beibehalten, am besten
Nuzen gezogen.
Tafeln