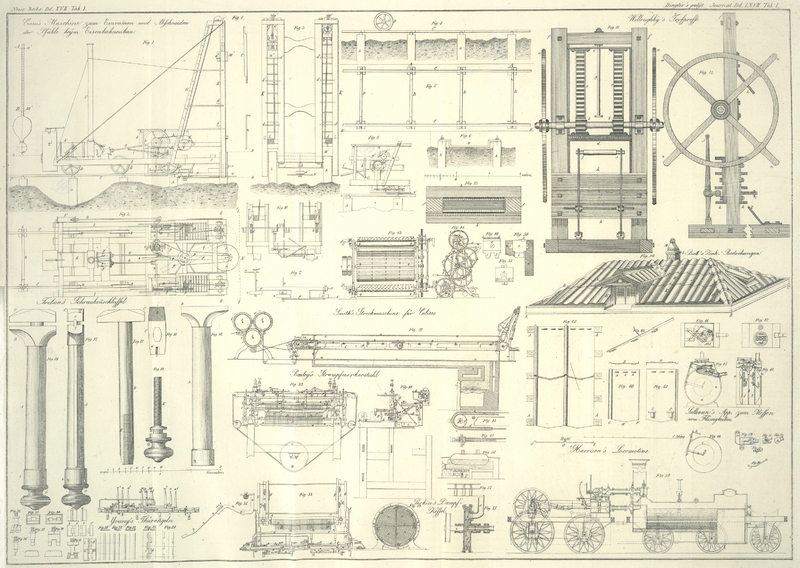| Titel: | Verbesserungen an den Dampfmaschinen, ihren Oefen und Kesseln, worauf sich Jacob Perkins, Civilingenieur in London, am 3. Decbr. 1837 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. I., S. 1 |
| Download: | XML |
I.
Verbesserungen an den Dampfmaschinen, ihren Oefen
und Kesseln, worauf sich Jacob
Perkins, Civilingenieur in London, am 3. Decbr. 1837 ein
Patent ertheilen ließ.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions. Decbr.
1837, S. 268.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Perkin's verbesserte Dampfmaschinen.
Meine Erfindung betrifft: 1) jene Art von rotirender Dampfmaschine, die nach dem
Principe der sogenannten Barker'schen Muͤhle durch
einen ununterbrochenen, aus einem umlaufenden Arme ausstroͤmenden Dampfstrom
in Bewegung gesezt wird. Dieser Theil meiner Erfindung ist auch auf eine
Wassermaschine anwendbar.
Sie betrifft 2) die Einrichtung des Aschenloches der Oefen, gemaͤß welcher bei
dem hinteren Theile der Roststangen eine groͤßere Menge
atmosphaͤrischer Luft Zutritt erhaͤlt, als bei dem vorderen, dem
Ofenthuͤrchen zunaͤchst liegenden Theile, damit sich das auf dem
hinteren Theile des Rostes liegende Brennmaterial in lebhafterer Verbrennung
befinde; und damit also die auf dem vorderen Theile erzeugten Dampfe vollkommener
verbrannt werden, als es moͤglich ist, wenn der Rost durchaus
gleichmaͤßig mit Luft gespeist wird.
Sie bezieht sich 3) auf eine Verbesserung an den Dampfkesseln, die ich in meinem
Patente vom 12. April 1836 beschrieben habe.
Fig. 54 zeigt
eine seitliche Ansicht einer meiner Methode gemaͤß gebauten Dampfmaschine.
Fig. 55
ist ein Querdurchschnitt derselben. Las aͤußere Gehaͤuse oder der
Cylinder a, a enthaͤlt die arbeitenden Theile der
Maschine, welche aus zwei kreisrunden Platten bestehen, in denen die zur Aufnahme
der Achse b der umlaufenden Scheibe c dienenden Anwellen und Stopfbuͤchsen angebracht
sind. Diese Scheibe, welche an die Achse b geschirrt
ist, sezt, indem sie umlaͤuft, diese leztere in Bewegung. Die Roͤhre
d dient als Austrittsroͤhre fuͤr den
Dampf. Bis hieher ist nichts Neues an dieser Maschine, indem schon mehrere
aͤhnliche rotirende Dampfmaschinen in Vorschlag kamen. Meine Verbesserung
liegt in der Anwendung von Stuͤzpunkten, auf die der Dampf nach einander
wirken kann. Um dieselbe klar zu machen, will ich die Wirkungsweise des aus einer
Oeffnung austretenden Dampfes in Kuͤrze erlaͤutern, indem dieses
Princip bisher noch nicht an derlei Maschinen in Anwendung kam. Wenn man einen
Dampfstrahl bei einer Muͤndung austreten laͤßt, so wird man finden, daß, wenn man dieses
Austreten durch eine auf die Muͤndung gelegte Platte vollkommen verhindern
will, ein groͤßerer Druk angewendet werden muß, als jener ist, den der Dampf
aus einen gleichen Flaͤchenraum irgend eines Theiles des Apparates
ausuͤbt; und daß die Kraft, mit welcher der Dampf gegen die
Oberflaͤche wirkt, im Verhaͤltnisse der Entfernung der Platte oder
Oberflaͤche von der Muͤndung, aus welcher der Dampf austritt, abnimmt.
Hieraus ergibt sich, was man bei der Anwendung des Dampfes an rotirenden Maschinen,
an denen der Dampf bei Muͤndungen austrat, an denen er kein anderes Hinderniß
als den Widerstand der Luft oder des in einer Dampfkammer enthaltenen Dampfes fand,
zu thun hat. e, e sind mehrere Dampfwege der Achse, und
f sind Mundstuͤke, deren Dampfwege eine
solche Neigung haben, daß der duͤnne Dampfstrahl gegen die Widerstandspunkte
g trifft. Diese lezteren bestehen aus
Oberflaͤchen, welche nach der aus der Zeichnung ersichtlichen Art geschnitten
oder geformt und solcher Maßen eingesezt sind, daß sie dem Dampfe stets einen
Stuͤzpunkt abgeben, und daß sie so dicht als moͤglich an der Oeffnung,
bei welcher der Dampf austritt, anliegen. Es lassen sich mehrere derlei
Muͤndungsstuͤke anbringen, wo dann die Kraft der Maschine von dem
gegebenen Druke des Dampfes abhaͤngt. Da jeder Sachverstaͤndige nach
dieser Beschreibung die Maschine auszufuͤhren wissen wird, so habe ich nm
noch beizufuͤgen, daß die auf solche Weise der Achse oder Welle mit getheilte
Kraft durch entsprechende Laufbaͤnder und Trommeln oder auch durch
Raͤderwerke zum Maschinenbetriebe oder zum Treiben von Wagen und Schiffen
verwendet werden kann. Anstatt die Scheibe und die Welle umlaufen zu lassen, kann
man uͤbrigens auch diese fixiren und dafuͤr dem aͤußeren
Gehaͤuse die Umlaufsbewegung geben, wenn man an diesem zur weiteren
Fortpflanzung der Bewegung eine entsprechende Trommel und ein Zahnrad anbringt. Es
erhellt endlich, daß man durch eine derlei Maschine anstatt des Dampfes von einem
hoͤher gelegenen Wasserbehaͤlter auch Wasser stroͤmen lassen
kann, damit das Wasser auf Stuͤzpunkte der angegebenen Art wirke, und dadurch
in seiner Wirkung verstaͤrkt werde.
Fig. 56 zeigt
einen Durchschnitt eines Kessels und eines Ofens, welcher dem zweiten Theile meiner
Erfindung gemaͤß eingerichtet ist. Die Roststangen sind mit a, a bezeichnet; b ist das
vordere und c das Hintere Aschenloch. Lezteres ist von
ersterem durch die Scheidewand d getrennt. Ersteres ist
der Luft zugaͤngig, so daß also der uͤber ihm befindliche Theil der
Roststangen wie bisher von dieser aus den noͤthigen Luftzufluß
erhaͤlt. Lezteres hingegen ist geschlossen, und erhaͤlt seinen
Luftzufluß durch ein entsprechendes Geblaͤse, damit das uͤber ihm befindliche
Feuer lebhafter angefacht werde, als jenes, welches uͤber dem vorderen
Aschenloche brennt; und damit also die hier entwikelten Daͤmpfe uͤber
dem hinteren Aschenloche zur Verbrennung kommen. Es versteht sich wohl von selbst,
daß das Hintere Aschenloch mit einem Thuͤrchen versehen seyn muß, damit man
es gehoͤrig reinigen kann.
Fig. 57 zeigt
den dritten Theil meiner Erfindung, der darauf hinaus geht, jener Art von Kesseln,
auf die ich unter dem angegebenen Datum ein Patent erhielt, einen hoͤheren
Grad von Staͤrke zu geben. Ich bezweke dieß, indem ich die Roͤhren,
aus denen der Kessel großen Theils besteht, an die obere oder Dekelplatte des
Kessels hinauf fuͤhre, sie durch diese hindurch schraube und dann fest
verniete. Die Roͤhren werden demnach nicht nur zur Leitung der Ofenhize durch
den Kessel, sondern zugleich auch zur Verstaͤrkung dieses lezteren
benuzt.
Tafeln