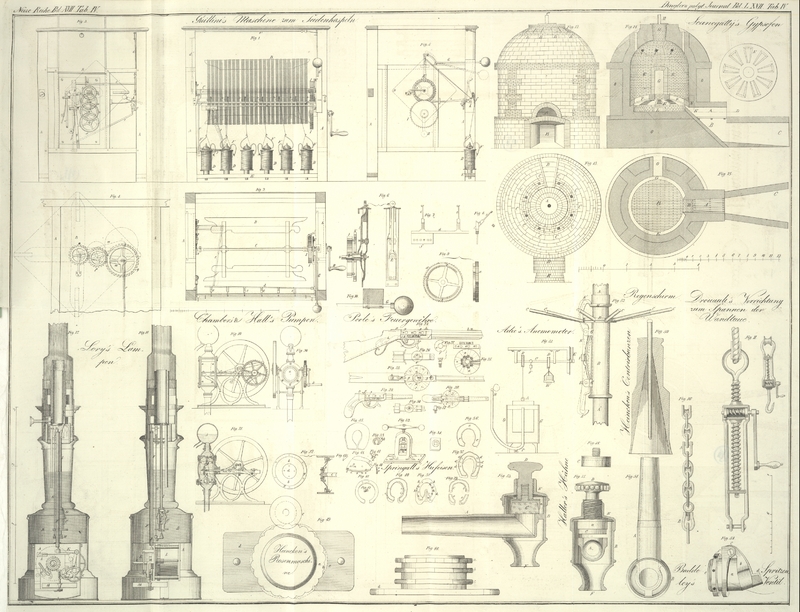| Titel: | Beschreibung eines mit Steinkohlen zu heizenden Gypsofens. Von Hrn. Scanegatty. |
| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. LIV., S. 193 |
| Download: | XML |
LIV.
Beschreibung eines mit Steinkohlen zu heizenden
Gypsofens. Von Hrn. Scanegatty.
Aus dem Journal des connaissances usuelles. Junius
1837, S. 254.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Scanegatty's Gypsofen.
Die Zubereitung, welche man dem Gypse gibt, um ihn zum alltaͤglichen Gebrauche
geeignet zu machen, besteht darin, daß man ihm 19 Procent Krystallisationswasser
entzieht, und zwar durch das sogenannte Brennen. Gay-Lussac fand, daß dieses Brennen bei einer Temperatur von
150° vollbracht werden koͤnne, und daß es daher keiner so bedeutenden
Hize bedarf, wie man gewoͤhnlich glaubt. Payen,
der die Graͤnzen, innerhalb welcher das Brennen vortheilhaft geschehen
koͤnne, zu bestimmen suchte, fand, daß das Brennen bei 80° des
100gradigen Thermometers Statt finden koͤnne; daß aber der Gyps eine
Veraͤnderung erleide und seine Plasticitaͤt verliere, wenn man ihn
weiter als zum Rothbraungluͤhen erhizt. In lezterem Falle wird er
naͤmlich sandig und unfaͤhig, die 19 Procent Wasser, die ihm zur
Krystallisation fehlten, wieder zu absorbiren. Es ist demnach ein Leichtes, den Gyps
bei gehoͤriger Temperatur zu brennen; denn man hat einen Spielraum von der
Temperatur des
siedenden Wassers an bis zum dunkeln Rothgluͤhen.
Wir geben hier die Beschreibung eines mit Steinkohlen zu heizenden Gypsofens, an dem
wir einige neue Einrichtungen angebracht haben, und der auch sehr genuͤgende
Resultate gab.
Unser Ofen, in welchem 220 Kubikfuß Gyps gebrannt werden koͤnnen, hat einen
kubischen Inhalt von 325 Fuß; denn es muͤssen beim Einrichten des Gypses
fuͤr den Durchzug und die Circulation der Flamme Raͤume gelassen
werden. An dem in Fig. 12 ersichtlichen Aufrisse des Ofens ist A die Thuͤr zum Feuerherde; B der
Eingang des Zugloches; C eine Eisenplatte, welche oben
die Deke des Ofens bildet, und an der sich der Schornstein befindet. Bei D, D, D bemerkt man die Luftloͤcher oder
Register, die zur Regulirung des Feuers dienen.
In Fig. 13
sieht man den Ofen von Oben und im Perspektive betrachtet. Hier ist A die Oeffnung in der Mitte der Kuppel oder
Woͤlbung; B eine an dieser Woͤlbung
angebrachte Stiege, welche den Dienst erleichtert. C, C,
C sind die Luftloͤcher oder Register, welche zur Regulirung des
Feuers dienen. D ist das Gewoͤlbe des
Feuerherdes, und E der obere Theil des Zugloches.
Fig. 14 zeigt
den Ofen mit dem Feuerherde in einem durchschnittlichen Aufrisse. A ist der Feuerherd; B die
unter dem Roste befindliche Aschengrube; C das Zugloch;
D die zum Herde fuͤhrende Thuͤr; E die Oeffnung, durch welche die Flamme aus dem
Feuerherde unter das Gewoͤlbe des Ofens eintritt; F der Boden des Gewoͤlbes, der die Flamme circuliren laͤßt;
G die Oeffnung, durch die man den Ofen bedient; H eine Oeffnung, bei der die Fuͤllung des Ofens
gaͤnzlich vollbracht wird, und die mit der Platte und dem darauf gesezten
Schornsteine M bedekt ist. Die durch die Dike des
Gewoͤlbes gehenden Zugloͤcher sieht man hier bei J, J, J. Das Loch L dient
zur Reinigung des unter dem Gewoͤlbe befindlichen Raumes und zur Entfernung
des Gypses, der allenfalls durch die Loͤcher des Gewoͤlbes gefallen
seyn konnte. Die Buchstaben O, O bezeichnen die Dike der
Waͤnde, und P, P ist ein durchbrochenes
Gewoͤlbe, auf welches die Gypssteine gelegt werden, und welches auf den
Einziehungen N, N ruht. K, K
ist der leere Raum, der mit dem zu brennenden Gypse ausgefuͤllt wird. Wenn
man also auf dem Roste A Steinkohlen aufzuͤndet,
so wird die durch das Luftloch C einstroͤmende
Luft die Flamme durch die Oeffnung E treiben, damit sie
in dem Raume F circulire und dann durch die Oeffnungen
des Gewoͤlbes P, P entweiche, um den Gyps zu
brennen.
Fig. 15 zeigt
einen horizontalen Durchschnitt des Ofens. Den Rost sieht man hier bei A; den
Boden bei B; das Zugloch bei C; die Oeffnung, durch welche die Flamme unter das Gewoͤlbe
eintritt, bei D; die Einziehung, auf der das
Gewoͤlbe ruht, bei E; die zur Reinigung des
Raumes unter dem Gewoͤlbe dienende Oeffnung bei G; und die Mauern des Ofens bei O, O.
Um nun diesen Ofen zu fuͤllen, schafft man durch die Oeffnung G so viele rohe Gypsbloͤke hinein, als man kann,
und verschließt dann die Oeffnung mit Baksteinen und Thon, oder mit Erde, der etwas
Gyps beigemengt worden ist. Die gaͤnzliche Fuͤllung wird durch die mit
H bezeichnete Oeffnung bewerkstelligt. Nach
gaͤnzlich vollbrachter Fuͤllung zuͤndet man auf dem Herde ein
Feuer auf, wo man dann mit der Feuerung so lange fortfaͤhrt, bis der bei den
Registern austretende Rauch nicht mehr feucht ist. Man uͤberzeugt sich hievon
leicht mittelst eines polirten, kalten Koͤrpers. Sezt der Rauch keine
Feuchtigkeit mehr ab, so verschließt man alle Ausgaͤnge des Ofens auf das
Genaueste; und wenn sie 12 bis 15 Stunden in diesem Zustande belassen worden sind,
so oͤffnet man sie, wo man dann den Gyps vollkommen gebrannt finden wird.
Der auf diese Weise gebrannte Gyps hat einige Vorzuͤge vor dem mit Holz und
Torf gebrannten. Er ist weißer, verwandelt sich unter der Stampfe in ein viel
feineres Pulver, und die damit verfertigten Figuren, Vasen u. dergl. bekommen mehr
Weiße, mehr Haͤrte und mehr Klang. Man hat dem mit Steinkohlen gebrannten
Gypse den Vorwurf gemacht, daß er so aͤzend werde, daß er den damit
beschaͤftigten Arbeitern schaͤdlich wird. Bei unserer Methode ereignet
sich dieß nie, und nie hoͤrten wir, daß unser Gyps selbst zarte
Frauenzimmerhaͤnde bei lange fortgeseztem Kneten mehr angegriffen
haͤtte, als der mit Holz gebrannte Gyps dieß zu thun pflegt.
Wir fuͤgen der hier gegebenen Beschreibung, unseres Ofens nur noch einen
Auszug aus dem Berichte bei, den die HH. Sage,
Vandermonde und Monge der Akademie uͤber
denselben erstatteten.
Der Gypsstein wird, wenn er hinlaͤngliche Zeit uͤber der Hize ausgesezt
gewesen ist, und wenn er Alles oder beinahe alles Krystallisationswasser verloren
hat, so zerreiblich, daß er sich leicht in ein sehr feines und sehr weißes Pulver
verwandeln laͤßt. Dieser gebrannte Gyps besizt eine große Neigung das ihm
entzogene Krystallisationswasser wieder anzuziehen, und thut dieß auch wirklich,
wenn er unter Umstaͤnde, die hiezu guͤnstig sind, gebracht wird. Daher
kommt es auch, daß gebrannter Gyps sich an der freien Luft loͤscht, und nach
und nach in gewoͤhnlichen Gyps verwandelt.
Wenn man frisch gebranntes Gypspulver ploͤzlich mit etwas mehr Wasser uͤbergießt,
als ihm durch das Brennen entzogen wurde, so wird dieses Wasser ziemlich rasch
absorbirt. Dabei erlangt der damit geformte Teig eine bedeutende Haͤrte,
waͤhrend zugleich auch eine merkliche Temperaturerhoͤhung Statt
findet. Koͤnnte das Brennen des Gypses im Großen mit derselben Sorgfalt
geschehen, wie bei Laboratoriumsversuchen; und ließe sich die Operation so leiten,
daß nur Alles oder beinahe alles Krystallisationswasser und nichts anderes mit
verfluͤchtigt wuͤrde, so wuͤrde der Gyps nicht nur viel besser
ausfallen, sondern man koͤnnte ihn auch, nachdem er bereits verwendet worden
ist, abermals brennen. Im Großen ist es jedoch schwer, der ganzen, in den Ofen
gebrachten Masse eine solche Temperatur zu geben, daß ihr das Krystallisationswasser
entzogen wird, ohne daß sie durch und durch oder auch nur in den dem Feuerherde
zunaͤchst liegenden Stuͤken zum Gluͤhen kommt. Die
uͤberhizten Theile verlieren aber nicht nur ihr Krystallisationswasser,
sondern auch noch einen Theil ihrer Saͤure, was man an dem Geruch nach
schwefeliger Saͤure, der dem aus den Gypsoͤfen entweichenden Rauche
eigen ist, erkennt. Die Folge hievon ist: 1) daß der hiedurch entstehende und im
Gypse verbreitete Aezkalk nicht anders erhaͤrten kann, als durch
allmaͤhliche Anziehung von Kohlensaͤure aus der Luft, und daß also der
Gyps nicht so schnell erhaͤrtet, als dieß sonst, wenn er rein ist, durch die
profuse Krystallisation zu geschehen pflegt. 2) daß man den Gyps nicht ein zweites
Mal anwenden kann; denn bei einem zweiten, auf gleiche Weise vollbrachtem Brennen
wird abermals eine Quantitaͤt Gyps zersezt, so daß der eben geruͤgte
Fehler in noch weit hoͤherem Grade eintritt.
Es waͤre demnach sehr wuͤnschenswerth, daß das Brennen des Gypses mit
groͤßerer Sorgfalt geschaͤhe; besonders wenn dieß ohne
Kostenvermehrung moͤglich ist. Hr. Scanegatty
sucht dieß durch einen eigens gebauten Ofen, durch gehoͤrige Regulirung des
Feuers zu erreichen, wobei er der Wohlfeilheit wegen Steinkohlen anstatt des Holzes
als Brennmaterial anzuwenden vorschlaͤgt. Die Hize laͤßt sich in
diesem Ofen beinahe auf dieselbe Weise dirigiren, wie in den gewoͤhnlichen
Kohlenmeilern: d.h. man oͤffnet die Register an jener Seite, gegen die man
die Hize hinleiten will, und verschließt dafuͤr jene an der entgegengesezten
Seite. Mit einiger Aufmerksamkeit ist es ein Leichtes die Feuerung so zu leiten, daß
jede horizontale Schichte Gyps in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmaͤßig
gebrannt wird. Eine der Hauptaufgaben, die sich Hr. Scanegatty sezte, war Verhuͤtung einer Ueberhizung des Gypses; denn
das Krystallisationswasser ist auszutreiben, ohne daß zu viel Saͤure
verfluͤchtigt wird. Die Beobachtung gab ihm in dieser Hinsicht ein Mittel an
die Hand: die
Feuerung war naͤmlich nur so lange fortzusezen, als die bei den Registern
entweichende elastische Fluͤssigkeit noch eine merkliche Quantitaͤt
Wasser aufgeloͤst enthielt: d.h. so lange sie im Stande war kalte
Koͤrper, die man ihr aussezte, zu befeuchten. So wie dieß nicht mehr Statt
findet, ist die Operation beendigt; man verschließt daher saͤmmtliche
Oeffnungen des Ofens und laͤßt ihn durch 15 Stunden langsam abkuͤhlen.
Im Momente des Verschließens sind die unteren Schichten nothwendig viel
staͤrker erhizt, als die oberen; beim Abkuͤhlen verbreitet sich jedoch
die Hize mehr gleichfoͤrmig uͤber den ganzen Inhalt des Ofens, so daß
auch jene Theile, die fruͤher nicht genuͤgend gebrannt waren, Zeit
haben, die zur gaͤnzlichen Brennung noͤthige Temperatur zu erlangen,
besonders wenn man, wie es denn auch gewoͤhnlich zu geschehen pflegt, die
groͤßeren Gypsbloͤke zu unterst in den Ofen legte.
Hr. Scanegatty betreibt sein Verfahren im Großen, und
versichert, daß die Kosten dabei um die Haͤlfte geringer sind, als bei der
herkoͤmmlichen Gypsbrennerei mit Holz oder Torf. Nach den Zeugnissen vieler
Baumeister und Kuͤnstler gehoͤrt der von ihm erzeugte Gyps zu dem
besten, den man haben kann.
Tafeln