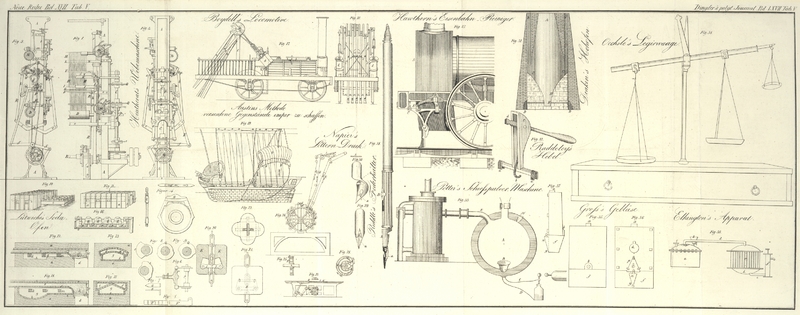| Titel: | Verbesserungen an den Apparaten zur Zersezung des Kochsalzes und in der Art und Weise sich ihrer zu bedienen, worauf sich Thomas Lutwyche, Chemiker und Fabrikant in Liverpool, am 13. Oktober 1836 ein Patent ertheilen ließ. |
| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. LXXVII., S. 268 |
| Download: | XML |
LXXVII.
Verbesserungen an den Apparaten zur Zersezung des
Kochsalzes und in der Art und Weise sich ihrer zu bedienen, worauf sich Thomas Lutwyche, Chemiker und
Fabrikant in Liverpool, am 13.
Oktober 1836 ein Patent ertheilen ließ.
Aus dem London Journal of arts. Decbr. 1837, S.
139.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Lutwyche's Apparat zur Zersezung des Kochsalzes.
Der Zwek, den sich der Patenttraͤger sezte, ist Verhuͤtung des
Entweichens des bei der Zersezung des Kochsalzes frei werdenden salzsauren Gases
durch Verdichtung desselben in entsprechenden Vorrichtungen, und Vollbringung des
ganzen Processes auf eine vortheilhaftere Weise, als es mit den dermalen
gewoͤhnlich gebraͤuchlichen Apparaten moͤglich ist.
Man pflegt die Zersezung des Kochsalzes mit Schwefelsaͤure entweder in
cylindrischen eisernen Retorten oder in offenen, aus Baksteinen aufgefuͤhrten
Oefen vorzunehmen. In ersterem Falle, wo man die Hize von Außen auf den Boden der
Retorte einwirken laͤßt, beabsichtigt man nicht nur die Erzeugung von
Glaubersalz oder schwefelsaurem Natron, sondern auch die Gewinnung der
Salzsaͤure. Ersteres bewerkstelligt man, indem man das bei der Zersezung frei
werdende Gas in zweihaͤlsige Vorlagen leitet, die man oben auf bekannte Weise
durch eingekittete irdene Roͤhren sowohl unter einander, als auch mit der
Retorte verbindet. In lezterem Falle dagegen ist das Streben mehr auf Erzielung
eines besseren und vollkommeneren Glaubersalzkuchens gerichtet; weßhalb man denn
auch Hize und Flamme direct auf die der Behandlung unterliegenden Materialien
wirken, und das salzsaure Gas dafuͤr unbenuzt in die atmosphaͤrische
Luft entweichen laͤßt. Der ersteren dieser Methoden laͤßt sich
unvollkommene Zersezung des Salzes, Unreinheit der Saͤure und Schwierigkeit
der Verdichtung zum Vorwurfe machen; der lezteren hingegen das ungeheure Volumen des
entweichenden salzsauren Gases und der uͤbrigen schaͤdlichen
Daͤmpfe, die der ganzen Nachbarschaft eben so nachtheilig als laͤstig
werden.
Der verbesserte Apparat besteht erstlich in einem eigenen geschlossenen Ofen oder einer Zersezungskammer
mit den dazu gehoͤrigen Feuerstellen und Feuerzuͤgen, wozu
hauptsaͤchlich Baksteine und Moͤrtel verwendet werden. Innerhalb
dieser Kammer sind beilaͤufig in einer Entfernung von 6 Zoll von einander
zwei Lager oder Boden angebracht, uͤber denen mit schief gelegten Baksteinen
ein Bogen oder ein Gewoͤlbe gebaut ist, welches die Kammer von dem Feuer
trennt, und welches die Flamme und den Rauch hindert, mit den der Behandlung
unterliegenden Materialien in Beruͤhrung zu kommen, ohne daß jedoch dem
Zutritt der zur Zersezung noͤthigen Hize ein Hinderniß im Wege steht. Bei
dieser Einrichtung kann das aus dem Kochsalze entwikelte salzsaure Gas, da es von
dem Rauche und den gasartigen Stoffen, die sich bei der Verbrennung aus dem
Brennmateriale entwikeln, geschieden ist, leichter verdichtet werden. Ueber diesem
Gewoͤlbe ist aus Baksteinen ein zweites gebaut, und hiedurch werden die
Feuerzuͤge gebildet. An dem Ende der Zersezungskammer befinden sich eine oder
mehrere Feuerstellen. Das Salz und die Saͤure werden zugleich auf das untere
Lager der Kammer gebracht. In der Seitenwand dieser lezteren findet man zwei
Thuͤren, von denen die eine in der Naͤhe der Mitte des Lagers, die
andere hingegen dicht an dessen Ende und dem oberen Lager zunaͤchst gelegen
ist, damit man die in den Ofen gebrachte Masse leichter von dem unteren Lager auf
das obere schaffen kann, wenn sie ein Mal (was gewoͤhnlich nach wenigen
Stunden zu geschehen pflegt) den hiezu erforderlichen Grad von Festigkeit erlangt
hat. Ist der erste Einsaz von dem unteren Lager auf das obere geschafft, so bringt
man auf das untere einen zweiten, wo dann 10 bis 12 Stunden nach dem Beginnen der
Operation das Glaubersalz aus dem oberen Lager heraus geschafft, das zum Theil
zersezte Salz wieder von dem unteren Lager auf das obere gebracht, und auf das
untere ein neuer Einsaz gemacht werden kann. Obschon demnach die Masse 10 bis 12
Stunden lang im Ofen verweilt, so wird doch alle 5 bis 6 Stunden eine frische Menge
Salz und Schwefelsaͤure auf das untere Lager, und die zersezte Salzmasse aus
dem oberen Lager herausgeschafft.
In den zur Erlaͤuterung beigefuͤgten Abbildungen ist Fig. 10 eine
perspektivische Ansicht des Zersezungsofens und des Verdichtungsapparates gegen die
Fronte der Feuerstellen zu betrachtet. Fig. 11 ist eine
aͤhnliche Ansicht der Seite des Ofens. Fig. 12 ist ein
senkrechter Durchschnitt nach der Laͤnge des Ofens, woraus die geschlossene
Zersezungskammer, die Feuerstellen und die Feuerzuͤge erhellen. Fig. 13
endlich ist ein anderer aͤhnlicher Durchschnitt nach der Quere genommen. An
allen diesen Figuren ist a, a das Mauerwerk des Ofens,
b sind die Feuerstellen, c die Ofenthuͤrchen, d die
Aschengruben,
e, e die in den Schornstein fuͤhrenden
Feuerzuͤge. Der aus feuerfesten Baksteinen aufgefuͤhrte Bogen f, f scheidet die Feuerzuͤge von der
Zersezungskammer g, g, in der das untere Lager mit h, das obere hingegen mit i
bezeichnet ist. Durch die Thuͤre k wird das Salz
und die Saͤure in den Ofen eingetragen, durch die Thuͤre l hingegen schafft man das zum Theil zersezte Salz von
dem unteren auf das obere Lager. Durch die Thuͤre m endlich wird das Glaubersalz aus dem Ofen genommen.
Eine kleine Abaͤnderung des eben beschriebenen Apparates sieht man in Fig. 14 und
15, in
denen aͤhnliche Durchschnitte abgebildet sind, wie in Fig. 12 und 13, und an
denen zur Bezeichnung gleicher Theile die fruͤher gebrauchten Buchstaben
beibehalten sind. Der einzige Unterschied besteht darin, daß hier die Ziegel, welche
die Feuerzuͤge von der Zersezungskammer scheiden, unter einem Winkel und
nicht so gelegt sind, daß sie ein Bogengewoͤlbe bilden, und daß der Scheitel
der Feuerzuͤge stach oder horizontal gebaut ist.
Fig. 16 ist
ein Laͤngendurchschnitt durch einen der Verdichtungsapparate, der sogleich
ausfuͤhrlicher beschrieben werden soll. Der Apparat besteht naͤmlich
aus einem oder mehreren Troͤgen aus Stein, Schiefer, Holz oder einem anderen,
der Einwirkung der Salzsaͤure hinreichend widerstehenden Material. Holz,
welches gut mit gesottenem Theer, Pech oder Colophonium oder mit einer Mischung
dieser Substanzen uͤberzogen worden ist, entsprach dem Patenttraͤger
gut. Als die geeignetste Form gibt er 9 bis 12 Fuß Laͤnge, 3 Fuß Weite und 12
bis 15 Zoll Tiefe an. Einen derlei Trog sieht man bei o,
o, und in diesen werden die aus Thon oder Steingut fabricirten
Leitungsroͤhren p, p auf die aus Fig. 16 ersichtliche
Weise eingefuͤhrt. Wenn in die Troͤge so viel Wasser gegossen worden
ist, daß dasselbe bis auf einige Zoll von den Muͤndungen der Roͤhren
p, p emporreicht, so stuͤrzt man uͤber
die Roͤhrenmuͤndungen die aus Thon oder Steingut bestehenden
Gefaͤße q, q, welche auf diese Weise hydraulische
Gefuͤge oder Verschluͤsse bilden.
Das Gas stroͤmt von dem Ofen her durch die Roͤhren r, r in die Leitungsroͤhren p, p und gelangt daher von einem der Gefaͤße q, q zum anderen. Bis zum vierten oder fuͤnften
Gefaͤße duͤrfte sich jedoch nur wenig von dem Gase begeben, da in
jedem dieser Gefaͤße eine nicht unbedeutende Wassermenge dem Gase dargeboten
ist. Die lezte Leitungs- oder Austrittsroͤhre s steht mit einem Feuerzuge in Verbindung, der in einen Kamin
fuͤhrt, dessen Zug dazu beitraͤgt, das Gas aus dem Ofen
vorwaͤrts zu schaffen und die Verdichtung zu beguͤnstigen. An dem
unteren Theile einer jeden der Leitungsroͤhren p,
p ist eine kleine Roͤhre t, t befestigt,
die durch den Boden des
Troges geht, und durch welche alles Gas, welches sich allenfalls waͤhrend des
Durchganges durch die Roͤhren verdichtet, in einen unterhalb angebrachten
Behaͤlter von entsprechender Form faͤllt. Das Wasser in den
Troͤgen kann so oft gewechselt werden, als man es fuͤr noͤthig
haͤlt. Wenn man keinen Mangel an Wasser hat, und wenn die gesammelte
Saͤure keine bestimmte Staͤrke bekommen soll, so kann man wohl auch an
dem einen Ende des Troges fortwaͤhrend frisches Wasser zufließen, und an dem
anderen das mit Saͤure geschwaͤngerte dafuͤr abfließen lassen.
Soll jedoch die Saͤure zu bestimmten Zweken verwendet werden, so soll man das
Wasser so lange in den Troͤgen belassen, bis die Saͤure die
gewuͤnschte Staͤrke oder specifische Schwere erlangt hat, oder bis die
aus ihr aufsteigenden Daͤmpfe laͤstig zu werden anfangen, oder bis die
Verdichtung nicht mehr gut von Statten geht.
Der Patenttraͤger bindet sich an keine bestimmten Formen und Dimensionen der
Zersezungskammer, noch an einen bestimmten Bau der Bogen, die die Feuerzuͤge
und die Feuerstelle von der Zersezungskammer scheiden. Eben so kann das Medium,
uͤber das das Feuer streicht, aus feuerfesten Ziegeln oder Baksteinen oder
aus anderen entsprechenden Materialien, die schief, horizontal oder in Curven
uͤber die der Behandlung unterliegenden Substanzen gelegt sind, bestehen. Die
Zahl der Verdichtungstroͤge, so wie der Leitungsroͤhren muß sich nach
der Quantitaͤt Salz, die man innerhalb einer bestimmten Zeit zersezen will,
richten.
Tafeln