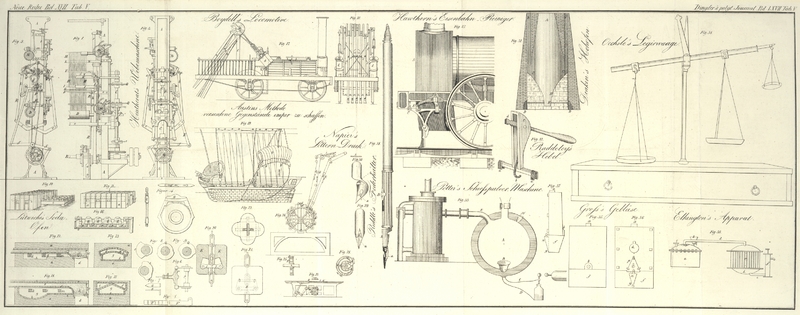| Titel: | Ueber den Groß'schen Apparat zum Erhizen der Luft beim Schmieden. |
| Fundstelle: | Band 67, Jahrgang 1838, Nr. LXXXV., S. 312 |
| Download: | XML |
LXXXV.
Ueber den Groß'schen Apparat zum Erhizen der Luft beim
Schmieden.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Groß's Apparat zum Erhizen der Luft beim Schmieden.
Hr. Lehrschmied Groß an der
koͤnigl. Thierarzneischule in Stuttgart verkaufe bekanntlich schon seit
mehreren Jahren sehr zwekmaͤßige Apparate zum Schmieden mit heißer Luft, die
er von verschiedener Groͤße verfertigt. Seine Vorrichtung ist ein wie
gewoͤhnlich eingemauerter Kastenapparat ohne Circulation, unter dem sich aber
ein Wasserkasten befindet, so daß nebst der erhizten Geblaͤseluft auch der
zutretende Wasserdampf in die Kohlen geblasen wird. Man sieht diesen Apparat nach
den neuesten Verbesserungen auf Tab. V. abgebildet.Riecke's Wochenblatt 1837, Nr. 30.
Fig. 35 zeigt
den ganzen, aus Gußeisen bestehenden Apparat von seiner vorderen, dem Feuer zugekehrten Seite; der
obere groͤßere Theil ist der Windkasten; bei a
wird das Blasrohr aufgenommen! daselbst befindet sich im Inneren des Kastens eine
Vorrichtung, welche das Aufsteigen des Dampfes und der heißen Luft in den Blasebalg
verhindert; b ist die Eßform, mit einem Vorsteker
versehen; f, der untere kleinere Theil, ist der
Wasserbehaͤlter.
Fig. 36
stellt die Hintere Ansicht dar und zeigt, wie die Ruͤkwand oder der Dekel
mittelst Schrauben an den Kasten befestigt ist. Zwischen den Fugen des Dekels so wie
denen des Wasserbehaͤlters sind neben dem erforderlichen Kitte Schienen oder
Streifen von gewalztem Blei eingelegt, mittelst der bezeichneten Schrauben befestigt
und sonach außerhalb genau vernietet. Schon seit einem Jahre hat man die Erfahrung
gemacht, daß, wenn der Apparat nicht zu unverhaͤltnißmaͤßiger Arbeit
gebraucht wird, wo er rothwarm werden koͤnnte, das Blei nicht schmilzt. d ist eine Klappe, um in das Innere des Kastens sehen zu
koͤnnen, und die leicht in ein Ventil verwandelt werden kann; p ist eine dreiseitig prismatische Vorrichtung
(Dampfgehaͤus), welche mit drei Vorreibern an den Dekel befestigt und mit o,
einer kleinen Klappe, versehen ist, durch welche noͤthigenfalls die Eßform
bequem von Schlaken u. dergl. ausgeraͤumt werden kann; n ist eine becherfoͤrmige, mit einem Stoͤpsel versehene
Oeffnung, durch welche das Wasser eingefuͤllt wird; bei g kann es abgelassen werden.
Fig. 37
bezeichnet den Apparat von der Seite, wie er an der Feueresse angebracht ist, und
zeigt zugleich seine Tiefe. Gleiche Buchstaben bezeichnen in allen drei Figuren
gleiche Gegenstaͤnde. – Durch diese Einrichtung, noch mehr aber wegen
groͤßerer Dauer haben diese Apparate an Gewicht zugenommen, und sind bloß in
diesem Verhaͤltnisse etwas theurer. In Ruͤksicht fuͤr die
verschiedenen Feuerarbeiter bestehen noch immer fuͤnf verschiedene
Groͤßen oder Nummern, und auch doppelte. Den Verschleiß derselben besorgt das
Handlungshaus Mornhinweg und Brecht in Stuttgart.
Auf das Unzweideutigste ist nachgewiesen, daß der Apparat 1/4 bis 1/3 an Holz-
oder Steinkohlen und 1/3 bis 1/4 an Zeit erspart. Unter den Hindernissen, welche
dessen weiterer Einfuͤhrung bisher entgegenstanden, sind aber besonders
folgende zu nennen: Haͤufig wurde das Blasrohr unter zu spizem Winkel mit dem
Kasten verbunden, oder der Balg war schlecht eingerichtet, oder die Fugen an Rohr
und Kasten waren nicht gehoͤrig verdichtet, oder es wurden von den Besizern
zwekwidrige Anordnungen vorgenommen, durch welche die Wirkung des Apparates
zerstoͤrt oder vernichtet wurde, oder es wurde der Apparat nicht
gehoͤrig gewartet, oder endlich die Groͤße des eingesezten Apparates entsprach nicht
dem Beduͤrfnisse der Arbeit.
Tafeln